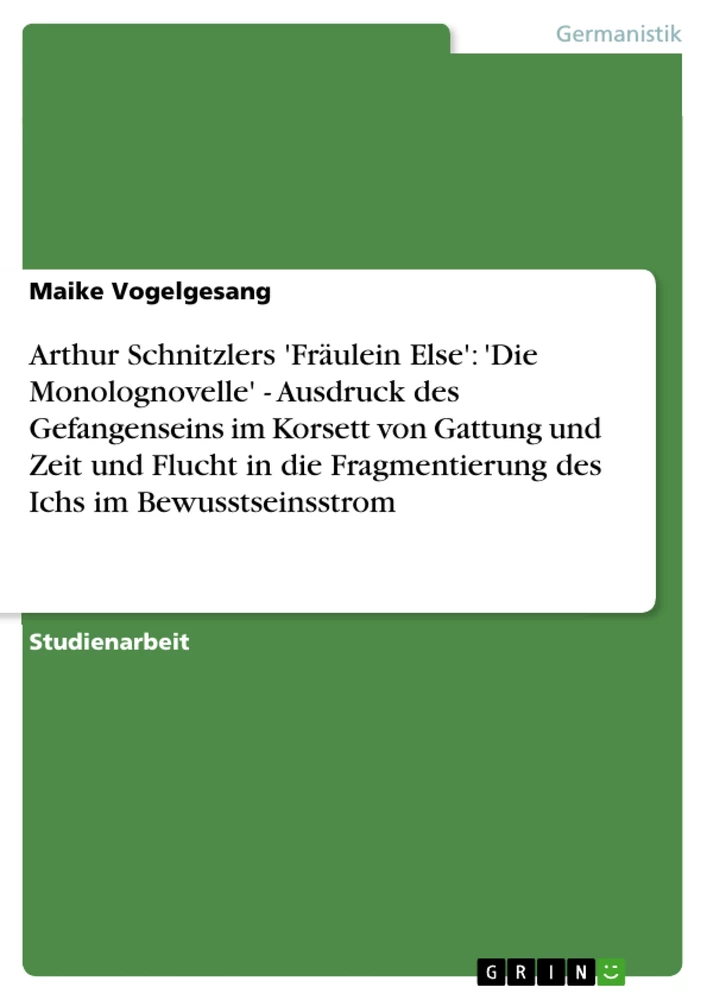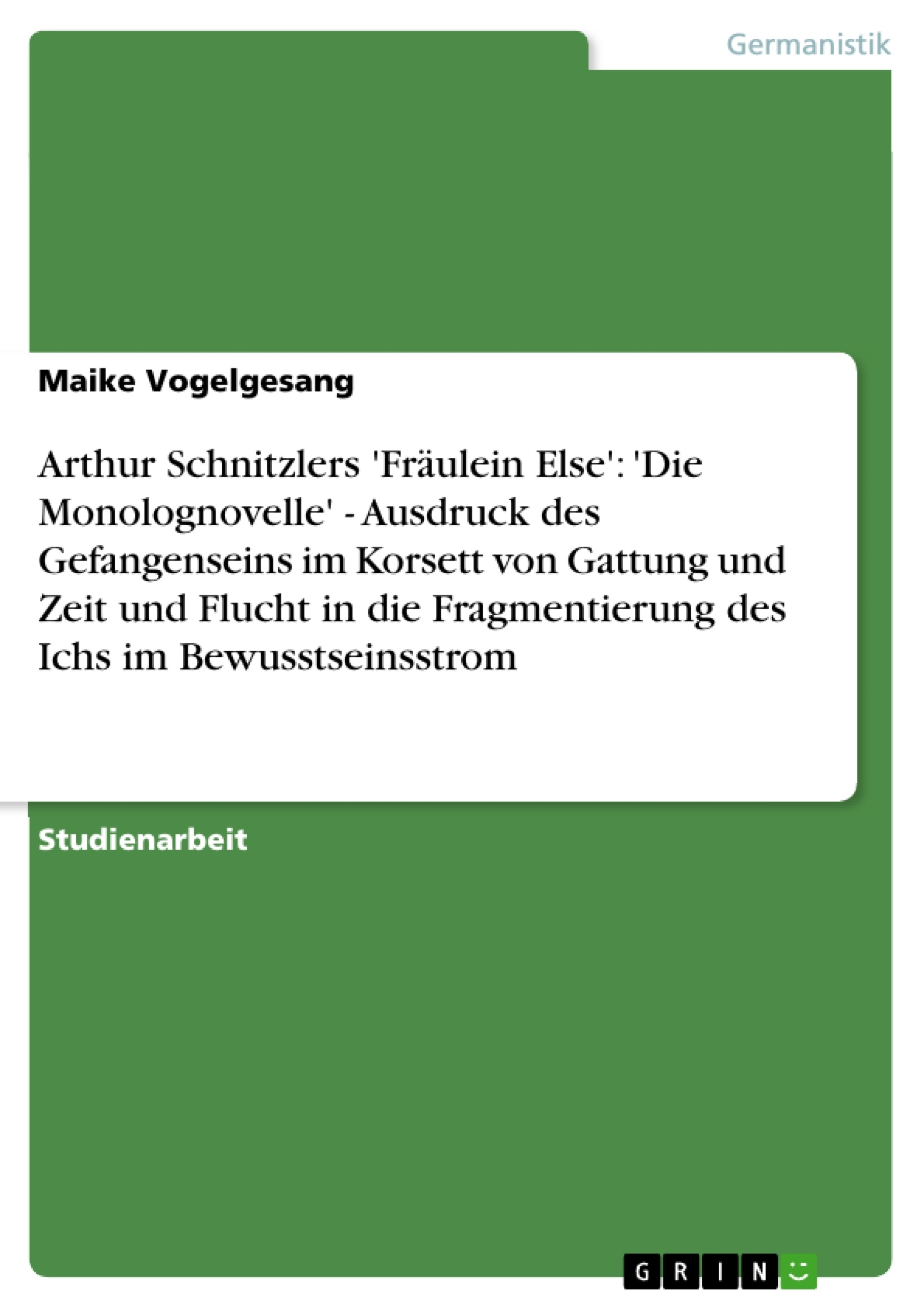Siebzigtausend verkaufte Exemplare, die Umsetzung des Stoffs in einem Stummfilm und überwältigende Lobeshymnen auf den Autor - das ist die Bilanz des Meisterstücks ‚Fräulein Else’. Arthur Schnitzer selbst, einer der größten Erzähler und Dramatiker der literarischen Wiener Moderne, empfand sein Werk, wie aus Tagebuchnotizen hervorgeht, recht gelungen; eine Selbstzufriedenheit, die für ihn eher untypisch war. ‚Fräulein Else’ (1924) erzählt das Schicksal eines jungen Mädchens, das ihren Vater nur durch den Verkauf ihres Körpers vor dem Gefängnis oder dem möglichen Freitod bewahren kann und letztlich an dieser Aufgabe zugrunde geht. In Schnitzlers Augen kann nur eine Erzähltechnik den Anforderungen des Stoffs gerecht werden. Nur der Innere Monolog vermag es, die Tiefen des unbewussten Seelenlebens einer Figur, die einer existentiellen Krise ausgesetzt ist, dem Leser nahe zu bringen. Schon einmal hatte sich Arthur Schnitzler für den Inneren Monolog zur Umsetzung einer Thematik entschieden. ‚Leutnant Gustl’ war zwanzig Jahre zuvor erschienen und der erste Versuch des Autors, mit dieser Erzähltechnik zu arbeiten. Hugo von Hofmannsthal, einer der wichtigsten Vertreter des Jungen Wiens, schrieb in einem Brief an Arthur Schnitzler: „Ja, so gut Leutnant Gustl erzählt ist, ‚Fräulein Else’ schlägt ihn freilich noch; das ist innerhalb der deutschen Literatur wirklich ein genre für sich, das sie geschaffen haben.“ Hofmannsthal erkannte schon 1929, was bis heute gilt: Arthur Schnitzler steht für die erstmalige Verwirklichung des vollkommenen Inneren Monologs in der deutschsprachigen Literatur. Der Innere Monolog, auch unter ‚Stream of Consciousness’ bekannt, zeichnet sich durch seine mangelnde Struktur, durch Auslassungen und Ausrufe aus. Die Gedanken des Monologierenden fließen scheinbar ungebremst, formlos. Die Bezeichnung Innerer Monolog stellt jedoch lediglich eine Art der Erzähltechnik dar; eine Gattungszuweisung geht damit nicht einher. Zahlreiche Autoren ordnen Schnitzlers Werk der Novellengattung zu. Auch Schnitzler äußert sich in einem Brief vom 21. Februar 1925 an Gabor Nobl, in dem es um Muster und Vorbilder von ‚Fräulein Else’ geht, dahingehend. „Damit ist aber auch alles erschöpft, was in meiner Novelle [‚Fräulein Else’] mit Realität im engeren Sinne zu tun hat.“ Auch Jürgen Zenke macht auf den Umstand aufmerksam, dass „die beiden Monologerzählungen Schnitzlers fast ausnahmslos Novellen genannt [werden]“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. ‚Fräulein Else‘ - Gefangen im Korsett von Gattung und Zeit
- 2.1. Ein erster kritischer Zugang zu dem Novellenbegriff
- 2.2. Die Novellenkriterien nach Hugo Aust und ihr Umsetzung in ‚Fräulein Else‘
- 3. Die Fragmentierung des Ichs: Der Innere Monolog in ‚Fräulein Else‘
- 3.1. Die Erzähltechnik des Inneren Monologs
- 3.2. Die Herausforderung des Inneren Monologs und ihre Bewältigung in ‚Fräulein Else‘
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ und analysiert die Verbindung zwischen der Erzähltechnik des Inneren Monologs und der Gattung der Novelle. Die Analyse befasst sich mit der Frage, inwiefern die „Monolognovelle“ als Genrebezeichnung für das Werk zutreffend ist.
- Die Einordnung von „Fräulein Else“ in die literarische Gattung der Novelle
- Die Anwendung und die Herausforderungen der Erzähltechnik des Inneren Monologs
- Die Darstellung des weiblichen Ichs und seiner gesellschaftlichen Gefangenschaft
- Die existenzielle Krise der Protagonistin und ihre moralischen Konflikte
- Die Beziehung zwischen Form und Inhalt in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt „Fräulein Else“ als Meisterwerk der literarischen Moderne vor und hebt die Bedeutung des Inneren Monologs als Erzähltechnik hervor. Sie erwähnt die positive Rezeption des Werkes und verweist auf Schnitzlers früheres Experiment mit dem Inneren Monolog in „Leutnant Gustl“. Die Einleitung führt die zentrale Frage der Arbeit ein: die Vereinbarkeit von Innerem Monolog und der Novellengattung, um die Klassifizierung als „Monolognovelle“ zu untersuchen. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Kriterien der Novelle beleuchtet und die Umsetzung des Inneren Monologs analysiert.
2. ‚Fräulein Else‘ – Gefangene im Korsett von Gattung und Zeit: Dieses Kapitel analysiert die Einordnung von „Fräulein Else“ in die Gattung der Novelle. Es beginnt mit einer einfachen Definition des Novellenbegriffs, die auf die Darstellung einer ungewöhnlichen Geschichte und eine zentrale Krise des Protagonisten verweist. Diese Definition wird auf „Fräulein Else“ angewendet, wobei Elses Handlung und deren Folgen als Belege für die Zugehörigkeit zur Novellengattung dienen. Anschließend wird ein von Hugo Aust entwickelter Merkmalskatalog für Novellen vorgestellt. Die Arbeit betont, dass dieser Katalog kein starres Schema ist, sondern ein analytisches Werkzeug zur Erschließung des Werks.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Fräulein Else, Novelle, Monolognovelle, Innerer Monolog, Stream of Consciousness, Gattungsanalyse, Erzähltechnik, existenzielle Krise, weibliches Ich, bürgerliche Moral, Wiener Moderne.
Häufig gestellte Fragen zu: Fräulein Else - Eine Analyse von Erzähltechnik und Gattung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“, konzentriert sich dabei auf die Verbindung zwischen der Erzähltechnik des Inneren Monologs und der literarischen Gattung der Novelle. Ein zentrales Thema ist die Frage, ob die Bezeichnung „Monolognovelle“ für das Werk zutreffend ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Einordnung von „Fräulein Else“ in die Gattung der Novelle, die Anwendung und Herausforderungen des Inneren Monologs als Erzähltechnik, die Darstellung des weiblichen Ichs und seiner gesellschaftlichen Gefangenschaft, die existenzielle Krise der Protagonistin und ihre moralischen Konflikte sowie die Beziehung zwischen Form und Inhalt in der Novelle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Novelle vor, hebt die Bedeutung des Inneren Monologs hervor und formuliert die zentrale Forschungsfrage. Kapitel 2 („Fräulein Else“ – Gefangene im Korsett von Gattung und Zeit) analysiert die Einordnung des Werks in die Gattung der Novelle anhand einer Definition des Begriffs und eines Merkmalskatalogs nach Hugo Aust. Kapitel 3 (Die Fragmentierung des Ichs: Der Innere Monolog in „Fräulein Else“) befasst sich mit der Erzähltechnik des Inneren Monologs und ihrer Umsetzung in der Novelle. Kapitel 4 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet gattungsanalytische Methoden, um „Fräulein Else“ als Novelle zu klassifizieren. Sie analysiert die Umsetzung des Inneren Monologs als Erzähltechnik und untersucht die Beziehung zwischen Form und Inhalt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arthur Schnitzler, Fräulein Else, Novelle, Monolognovelle, Innerer Monolog, Stream of Consciousness, Gattungsanalyse, Erzähltechnik, existenzielle Krise, weibliches Ich, bürgerliche Moral, Wiener Moderne.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Verbindung zwischen der Erzähltechnik des Inneren Monologs und der Gattung der Novelle in „Fräulein Else“ zu untersuchen und die Eignung des Begriffs „Monolognovelle“ zu prüfen.
Wie wird der innere Monolog in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse untersucht die Anwendung und die Herausforderungen des Inneren Monologs als Erzähltechnik in „Fräulein Else“. Es wird betrachtet, wie diese Technik die Darstellung des weiblichen Ichs und dessen innerer Konflikte beeinflusst.
- Quote paper
- Maike Vogelgesang (Author), 2006, Arthur Schnitzlers 'Fräulein Else': 'Die Monolognovelle' - Ausdruck des Gefangenseins im Korsett von Gattung und Zeit und Flucht in die Fragmentierung des Ichs im Bewusstseinsstrom, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66904