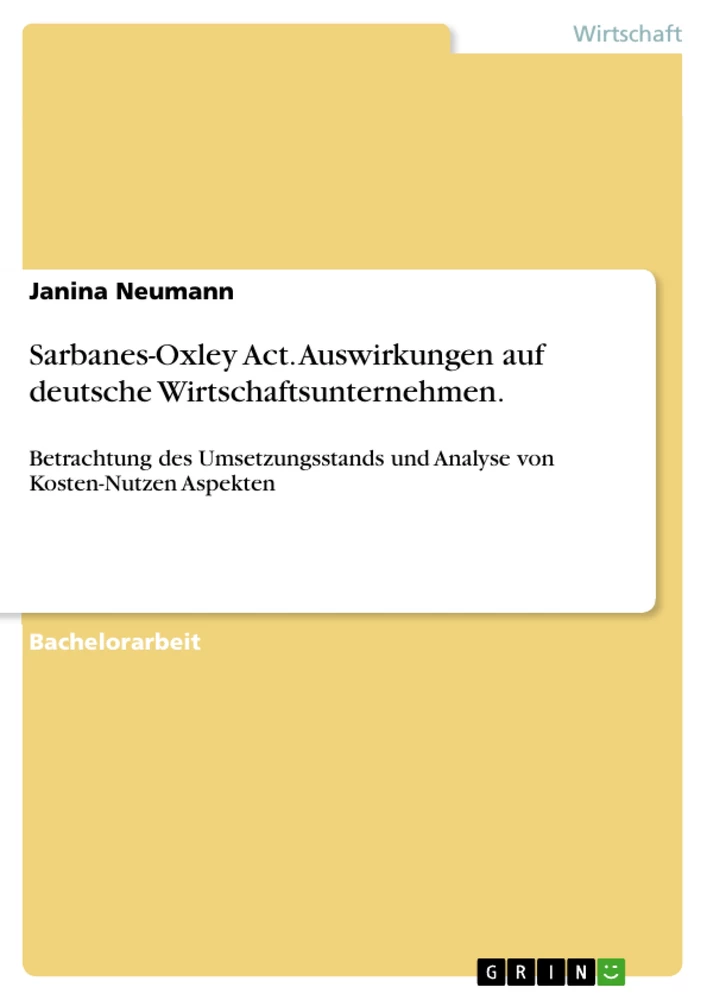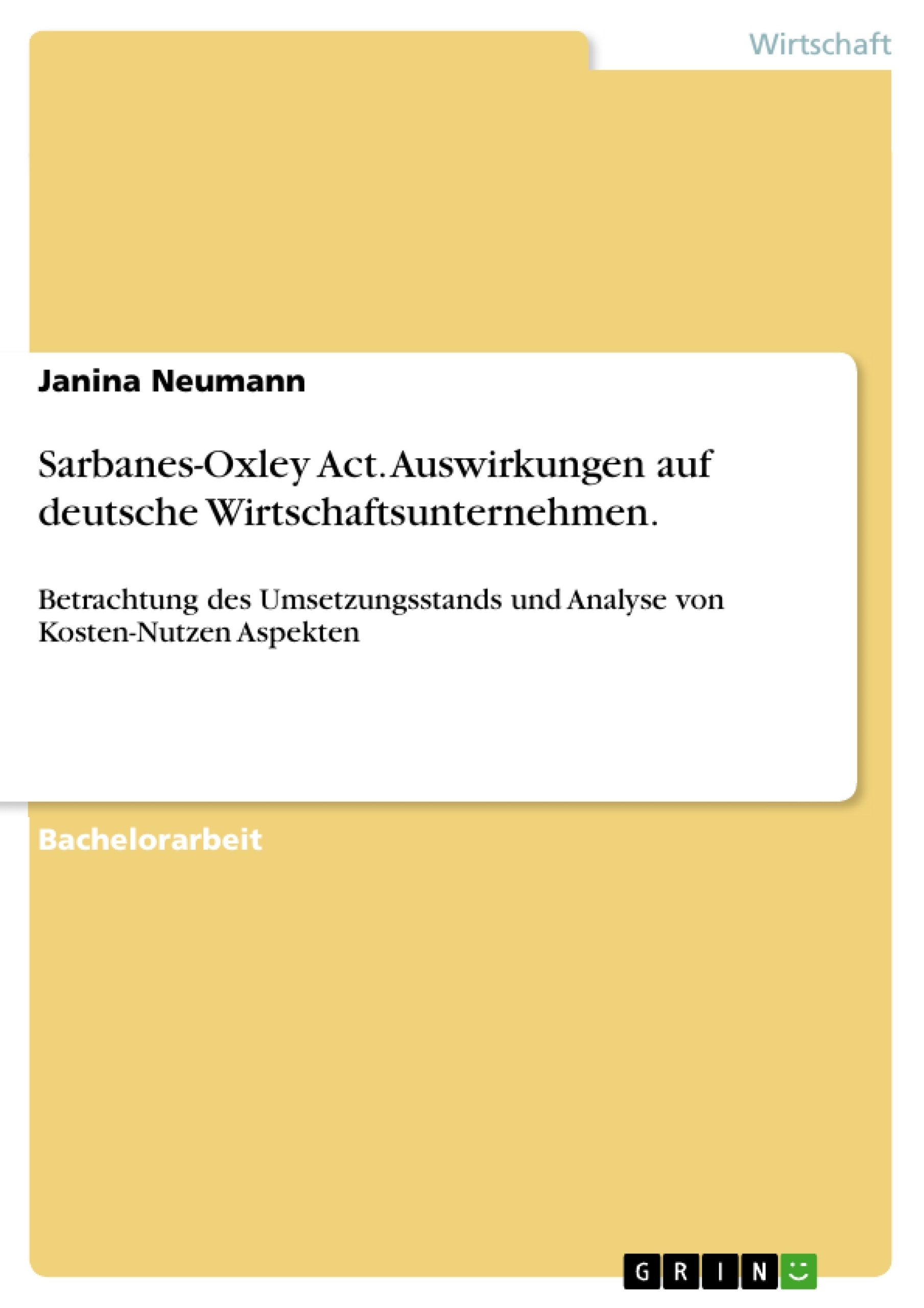Das Vertrauen der Anleger in die Kapitalmärkte wurde durch verschiedene Finanzskandale großer amerikanischer Firmen, wie dem Energiekonzern Enron oder dem Telekommunikationsunternehmen Worldcom nachhaltig geschädigt. Dem entstandenen Vertrauensverlust versuchte der amerikanische Gesetzgeber mit der Verabschiedung des Sarbanes-Oxley Act (SOA) entgegenzuwirken, der mit der Unterzeichnung von Präsident George W. Bush am 30. Juli 2002 rechtskräftig wurde. Benannt wurde das Gesetz nach den beiden Autoren, Senator Paul S. Sarbanes und dem Kongressabgeordneten Michael G. Oxley. 1 Dem Gesetzestext geht folgender Einführungssatz voraus: “An Act to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes.” 2 Ziel des Gesetzes ist es demnach, die Anleger durch genauere und verlässlichere Unternehmenspublizität zu schützen. Das Gesetz soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Corporate Governance von börsennotierten Unternehmen leisten. Die Einzelvorschriften zielen darauf ab, die Qualität der Finanzberichterstattung und der veröffentlichten Informationen börsennotierter Unternehmen zu verbessern, indem die Verantwortlichkeiten des Managements und des Board of Directors genauer definiert, die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer bestärkt, leistungsfähigere interne Kontrollen vorgeschrieben und härtere Strafen bei Nichteinhaltung der Vorschriften eingeführt werden. Die Regelungen zielen darauf ab, das Vertrauen der Anleger in die Finanzmärkte wiederzugewinnen. Auch wenn der Sarbanes-Oxley Act ein US-amerikanisches Gesetz ist, hat er dennoch unmittelbare Auswirkungen auf deutsche Unternehmen, die an einer amerikanischen Börse gelistet sind. Denn unabhängig vom Stammsitz des Unternehmens unterliegen alle Gesellschaften, die an US-amerikanischen Börsen notiert sind, den Regelungen des SOA. Darüber hinaus unterliegen auch Tochtergesellschaften von Unternehmen, deren Aktien an amerikanischen Börsen gehandelt werden, den Vorschriften des SOA. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorgehensweise und Aufbau
- 2. Der Sarbanes-Oxley Act of 2002
- 2.1. Anlass und Auslöser
- 2.1.1. Der Fall Enron
- 2.1.2. Der Fall Worldcom
- 2.2. Ziele des Sarbanes-Oxley Act
- 2.2.1. Geltungsbereich des Sarbanes-Oxley Act
- 2.2.2. Die Securities and Exchange Commission – Die Durchsetzungsbehörde
- 2.3. Inhalt des Gesetzes
- 2.3.1. Title I – Public Company Accounting Oversight Board
- 2.3.2. Title II - Auditor Independence
- 2.3.3. Title III – Corporate Responsibility
- 2.3.4. Title IV - Enhanced Financial Disclosures
- 2.3.5. Title V - XI
- 2.4. Corporate Governance
- 2.4.1. Der Begriff Corporate Governance
- 2.4.2. Corporate Governance Systeme
- 2.4.2.1. Monistische Systeme
- 2.4.2.2. Dualistische Systeme
- 2.5. Unterschiedliche Managementmethoden im Zusammenhang mit dem SOA
- 2.5.1. Compliance Management
- 2.5.2. Risikomanagement
- 2.5.3. Anti-Fraud Management
- 2.5.4. Verflechtungen
- 3. Auswirkungen des SOA auf deutsche Unternehmen
- 3.1. Section 301 – Einrichtung eines Audit Committee
- 3.1.1. Aufgaben eines Audit Committee gemäß Sarbanes-Oxley Act
- 3.1.2. Das Audit Committee in deutschen Unternehmen
- 3.1.3. Vergleich Section 301 – deutsches Recht
- 3.2. Section 302 - Disclosure Controls and Procedures
- 3.2.1. Ausgestaltung von Disclosure Controls and Procedures
- 3.2.2. Aufgaben eines Disclosure Committee
- 3.2.3. Vergleich Section 302 – deutsches Recht
- 3.3. Section 404 – Einrichtung und Dokumentation eines Internen Kontrollsystems der Finanzberichterstattung
- 3.3.1. Begriff des Internen Kontrollsystems
- 3.3.2. COSO als Rahmenwerk für das Interne Kontrollsystem
- 3.3.3. Definition des Internen Kontrollsystems nach COSO
- 3.3.4. Komponenten des Internen Kontrollsystems
- 3.3.4.1. Kontrollumfeld
- 3.3.4.2. Risikobeurteilungen
- 3.3.4.3. Kontrollaktivitäten
- 3.3.4.4. Information und Kommunikation
- 3.3.4.5. Überwachung des internen Kontrollsystems
- 3.3.5. Vergleich Section 404 – deutsches Recht
- 3.4. Der Deutsche Corporate Governance Kodex
- 4. Empirische Untersuchung
- 4.1. Literaturanalyse zu Kosten - Nutzenaspekten
- 4.1.1. Studie: SEC Final Rule Management's Reports on Internal Control Over Financial Reporting and Certification of Disclosure in Exchange Act Periodic Reports
- 4.1.2. Studie: FEI Survey on Sarbanes-Oxley Section 404 Implementation
- 4.1.3. Studie: Sarbanes-Oxley Section 404 Work - Looking at the benefits
- 4.1.4. Studie: Auswirkungen des SOA auf deutsche Unternehmen: Kosten, Nutzen Folgen für US-Börsennotierungen
- 4.1.5. Studie: Der SOA als Instrument der Corporate Governance
- 4.1.6. Zusammenfassung
- 4.2. Die eigene Befragung
- 4.2.1. Vorgehensweise und Aufbau
- 4.2.2. Abschnitt 1: Fragen zu den Unternehmen
- 4.2.3. Abschnitt 2: Fragen zu den Zielen des SOA
- 4.2.4. Abschnitt 3: Fragen zu Nutzenaspekten des SOA
- 4.2.5. Abschnitt 4: Fragen zu der Kosten-/ Nutzenrelation des SOA
- 4.2.6. Ergebnis
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act (SOA) auf deutsche Unternehmen. Ziel ist es, den Umsetzungsstand des SOA in Deutschland zu betrachten und die Kosten-Nutzen-Aspekte zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten des SOA und seiner Relevanz für die deutsche Wirtschaft.
- Umsetzung des Sarbanes-Oxley Act in deutschen Unternehmen
- Analyse der Kosten des SOA für deutsche Unternehmen
- Bewertung des Nutzens des SOA für deutsche Unternehmen
- Vergleich des SOA mit dem deutschen Corporate Governance Kodex
- Empirische Untersuchung der Kosten-Nutzen-Relation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit. Es skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Untersuchung. Der Fokus liegt auf der Begründung der Relevanz des Themas im Kontext der deutschen Wirtschaftslandschaft und der internationalen Entwicklungen im Bereich der Corporate Governance.
2. Der Sarbanes-Oxley Act of 2002: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Darstellung des Sarbanes-Oxley Act (SOA), einschließlich seiner Entstehungsgeschichte, Ziele und Inhalte. Es werden die wichtigsten Abschnitte des Gesetzes (Titles) detailliert erläutert, mit besonderem Augenmerk auf die Aspekte der Corporate Governance und der damit verbundenen Managementmethoden wie Compliance-, Risiko- und Anti-Fraud-Management. Die Fallbeispiele Enron und Worldcom veranschaulichen den dringenden Handlungsbedarf, der zur Verabschiedung des SOA führte. Der Abschnitt zu Corporate Governance-Systemen verdeutlicht den internationalen Kontext.
3. Auswirkungen des SOA auf deutsche Unternehmen: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Auswirkungen des SOA auf deutsche Unternehmen. Es konzentriert sich auf die Umsetzung der Schlüsselbestimmungen des SOA (Section 301, 302 und 404) im deutschen Kontext und vergleicht die Anforderungen des SOA mit den Regelungen des deutschen Rechts. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Einrichtung von Audit Committees und der Implementierung interner Kontrollsysteme. Der Deutsche Corporate Governance Kodex wird als relevante Vergleichsgröße herangezogen, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und die Herausforderungen der Harmonisierung von US-amerikanischem und deutschem Recht hervorzuheben.
4. Empirische Untersuchung: Das Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die zur Analyse der Kosten-Nutzen-Aspekte des SOA durchgeführt wurde. Es werden verschiedene Studien zu den Kosten und dem Nutzen der SOA-Implementierung vorgestellt und analysiert. Die eigene Befragung wird detailliert erläutert, einschließlich der Methodik, des Fragebogendesigns und der Auswertung der Ergebnisse. Die Ergebnisse bieten Einblicke in die Praxis der SOA-Umsetzung in deutschen Unternehmen und die Wahrnehmung der Kosten und des Nutzens durch die befragten Unternehmen.
Schlüsselwörter
Sarbanes-Oxley Act, Corporate Governance, Interne Kontrollsysteme, Audit Committee, Compliance Management, Risikomanagement, Kosten-Nutzen-Analyse, deutsche Unternehmen, SEC, COSO.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act auf deutsche Unternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act (SOA) auf deutsche Unternehmen. Sie analysiert den Umsetzungsstand des SOA in Deutschland und bewertet die Kosten-Nutzen-Aspekte der Implementierung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Facetten des SOA, einschließlich seiner Entstehungsgeschichte, Ziele und Inhalte. Sie analysiert die Umsetzung wichtiger Bestimmungen (Section 301, 302 und 404) im deutschen Kontext und vergleicht diese mit dem deutschen Recht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einrichtung von Audit Committees und internen Kontrollsystemen. Der Deutsche Corporate Governance Kodex wird als Vergleichsgröße herangezogen. Die Kosten-Nutzen-Relation wird anhand von Literaturanalysen und einer eigenen empirischen Untersuchung analysiert.
Welche Methodik wurde verwendet?
Die Arbeit kombiniert Literaturrecherche mit einer eigenen empirischen Untersuchung. Die Literaturanalyse umfasst verschiedene Studien zum SOA und seinen Auswirkungen. Die empirische Untersuchung besteht aus einer Befragung deutscher Unternehmen, die Informationen zur Umsetzung des SOA, den damit verbundenen Kosten und dem wahrgenommenen Nutzen liefert.
Welche Aspekte des Sarbanes-Oxley Act werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit betrachtet detailliert die Section 301 (Einrichtung eines Audit Committee), Section 302 (Disclosure Controls and Procedures) und Section 404 (Internes Kontrollsystem der Finanzberichterstattung). Es wird jeweils ein Vergleich mit dem deutschen Recht gezogen und die Herausforderungen der Umsetzung im deutschen Kontext beleuchtet.
Wie wird der Deutsche Corporate Governance Kodex in die Arbeit einbezogen?
Der Deutsche Corporate Governance Kodex dient als Vergleichsmaßstab, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum SOA aufzuzeigen und die Herausforderungen der Harmonisierung von US-amerikanischem und deutschem Recht zu diskutieren.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die empirische Untersuchung liefert Einblicke in die Praxis der SOA-Umsetzung in deutschen Unternehmen und die Wahrnehmung der Kosten und des Nutzens durch die befragten Unternehmen. Die Ergebnisse der Befragung werden im Detail im Kapitel 4.2.6 dargestellt.
Welche Kosten und Nutzen des SOA werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Kosten der Implementierung des SOA (z.B. Beratungsaufwand, Anpassung von Prozessen) und die potenziellen Nutzen (z.B. verbesserte Finanzberichterstattung, gesteigerte Transparenz, reduziertes Risiko). Die Kosten-Nutzen-Relation wird sowohl anhand von Literaturstudien als auch der eigenen Befragung untersucht.
Welche Fallbeispiele werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet die Fallbeispiele Enron und Worldcom, um den Hintergrund und die Notwendigkeit des Sarbanes-Oxley Act zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind der Sarbanes-Oxley Act, Corporate Governance, interne Kontrollsysteme, Audit Committees, Compliance Management, Risikomanagement, Kosten-Nutzen-Analyse, der Vergleich zwischen US-amerikanischem und deutschem Recht, und der Einfluss des SOA auf deutsche Unternehmen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Corporate Governance und der Umsetzung des SOA in deutschen Unternehmen. Konkrete Schlussfolgerungen werden im Kapitel 5 erläutert.
- Quote paper
- Janina Neumann (Author), 2006, Sarbanes-Oxley Act. Auswirkungen auf deutsche Wirtschaftsunternehmen., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66855