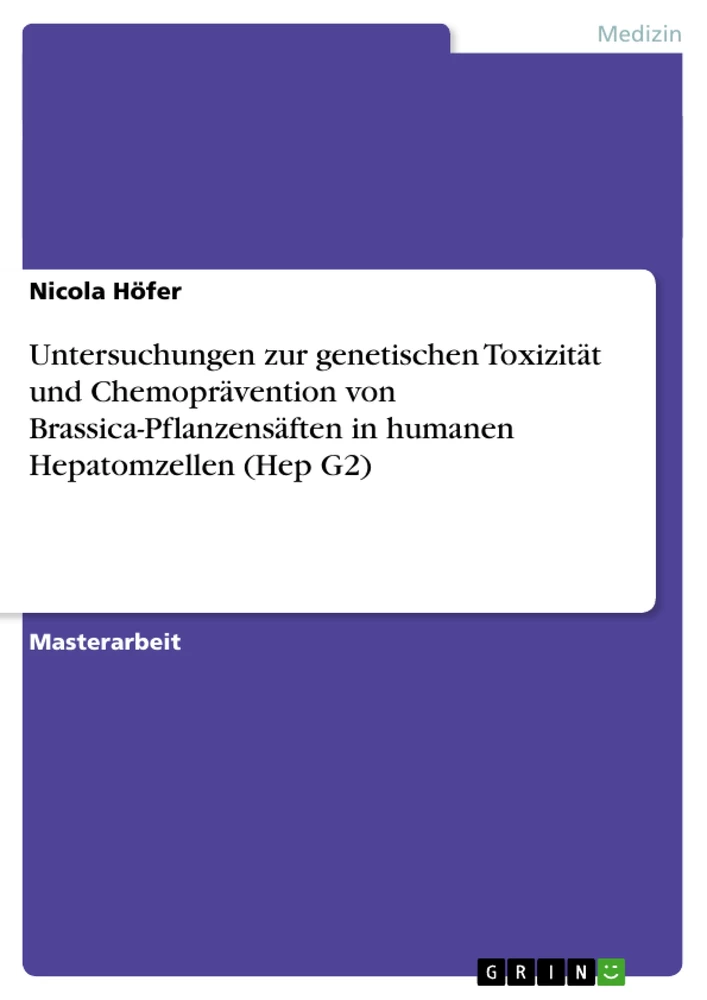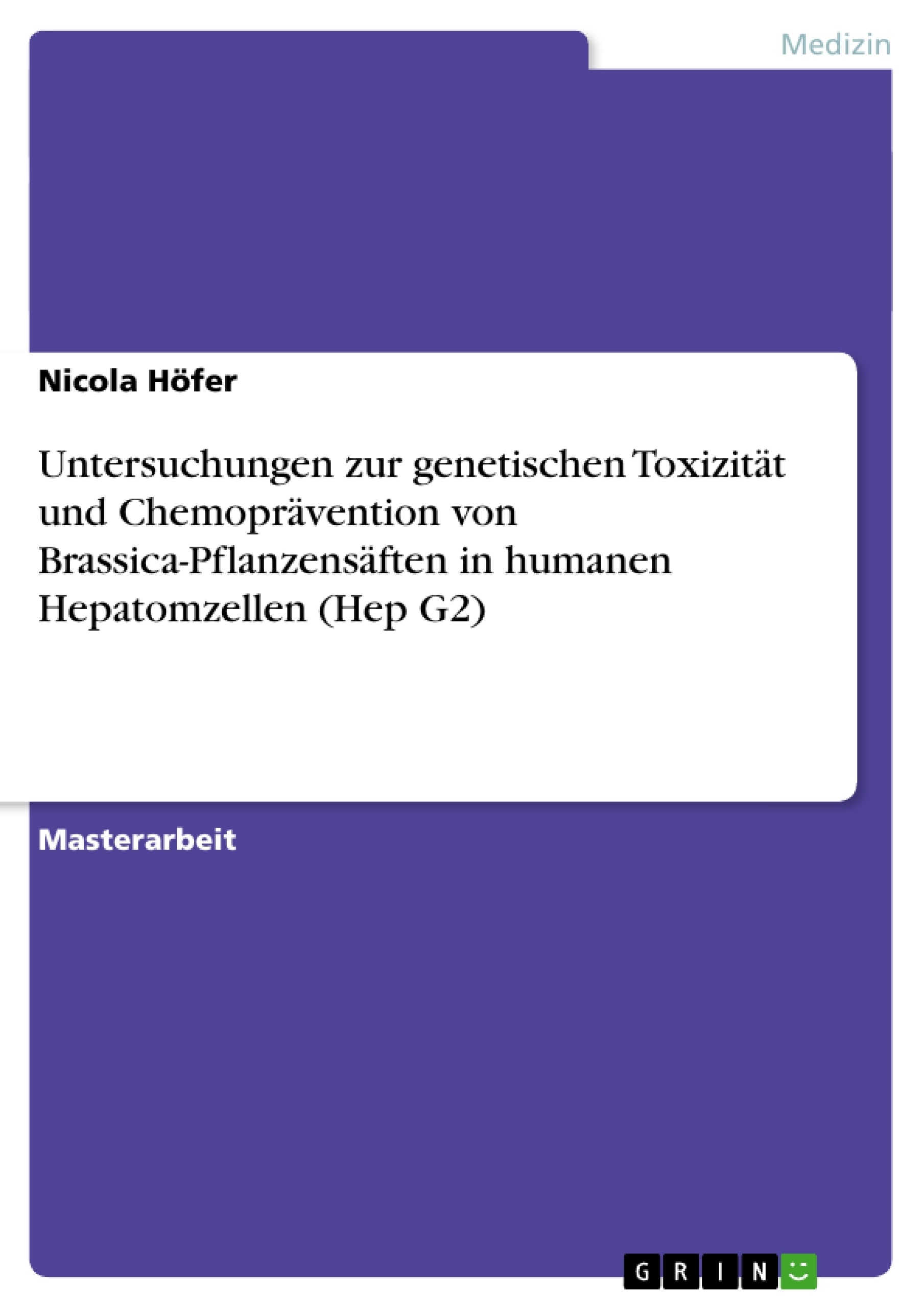Jährlich erkranken in Deutschland etwa 395 000 Menschen an Krebs, davon versterben 210 000 Patienten an den Folgen ihrer Krebserkrankung (BERTZ et al. 2004). Maligne Neubildungen stellen dabei sowohl für Männer als auch Frauen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache dar (DIFE 1999). Neben genetischen Determinanten spielen exogene Faktoren, darunter vor allem Ernährungsfaktoren, eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer Krebserkrankung. Nach derzeitigen Schätzungen gehen Mediziner davon aus, dass etwa 30-35% aller Krebserkrankungen in der westlichen Welt durch Ernährungsfaktoren verursacht werden (KROKE und BOEING 2000). Es wird geschätzt, dass die Zahl der Krebsfälle mittels einer Ernährungsumstellung hin zu einer gesunden Ernährung, verbunden mit körperlicher Bewegung und dem Vermeiden von Übergewicht, um 30 bis 40 % vermindert werden könnte (WCRF 1997). Dies würde für Deutschland jährlich 120 000 bis 158 000 Krebsfälle weniger bedeuten.
Nach heutigem Kenntnisstand scheint ein hoher Verzehr von Obst und Gemüse eine protektive Rolle in der Ätiologie verschiedener Krebserkrankungen zu spielen (STEINMETZ und POTTER 1996, BLOCK et al. 1992, KOLONEL et al. 2000). Spezielle bioaktive Substanzen, wie sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, scheinen der Grund für die chemoprotektiven Effekte zu sein (STEINMETZ und POTTER 1996). Zu den wichtigsten sekundären Pflanzenstoffen gehören die Glucosinolate. Diese sind vorwiegend in Pflanzen der FamilieBrassicaceae(syn.Cruciferae,dt. Kreuzblütler) zu finden (VERKERK et al. 1998). Dazu gehören Raps, Senf, Kresse, einzelne Rübenarten sowie Kohlgemüse(Brassica oleracea).Glucosinolate werden beim Kauen und Zerschneiden des Gemüses durch eine pflanzen-spezifische Myrosinase zu Isothiocyanaten (ITCs) metabolisiert. Auch ein intestinaler Abbau von Glucosinolaten zu Isothiocyanaten ist möglich (FAHEY 2001). Epidemiologische und experimentelle Daten liefern Hinweise, dassBrassicaceaeund Isothiocyanate für eine Inhibition der Kanzerogenese verantwortlich gemacht werden können (VERHOEVEN et al. 1996; 1997, VAN POPPEL et al. 1999). Dabei scheinen die chemoprotektiven Effekte hauptsächlich auf einer Modulation fremdstoff-metabolisierender Enzyme zu beruhen (VERHOEVEN et al. 1997, CONAWAY et al. 2002, ZHANG 2004).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Material und Methoden
- 2.1 Materialien
- 2.1.1 Chemikalien und Reagenzien
- 2.1.2 Lösungen
- 2.1.3 Verbrauchsmaterialien und Geräte
- 2.1.4 Benzo[a]pyren: Mutagen und Referenzkontrolle
- 2.1.5 Probenvorbereitung des Pflanzenmaterials
- 2.2 Methoden
- 2.2.1 Charakteristische Merkmale der HepG2-Zelllinie
- 2.2.2 Kultivierung und Behandlungsmethoden der Zellkulturen
- 2.2.3 Alkalische Einzelzellgelelektrophorese (Cometassay)
- 2.2.4 Gaschromatographie und Massenspektrometrie
- 2.1 Materialien
- 3 Ergebnisse
- 3.1 Gentoxische Effekte von Brassica
- 3.2 Antigentoxische Effekte von Brassica
- 3.3 Gen- und antigentoxische Effekte: Zusammenfassende Betrachtung
- 3.4 Qualitative und quantitative Analyse von Isothiocyanaten
- 3.4.1 Anteil der Trockensubstanz
- 3.4.2 ITC-Konzentrationen in der Trockensubstanz
- 3.4.3 ITC-Konzentrationen im Pflanzensaft
- 4 Diskussion
- 4.1 Isothiocyanate in Brassicaceae
- 4.2 Gentoxizität von Brassicaceae und Inhaltsstoffen
- 4.2.1 Gentoxische Effekte von Isothiocyanaten
- 4.2.2 Gentoxische Wirkmechanismen von Isothiocyanaten
- 4.2.3 Gentoxizität von Brassicaceae
- 4.2.4 Untersuchungsergebnisse zur Gentoxizität von Brassicaceae versus bisherige Studienergebnisse
- 4.3 Antigentoxizität von Brassicaceae und Inhaltsstoffen
- 4.3.1 Chemoprotektive Wirkmechanismen von Isothiocyanaten
- 4.3.2 Antigentoxizität von Brassicaceae
- 4.3.3 Bisherige Untersuchungen zur Antigentoxizität von Brassicaceae-Pflanzensäften
- 4.3.4 Nachweis der krebs-präventiven Aktivität von Brassicaceae und Isothiocyanaten im Tierversuch und in epidemiologischen Studien
- 4.3.5 Pflanzensaft-Aufnahme des Menschen
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die genotoxischen und antigenotoxischen Effekte von Brassica-Säften in humanen Hepatomzellen (HepG2). Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Säfte auf die DNA-Schädigung und deren potenzielles chemopräventives Potential zu erforschen.
- Genotoxische Effekte von Brassica-Säften
- Antigenotoxische Effekte von Brassica-Säften
- Wirkmechanismen von Isothiocyanaten
- Quantitative Analyse von Isothiocyanaten in verschiedenen Brassica-Arten
- Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Studien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den wissenschaftlichen Hintergrund der Untersuchung der genotoxischen und antigenotoxischen Effekte von Brassica-Säften. Sie erläutert die Bedeutung von Isothiocyanaten und deren Rolle in der Chemoprävention. Die Einleitung legt den Fokus auf die Forschungslücke und die Notwendigkeit der vorliegenden Studie.
2 Material und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die verwendeten Materialien, Chemikalien, Reagenzien, Geräte und Methoden. Es werden die Charakteristika der HepG2-Zelllinie erläutert und die Vorgehensweise bei der Probenvorbereitung, Zellkultivierung, Behandlung und den verwendeten Analysemethoden (Comet Assay, Gaschromatographie-Massenspektrometrie) ausführlich dargestellt. Die Beschreibung der Methoden ist präzise und ermöglicht die Reproduzierbarkeit der Studie.
3 Ergebnisse: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Experimente. Es werden die genotoxischen und antigenotoxischen Effekte verschiedener Brassica-Säfte auf die HepG2-Zellen detailliert beschrieben und graphisch dargestellt. Die quantitative Analyse der Isothiocyanat-Konzentrationen in den verschiedenen Brassica-Proben wird ebenfalls vorgestellt und interpretiert. Die Ergebnisse werden systematisch und übersichtlich präsentiert.
4 Diskussion: Die Diskussion analysiert die im vorherigen Kapitel präsentierten Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstandes. Es werden die gefundenen genotoxischen und antigenotoxischen Effekte von Brassica-Säften im Detail diskutiert und mit den bekannten Wirkmechanismen von Isothiocyanaten in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse werden mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen und mögliche Erklärungen für die beobachteten Effekte werden erörtert. Die Diskussion befasst sich auch mit den Limitationen der Studie und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Brassicaceae, Isothiocyanate, Gentoxizität, Antigentoxizität, Chemoprävention, HepG2-Zellen, Comet Assay, Gaschromatographie-Massenspektrometrie, DNA-Schädigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Genotoxische und Antigenotoxische Effekte von Brassica-Säften
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die genotoxischen und antigenotoxischen Effekte von Brassica-Säften auf humane Hepatomzellen (HepG2). Im Fokus steht die Erforschung der Auswirkungen dieser Säfte auf die DNA-Schädigung und ihr potenzielles chemopräventives Potential.
Welche Brassica-Arten wurden untersucht?
Die Arbeit spezifiziert nicht die genauen Brassica-Arten, sondern bezieht sich allgemein auf "Brassica-Säfte". Die quantitative Analyse der Isothiocyanat-Konzentrationen erfolgte jedoch an verschiedenen Brassica-Proben.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendete den Comet Assay (alkalische Einzelzellgelelektrophorese) zur Bestimmung der DNA-Schädigung und die Gaschromatographie-Massenspektrometrie zur quantitativen Analyse der Isothiocyanate. Die HepG2-Zelllinie wurde zur Untersuchung der zellulären Effekte eingesetzt. Die Probenvorbereitung und Zellkultivierung werden detailliert im Methodenkapitel beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse präsentieren detaillierte Daten zu den genotoxischen und antigenotoxischen Effekten verschiedener Brassica-Säfte auf die HepG2-Zellen. Diese Daten wurden graphisch dargestellt. Zusätzlich wird die quantitative Analyse der Isothiocyanat-Konzentrationen in den verschiedenen Brassica-Proben vorgestellt und interpretiert.
Welche Isothiocyanate wurden analysiert?
Die Arbeit nennt zwar Isothiocyanate als wichtige Inhaltsstoffe der Brassica-Säfte, die genauen Arten der analysierten Isothiocyanate werden jedoch nicht explizit benannt.
Wie wurden die Isothiocyanat-Konzentrationen bestimmt?
Die Isothiocyanat-Konzentrationen wurden mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) in der Trockensubstanz, im Pflanzensaft und im Anteil der Trockensubstanz quantifiziert.
Welche Schlussfolgerungen wurden gezogen?
Die Diskussion analysiert die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstandes. Sie behandelt die gefundenen genotoxischen und antigenotoxischen Effekte, verbindet diese mit den bekannten Wirkmechanismen der Isothiocyanate und vergleicht die Ergebnisse mit anderen Studien. Die Diskussion beleuchtet auch Limitationen der Studie und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Brassicaceae, Isothiocyanate, Gentoxizität, Antigentoxizität, Chemoprävention, HepG2-Zellen, Comet Assay, Gaschromatographie-Massenspektrometrie, DNA-Schädigung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Methoden?
Detaillierte Informationen zu den verwendeten Materialien, Chemikalien, Reagenzien, Geräten und Methoden befinden sich im Kapitel "Material und Methoden". Die Beschreibung der Methoden ist präzise und soll die Reproduzierbarkeit der Studie ermöglichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis und in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Nicola Höfer (Author), 2005, Untersuchungen zur genetischen Toxizität und Chemoprävention von Brassica-Pflanzensäften in humanen Hepatomzellen (Hep G2), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66820