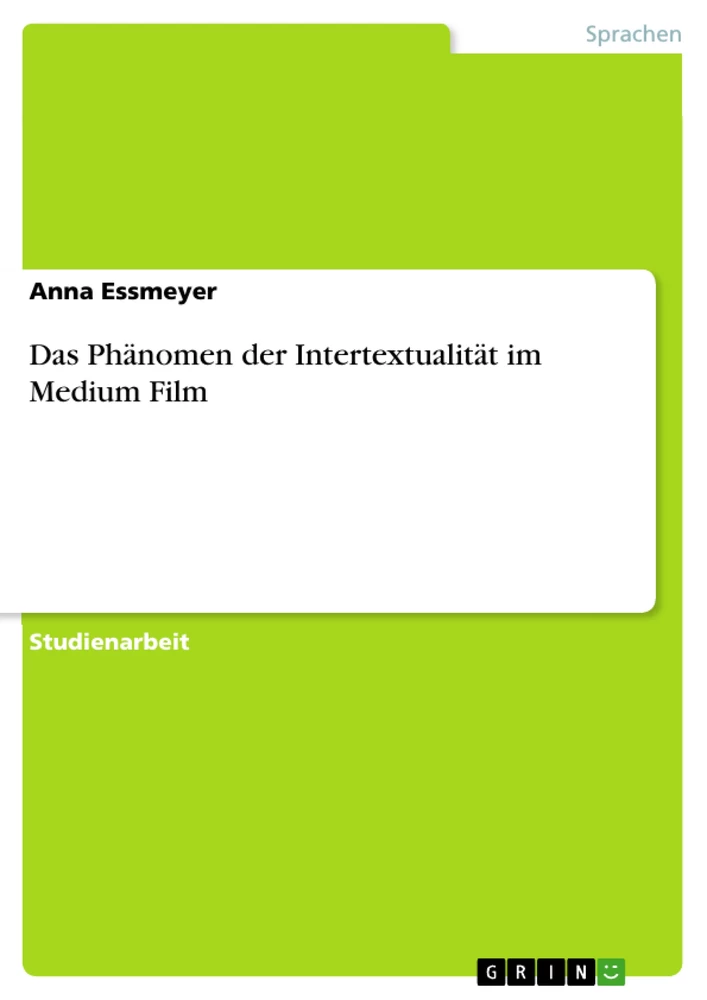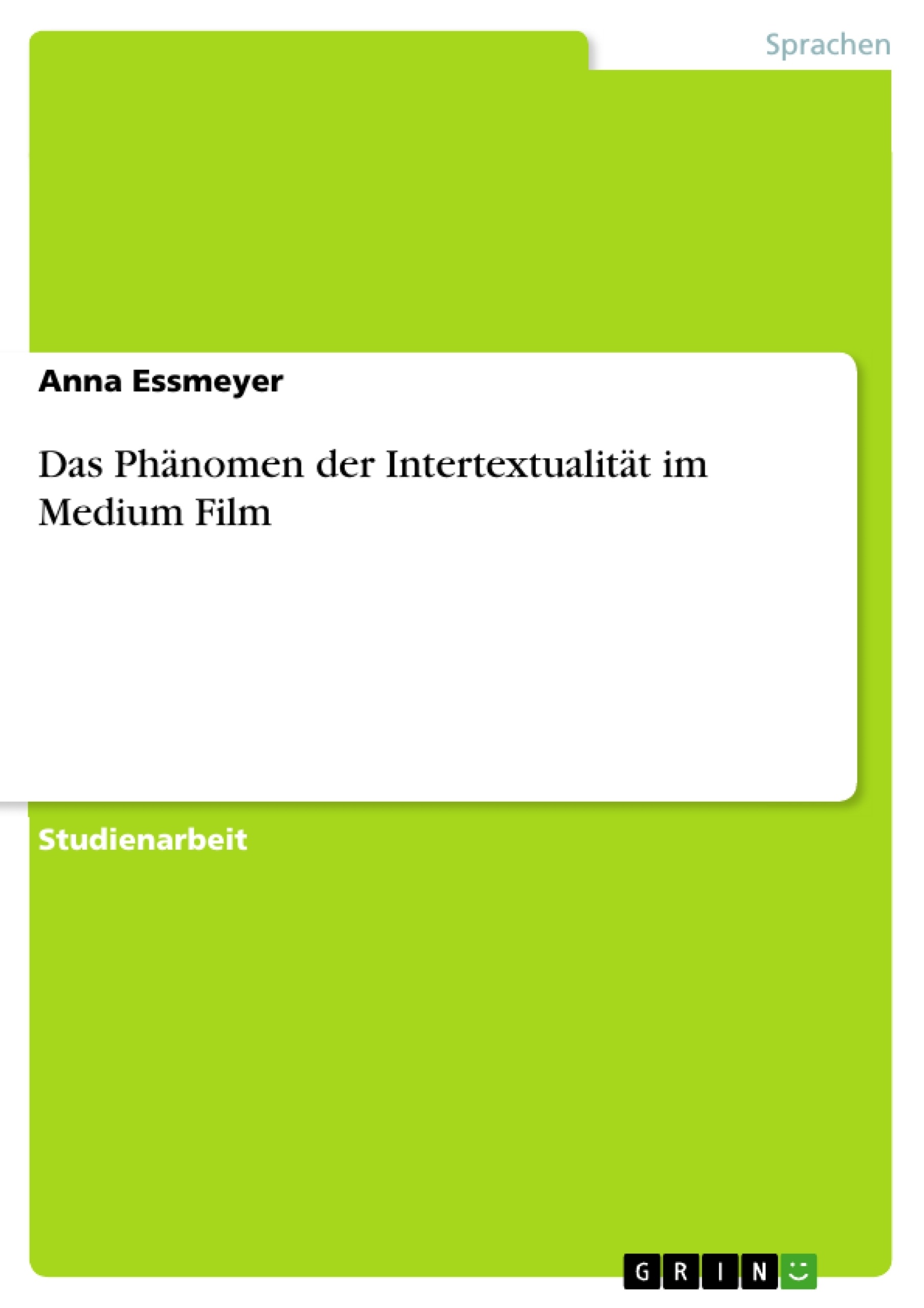In einem Zeitalter zunehmender Intermedialität in allen Lebensbereichen kommt es zu einer immer engeren Verknüpfung der Medien untereinander. Im gleichen Maße lässt sich in der Medienlandschaft eine wechselseitige Abhängigkeit bezüglich Inhalt und Form feststellen. Dies rührt unter anderem daher, dass es nur eine beschränkte Auswahl an übergeordneten Themengebieten gibt, deren Vielfältigkeit lediglich durch Variationen und Mischung erweitert werden kann. Zusätzlich sind Medien und Werke stets von ihrem Zeitgeist, d.h. Trends, aktuellen Lebenseinstellungen und gesellschaftlichen Grundstimmungen geprägt, was zudem eine formale und inhaltliche Ü-berschneidung - mindestens innerhalb eines Kulturkreises - noch begünstigt. Mögliche Unterschiede im zu Grunde liegenden Zeitgeist werden durch eine zunehmende Globalisierung stetig minimalisiert.
Überschneidungen zwischen verschiedenen Medien und Werken eines Mediums rühren jedoch nicht nur von kulturellen Einflüssen her, sie können auch als dramaturgisches Mittel eingesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Vorwort
- 1.2 Gliederung und Vorgehensweise
- 2. Der Begriff der Intertextualität
- 2.1 Formen und Definitionen
- 2.2 Intentionen für die Anwendung von Intertextualität
- 2.3 Die Rolle des Rezipienten in der Thematik Intertextualität
- 3. Spezifika der Intertextualität beim Film
- 4. Praktische Anwendung
- 4.1 Scream - Der Schrei
- 4.2 Matrix
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Phänomen der Intertextualität im Medium Film. Ziel ist es, den Begriff der Intertextualität aus der Literaturwissenschaft auf den Film zu übertragen und dabei Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Theorie und Anwendung herauszuarbeiten. Die Arbeit beleuchtet die Übertragbarkeit des Konzepts und analysiert die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Intertextualität im filmischen Kontext.
- Definition und Formen der Intertextualität
- Intentionen und Anwendung von Intertextualität in Film und Literatur
- Die Rolle des Rezipienten bei der Interpretation intertextueller Bezüge
- Spezifika der Intertextualität im Medium Film
- Praktische Anwendung der Theorie anhand von Filmbeispielen ("Scream" und "Matrix")
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Intertextualität ein und beschreibt die zunehmende Verknüpfung von Medien im Kontext der Intermedialität. Sie erläutert, wie Überschneidungen zwischen Medien sowohl durch kulturelle Einflüsse als auch durch dramaturgische Mittel entstehen. Die Arbeit skizziert ihr Vorgehen, welches die Übertragung des Intertextualitätsbegriffs von der Literatur auf den Film zum Ziel hat.
2. Der Begriff der Intertextualität: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Intertextualität anhand verschiedener Definitionen und Ansätze. Es werden die Arbeiten von Bachtin und Kristeva diskutiert, wobei die poststrukturalistische Perspektive von Kristeva im Vordergrund steht. Der Fokus liegt auf der Vorstellung, dass Texte nicht isoliert, sondern im Kontext ihrer Prätexte interpretiert werden müssen. Das Kapitel untersucht verschiedene Formen und Intentionen der Intertextualität und analysiert die Rolle des Rezipienten in diesem Prozess.
3. Spezifika der Intertextualität beim Film: Dieses Kapitel untersucht die Besonderheiten der Intertextualität im Medium Film. Es analysiert, wie filmische Mittel wie Kameraführung, Montage, Musik und Sounddesign genutzt werden können, um intertextuelle Bezüge zu schaffen und zu verstärken. Das Kapitel stellt dabei den Film als ein komplexes Medium dar, welches durch seine multisensorische Natur besondere Möglichkeiten für die Etablierung intertextueller Beziehungen bietet und beleuchtet gleichzeitig die Abgrenzung zu anderen Medien.
Schlüsselwörter
Intertextualität, Film, Literatur, Medienwissenschaft, Narratologie, Semiologie, Rezeption, Interpretation, Filmtheorie, "Scream", "Matrix", Prätexte, poststrukturalistisch.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Intertextualität im Film
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Phänomen der Intertextualität im Medium Film. Sie untersucht den Begriff der Intertextualität aus der Literaturwissenschaft und überträgt ihn auf den Film, wobei Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Theorie und Anwendung herausgearbeitet werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Übertragbarkeit des Konzepts und den spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Intertextualität im filmischen Kontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Formen der Intertextualität, Intentionen und Anwendung von Intertextualität in Film und Literatur, die Rolle des Rezipienten bei der Interpretation intertextueller Bezüge, Spezifika der Intertextualität im Medium Film und die praktische Anwendung der Theorie anhand von Filmbeispielen ("Scream" und "Matrix").
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit diskutiert die Arbeiten von Bachtin und Kristeva, wobei die poststrukturalistische Perspektive von Kristeva im Vordergrund steht. Der Fokus liegt auf der Vorstellung, dass Texte nicht isoliert, sondern im Kontext ihrer Prätexte interpretiert werden müssen.
Wie wird die Intertextualität im Film analysiert?
Die Arbeit analysiert, wie filmische Mittel wie Kameraführung, Montage, Musik und Sounddesign genutzt werden, um intertextuelle Bezüge zu schaffen und zu verstärken. Der Film wird als komplexes, multisensorisches Medium betrachtet, das besondere Möglichkeiten für die Etablierung intertextueller Beziehungen bietet.
Welche Filmbeispiele werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Intertextualität anhand der Filme "Scream" und "Matrix".
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Intertextualität, Film, Literatur, Medienwissenschaft, Narratologie, Semiologie, Rezeption, Interpretation, Filmtheorie, Prätexte, poststrukturalistisch.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff der Intertextualität, ein Kapitel zu den Spezifiken der Intertextualität im Film, ein Kapitel zur praktischen Anwendung anhand von Filmbeispielen und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt das Vorgehen und die Zielsetzung der Arbeit. Die Kapitelüberschriften geben einen detaillierten Überblick über den Inhalt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im bereitgestellten Text enthalten. Es wird jedoch erwartet, dass das Fazit die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und Schlussfolgerungen bezüglich der Intertextualität im Film zieht.)
- Quote paper
- Anna Essmeyer (Author), 2004, Das Phänomen der Intertextualität im Medium Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66780