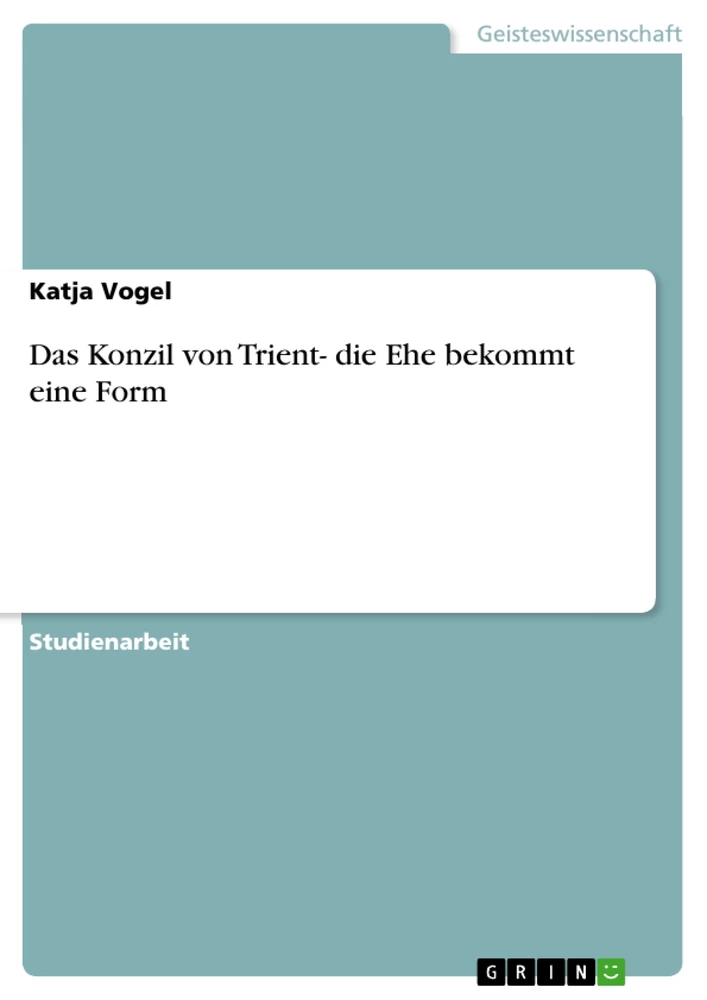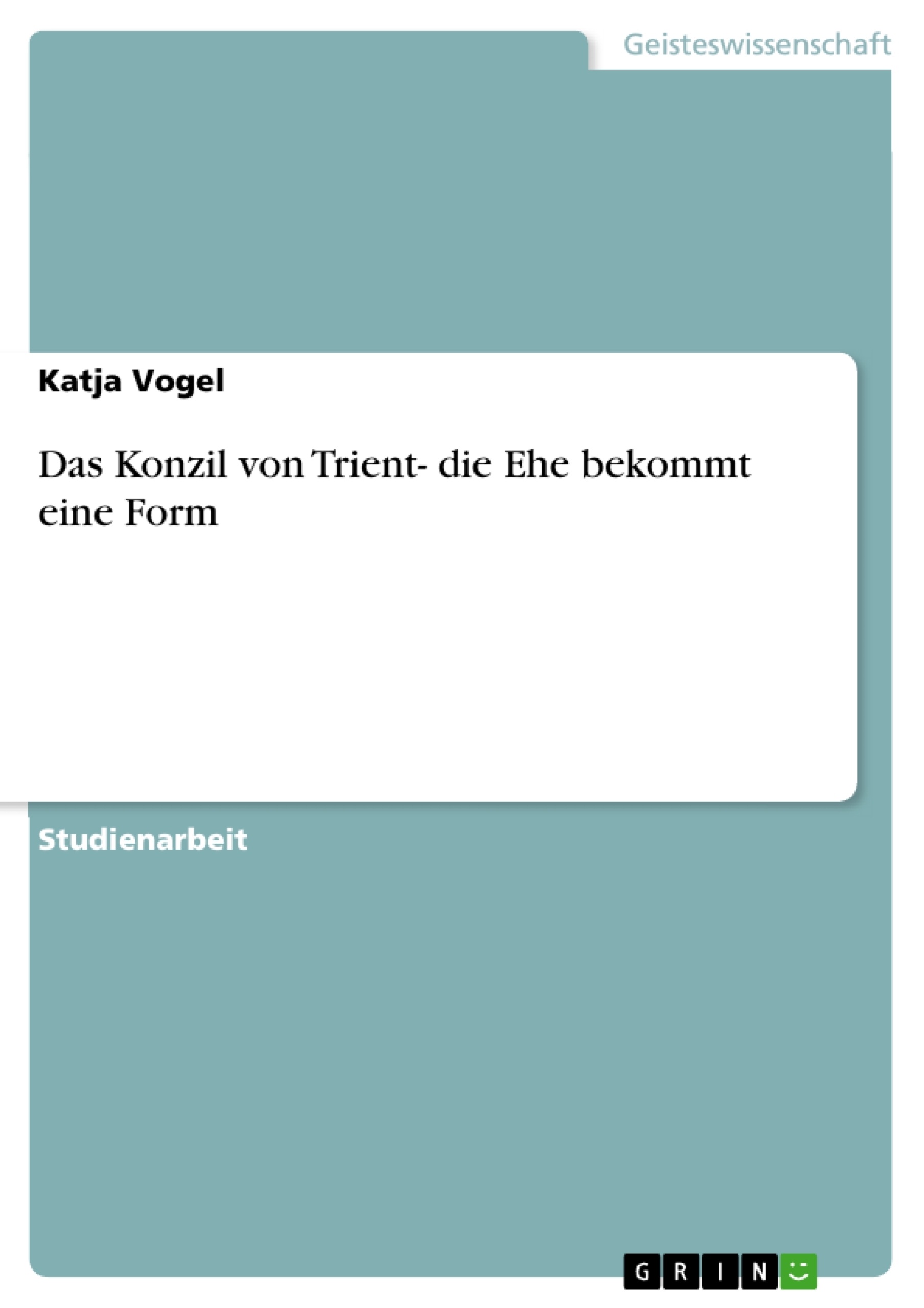Die römisch- katholische Kirche kennt insgesamt 21 allgemeine bzw. ökumenische Konzilien. Man bezeichnet sie so, da diese Konzilien alle Teilkirchen und Mitglieder der katholischen Gemeinschaften auf der ganzen Welt betreffen und von ihnen anerkannt werden. Das Konzil von Trient, im Sprachgebrauch auch Tridentinum genannt, zählt neben dem ersten und zweiten vatikanischen Konzil zu den Konzilien des Katholizismus. Es ist das 19. ökumenische Konzil und fand aufgeteilt in drei Sitzungsperioden in einem Zeitraum von 18 Jahren statt. Religionsgeschichtlich leitete das Konzil von Trient die Gegenreformation ein und veränderte den Katholizismus so sehr, dass man die Zeit zwischen dem Konzil von Trient und dem zweiten vatikanischen Konzil nachtridentinische Zeit nennt.
Das Trienter Konzil fand in einer schwierigen politischen und religiösen Zeit statt. Man bezeichnet diese Epoche als das Zeitalter der Gegenreformation. Sie wird auf etwa hundert Jahre datiert, beginnend in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Ganz geglückt ist die Bezeichnung Gegenreformation nicht, denn dieses Zeitalter war ebenso geprägt vom Calvinismus, den geistigen Leistungen von Wissenschaftlern wie Galilei und Keppler sowie einem Höhepunkt der Kultur (deutsche Renaissance). Außer Frage steht aber sicher, dass die Gegenreformation als historischer Vorgang das Jahrhundert tief beeinflusst hat.
Die vorliegende Hausarbeit zeigt die historische Entwicklung des Trienter Konzils und behandelt die teilweise sehr unterschiedlichen Entwicklungen des Eheverständnis der Reformatoren und die des Katholizismus, die sich aus den Entscheidungen der Konzilsväter in Trient entwickelt haben. Am Ende der Hausarbeit soll ein kleiner Ausblick stehen, in dem untersucht wird, ob die Entscheidungen über eine Formvorschrift der Ehe, wie es im Trienter Konzil geschehen ist, eine Veränderung für die Stellung bzw. Rolle der Frau in der Ehe bzw. der Gesellschaft bedeuten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Konzil von Trient
- 1. Der schwierige Anfang des Konzils- eine historische Entwicklung
- 2. Informationen und Organisatorisches rund um das Trienter Konzil
- 3. Die erste Konzilsperiode von 1545- 1547
- 4. Die zweite Konzilsperiode
- 5. Die dritte Konzilsperiode (1562-1563)
- III. Die Ehe- zwei verschiedene Verständnisse
- 1. Das Eheverständnis der Reformatoren um Martin Luther
- 2. Die katholische Antwort auf das Eheverständnis der Reformatoren- Entscheidungen über die Ehe auf dem Konzil von Trient
- IV. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Konzils von Trient und analysiert die unterschiedlichen Auffassungen vom Eheverständnis zwischen den Reformatoren und der katholischen Kirche, wie sie sich aus den Entscheidungen des Konzils ergaben. Ein Ausblick beleuchtet die Frage, ob die formalen Bestimmungen der Ehe durch das Konzil die Stellung der Frau in Ehe und Gesellschaft beeinflusst haben.
- Die historische Entwicklung des Konzils von Trient
- Das Eheverständnis der Reformatoren
- Die katholische Antwort auf die reformatorischen Ehevorstellungen
- Die Entscheidungen des Konzils von Trient bezüglich der Ehe
- Der Einfluss der Konzilsentscheidungen auf die Rolle der Frau
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Konzils von Trient ein und beschreibt dessen Bedeutung als 19. ökumenisches Konzil im Katholizismus. Es wird der Kontext der Gegenreformation erläutert und die Zielsetzung der Arbeit dargelegt: die Darstellung der historischen Entwicklung des Konzils und der unterschiedlichen Auffassungen zum Eheverständnis zwischen Reformatoren und katholischer Kirche, sowie der Ausblick auf den Einfluss der Konzilsentscheidungen auf die Rolle der Frau.
II. Das Konzil von Trient: Dieses Kapitel beleuchtet den schwierigen und langwierigen Prozess der Einberufung des Konzils, geprägt von politischen und religiösen Konflikten des 16. Jahrhunderts. Es beschreibt die anfänglichen Schwierigkeiten, die durch den gescheiterten Konziliarismus und das Zögern des Papstes entstanden. Die Arbeit veranschaulicht die Bemühungen von Kaiser Karl V. und die unterschiedlichen Positionen von Frankreich und dem Papsttum. Die Beschreibung der schwierigen Verhandlungen und der letztlichen Einberufung des Konzils in Trient unterstreicht die Bedeutung des Ereignisses für die katholische Kirche.
III. Die Ehe- zwei verschiedene Verständnisse: Dieses Kapitel vergleicht das Eheverständnis der Reformatoren um Martin Luther mit der katholischen Sichtweise. Es analysiert die reformatorischen Ansätze und die darauf folgende katholische Reaktion, die zu den Entscheidungen des Konzils von Trient bezüglich der Ehe führte. Die Gegenüberstellung der beiden Positionen verdeutlicht die tiefgreifenden theologischen und gesellschaftlichen Unterschiede.
Schlüsselwörter
Konzil von Trient, Gegenreformation, Eheverständnis, Reformatoren, Martin Luther, Katholische Kirche, Konziliarismus, Rolle der Frau, kirchliche Reform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Das Konzil von Trient und das Eheverständnis
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht die historische Entwicklung des Konzils von Trient und analysiert die unterschiedlichen Auffassungen zum Eheverständnis zwischen den Reformatoren und der katholischen Kirche, wie sie sich in den Konzilsentscheidungen niederschlagen. Ein Ausblick beleuchtet den Einfluss dieser Entscheidungen auf die Stellung der Frau in Ehe und Gesellschaft.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind: die historische Entwicklung des Konzils von Trient, das Eheverständnis der Reformatoren (insbesondere Martin Luthers), die katholische Antwort auf die reformatorischen Ehevorstellungen, die konkreten Entscheidungen des Konzils von Trient zur Ehe und der Einfluss dieser Entscheidungen auf die Rolle der Frau in Ehe und Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: I. Einleitung: Einführung in das Thema und die Zielsetzung der Arbeit. II. Das Konzil von Trient: Detaillierte Darstellung der historischen Entwicklung des Konzils, einschließlich der Schwierigkeiten bei der Einberufung und der verschiedenen Sitzungsperioden. III. Die Ehe - zwei verschiedene Verständnisse: Vergleich des Eheverständnisses der Reformatoren und der katholischen Kirche, Analyse der reformatorischen Ansätze und der katholischen Reaktion darauf, die zu den Entscheidungen des Konzils führte. IV. Ausblick: Diskussion des Einflusses der Konzilsentscheidungen auf die Rolle der Frau.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Konzil von Trient, Gegenreformation, Eheverständnis, Reformatoren, Martin Luther, Katholische Kirche, Konziliarismus, Rolle der Frau, kirchliche Reform.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, die historische Entwicklung des Konzils von Trient darzustellen und die unterschiedlichen Auffassungen zum Eheverständnis zwischen Reformatoren und katholischer Kirche zu analysieren. Er untersucht, wie sich diese Unterschiede in den Entscheidungen des Konzils niederschlugen und welchen Einfluss diese Entscheidungen auf die Rolle der Frau hatten.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text bietet eine umfassende Vorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Die Struktur ist klar und logisch aufgebaut, um die Informationen übersichtlich zu präsentieren.
- Citar trabajo
- Diplom- Theologin Katja Vogel (Autor), 2002, Das Konzil von Trient- die Ehe bekommt eine Form, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66739