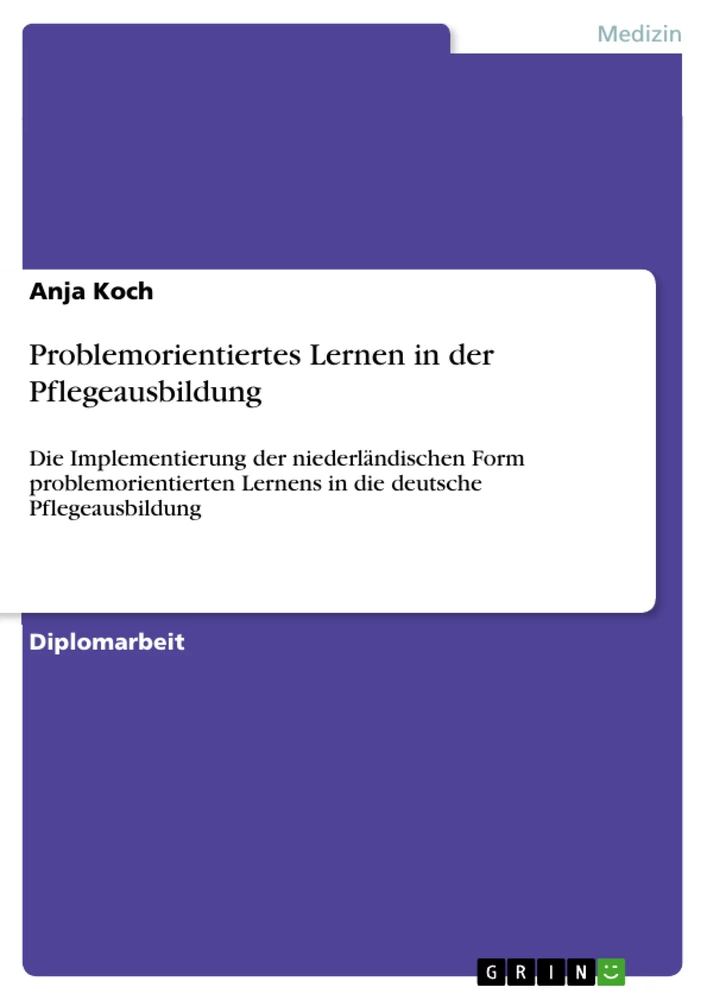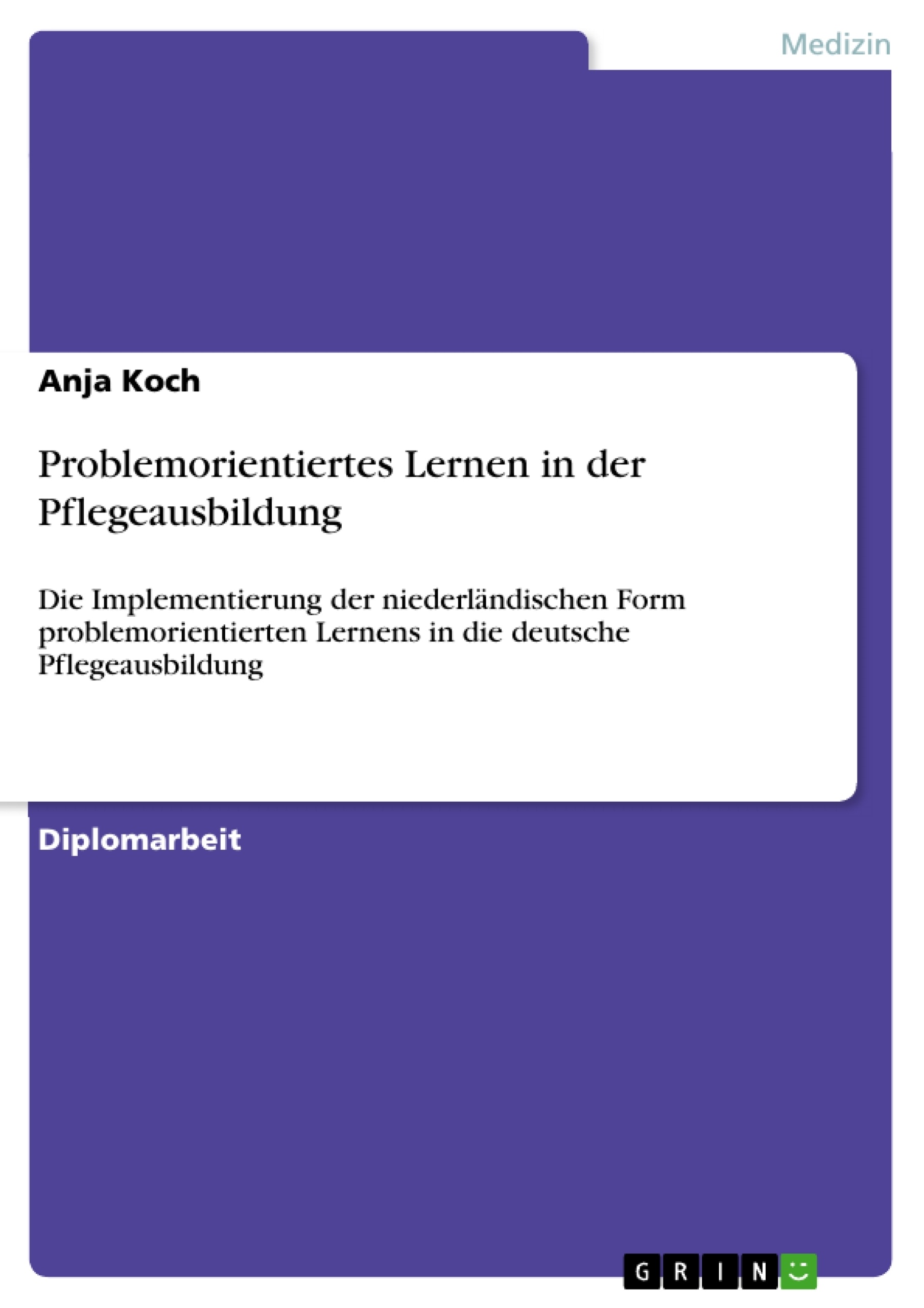Sieben Studenten sitzen in einem Kreis zusammen. Jeder hat offene Hefter und Bücher vor sich liegen. Sie befinden sich in einer lebhaften Diskussion. Mareike, eine der Studenten, meint: „Ich habe gelesen, dass die Beweglichkeit von Patienten mit Rheuma durch Schmerzen eingeschränkt ist.“ Sofort meldet sich Patrick zu Wort: „Nein, das kann nicht stimmen. Hier steht eindeutig, dass diese Patienten Verformungen und Kontrakturen der Gelenke haben und sich deshalb nicht bewegen können.“ Er greift nach einem Buch und blättert die Seite auf. „Ja, das stimmt, dass habe ich bei meinem letzten Einsatz in der Inneren gesehen, da hatte eine Patienten auch Rheuma und ihre Hände sahen so aus.“ Leen steht auf und verdreht ihre Hände. Alle Schüler fangen an zu lachen. Da greift eine Person in das Geschehen ein: „Was haben denn die anderen dazu herausgefunden?“ Die Diskussion geht in geregelter Form weiter.
Was machen Mareike, Patrick, Leen und die anderen da? Sie lernen Krankenpflege. Diese Situation konnte ich bei dem Besuch einer niederländischen Fachhochschule in Nijmegen beobachten. Hier findet der Unterricht nicht in traditioneller Form statt, wo der Lehrer das Wissen in Form eines Vortrages weitergibt, sondern hier erarbeiten sich die Studenten das komplette Wissen ihrer Ausbildung anhand von Problemaufgaben selbst. Diese Gestaltung des Unterrichts nennt sich problemorientiertes Lernen.
Mit dem Krankenpflegegesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung von 2003 wurde die Krankenpflegeausbildung in Deutschland neu geregelt. Die Theoriestunden wurden erhöht, die Unterrichtsfächer zu Themenbereichen umgestaltet, das Ausbildungsziel an die Förderung fachlicher, methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen ausgerichtet und eine stärkere Vernetzung von Theorie und Praxis gefordert. Darüber hinaus bekam der Beruf eine neue Bezeichnung.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Was ist problemorientiertes Lernen?
- 1.1 Definitionen
- 1.2 Merkmale
- 1.3 Ziele
- 1.4 Historische Entwicklung
- 1.5 Lerntheoretischer Hintergrund
- 1.6 Verschiedene Ansätze
- 2 Wie sieht die niederländische Form problemorientierten Lernens aus?
- 2.1 Die niederländische Krankenpflegeausbildung
- 2.2 Merkmale der niederländischen problemorientierten Lernform
- 2.2.1 Aufgabentypen
- 2.2.2 Der „Siebensprung“
- 2.2.3 Rolle der Studenten
- 2.2.4 Rolle des Tutors
- 2.3 Merkmale des Skillslab-Unterrichts
- 2.4 Die Studienlandschaft
- 3 Wie sehen die Ausgangsbedingungen zur Implementierung von POL in die deutschen Krankenpflegeschulen aus?
- 3.1 Rechtliche Ausgangsbedingungen
- 3.2 Curriculare Ausgangsbedingungen
- 3.3 Institutionelle Ausgangsbedingungen
- 3.4 Personelle Ausgangsbedingungen
- 4 Wie lässt sich problemorientiertes Lernen in deutsche Krankenpflegeschulen implementieren?
- 4.1 Implementierungsmodelle in Deutschland
- 4.2 Personelle Vorbereitungen
- 4.2.1 Lehrende
- 4.2.2 Lernende
- 4.3 Organisatorische Vorbereitungen
- 4.4 Planung von problemorientierten Unterrichtseinheiten
- 4.5 Durchführung der problemorientierten Unterrichtseinheiten
- 4.6 Auswertung der problemorientierten Unterrichtseinheiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Implementierung der niederländischen Form des problemorientierten Lernens (POL) in die deutsche Pflegeausbildung. Das Hauptziel ist es, die Machbarkeit und die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration von POL in den deutschen Kontext zu analysieren. Die Arbeit betrachtet dabei sowohl rechtliche und curriculare Rahmenbedingungen als auch institutionelle und personelle Aspekte.
- Problemorientiertes Lernen (POL) in der Pflegeausbildung
- Vergleich des niederländischen und deutschen Ausbildungssystems
- Rechtliche und curriculare Rahmenbedingungen für POL in Deutschland
- Institutionelle und personelle Voraussetzungen für die Implementierung von POL
- Planung und Durchführung problemorientierter Unterrichtseinheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt anhand eines Beispiels aus einer niederländischen Fachhochschule das problemorientierte Lernen (POL) und erläutert die Motivation der Autorin, diese Lernform im deutschen Kontext zu untersuchen. Sie stellt die vier Leitfragen der Arbeit vor, die die Struktur der folgenden Kapitel bestimmen.
1 Was ist problemorientiertes Lernen?: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen des POL dar. Es definiert den Begriff „Problem“ und differenziert verschiedene Problemtypen. Es werden die Merkmale von POL – Problem, Kleingruppe, Tutor und Lernressourcen – erläutert, sowie die Ziele des POL, wie der Erwerb von Schlüsselqualifikationen und die Förderung selbstgesteuerten Lernens, diskutiert. Schließlich beleuchtet das Kapitel den lerntheoretischen Hintergrund (gemäßigter Konstruktivismus) und stellt verschiedene Ansätze des POL vor.
2 Wie sieht die niederländische Form problemorientierten Lernens aus?: Dieses Kapitel präsentiert das niederländische Modell des POL, das als Grundlage für die Implementierung in Deutschland dient. Es beschreibt die niederländische Krankenpflegeausbildung mit ihren verschiedenen Qualifikationsniveaus und das „Maastrichter Unterrichtsmodell“, bestehend aus problemorientiertem Unterricht, Skillslab und Studienlandschaft. Es werden die verschiedenen Aufgabentypen im problemorientierten Unterricht detailliert erklärt, der „Siebensprung“ als Problemlösungsmethode vorgestellt und die Rollen von Studenten und Tutoren beschrieben. Abschließend werden die Merkmale des Skillslab-Unterrichts und die Studienlandschaft erläutert.
3 Wie sehen die Ausgangsbedingungen zur Implementierung von POL in die deutschen Krankenpflegeschulen aus?: Dieses Kapitel analysiert die Ausgangsbedingungen in Deutschland für die Implementierung von POL. Es untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen (Krankenpflegegesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung), die curricularen Bedingungen (Rahmenlehrpläne und Kerncurricula), die institutionellen Bedingungen (räumliche und mediale Ausstattung von Krankenpflegeschulen) und die personellen Bedingungen (Lernvoraussetzungen der Schüler und Methodenkompetenz der Lehrenden).
4 Wie lässt sich problemorientiertes Lernen in deutsche Krankenpflegeschulen implementieren?: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Implementierungsmodelle von POL in deutschen Krankenpflegeschulen. Es analysiert die personellen Vorbereitungen (für Lehrende und Lernende) und die notwendigen organisatorischen Vorbereitungen (zeitliche, räumliche und materielle Bedingungen). Schließlich werden die Planung, Durchführung und Auswertung problemorientierter Unterrichtseinheiten detailliert erläutert, inklusive der Konstruktion von Problemaufgaben und der Gestaltung von Lernerfolgskontrollen.
Schlüsselwörter
Problemorientiertes Lernen (POL), Pflegeausbildung, Niederländisches Modell, Implementierung, Curriculum, Krankenpflegegesetz, Kompetenzentwicklung, Selbstgesteuertes Lernen, Kleingruppenarbeit, Skillslab, Studienlandschaft, Fächerintegration, Handlungskompetenz.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Implementierung problemorientierten Lernens in der deutschen Pflegeausbildung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Implementierung der niederländischen Form des problemorientierten Lernens (POL) in die deutsche Pflegeausbildung. Sie analysiert die Machbarkeit und notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration von POL im deutschen Kontext, unter Berücksichtigung rechtlicher, curricularer, institutioneller und personeller Aspekte.
Welche Hauptziele werden in der Arbeit verfolgt?
Das Hauptziel ist die Analyse der Machbarkeit und der notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration der niederländischen Form des problemorientierten Lernens in die deutsche Pflegeausbildung. Es werden die rechtlichen und curricularen Rahmenbedingungen, sowie die institutionellen und personellen Aspekte betrachtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt problemorientiertes Lernen (POL) in der Pflegeausbildung, einen Vergleich des niederländischen und deutschen Ausbildungssystems, die rechtlichen und curricularen Rahmenbedingungen für POL in Deutschland, die institutionellen und personellen Voraussetzungen für die Implementierung von POL, sowie die Planung und Durchführung problemorientierter Unterrichtseinheiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptkapitel: Kapitel 1 definiert problemorientiertes Lernen und dessen theoretischen Hintergrund. Kapitel 2 beschreibt das niederländische Modell des POL. Kapitel 3 analysiert die Ausgangsbedingungen in Deutschland für die Implementierung von POL. Kapitel 4 beschreibt verschiedene Implementierungsmodelle von POL in deutschen Krankenpflegeschulen, inklusive der Planung, Durchführung und Auswertung problemorientierter Unterrichtseinheiten.
Was wird unter problemorientiertem Lernen (POL) verstanden?
Die Arbeit definiert POL, erläutert seine Merkmale (Problem, Kleingruppe, Tutor, Lernressourcen) und Ziele (Erwerb von Schlüsselqualifikationen, Förderung selbstgesteuerten Lernens). Es werden verschiedene Ansätze des POL vorgestellt und der lerntheoretische Hintergrund (gemäßigter Konstruktivismus) beleuchtet.
Wie sieht das niederländische Modell des problemorientierten Lernens aus?
Die Arbeit beschreibt das niederländische Modell, das als Grundlage für die Implementierung in Deutschland dient. Es beinhaltet das „Maastrichter Unterrichtsmodell“ mit problemorientiertem Unterricht, Skillslab und Studienlandschaft. Es werden verschiedene Aufgabentypen, der „Siebensprung“ als Problemlösungsmethode, und die Rollen von Studenten und Tutoren detailliert erklärt.
Welche Ausgangsbedingungen in Deutschland werden für die Implementierung von POL analysiert?
Die Arbeit analysiert rechtliche (Krankenpflegegesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung), curriculare (Rahmenlehrpläne, Kerncurricula), institutionelle (räumliche und mediale Ausstattung) und personelle Bedingungen (Lernvoraussetzungen der Schüler und Methodenkompetenz der Lehrenden) in Deutschland.
Wie lässt sich problemorientiertes Lernen in deutsche Krankenpflegeschulen implementieren?
Die Arbeit beschreibt Implementierungsmodelle, analysiert personelle Vorbereitungen (für Lehrende und Lernende) und organisatorische Vorbereitungen (zeitliche, räumliche und materielle Bedingungen). Die Planung, Durchführung und Auswertung problemorientierter Unterrichtseinheiten werden detailliert erläutert, inklusive der Konstruktion von Problemaufgaben und der Gestaltung von Lernerfolgskontrollen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Problemorientiertes Lernen (POL), Pflegeausbildung, Niederländisches Modell, Implementierung, Curriculum, Krankenpflegegesetz, Kompetenzentwicklung, Selbstgesteuertes Lernen, Kleingruppenarbeit, Skillslab, Studienlandschaft, Fächerintegration, Handlungskompetenz.
- Quote paper
- Diplom Pflegepädagogin (FH) Anja Koch (Author), 2005, Problemorientiertes Lernen in der Pflegeausbildung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66371