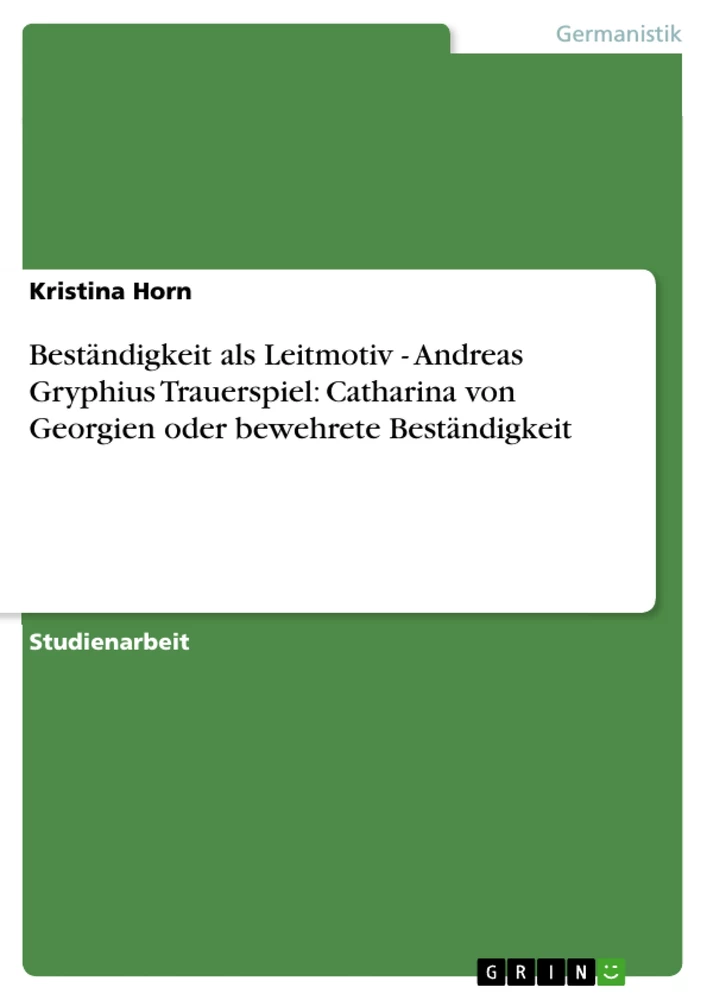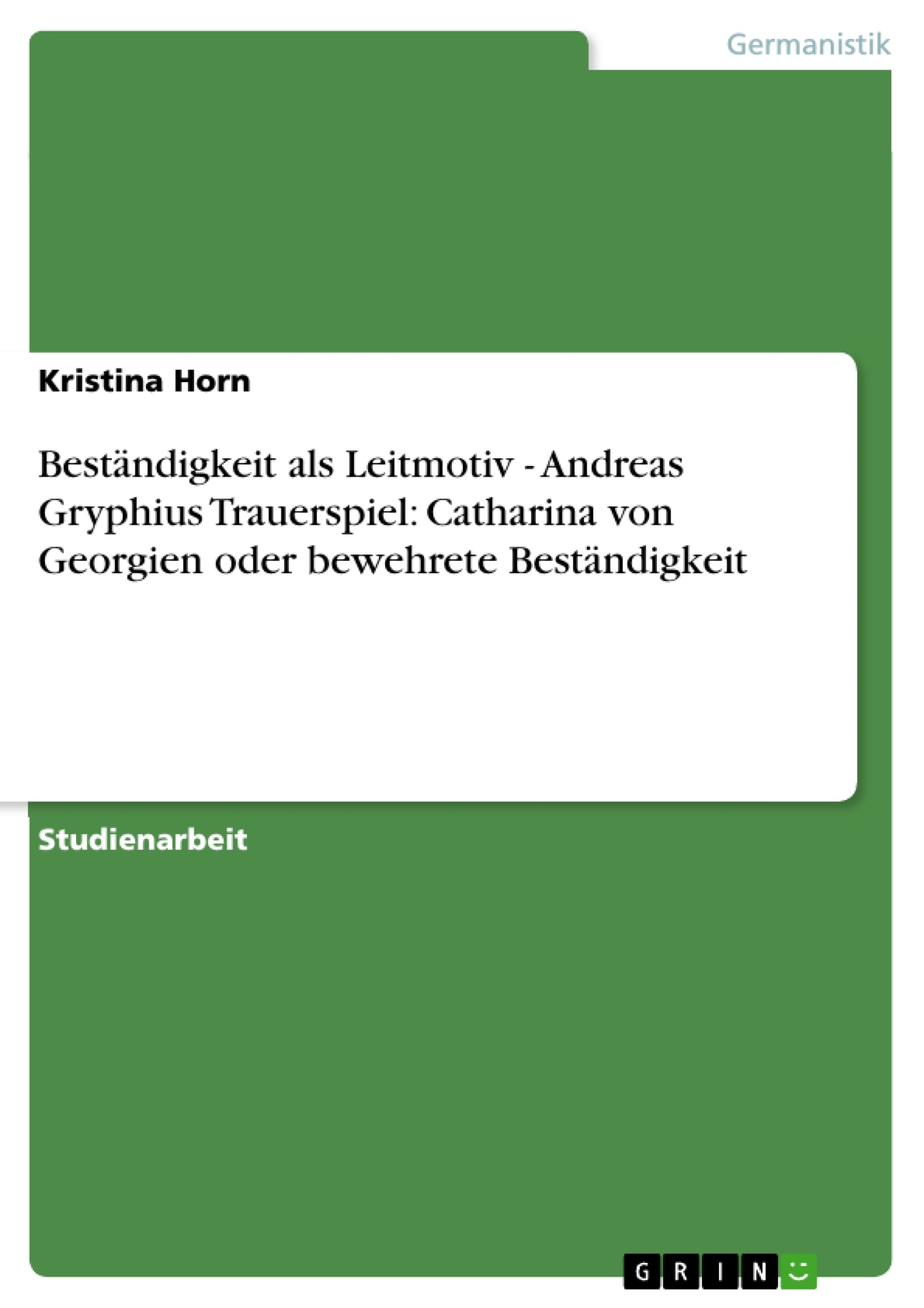1657 schrieb Andreas Gryphius die Tragödie Catharina von Georgien oder Bewehrete Beständigkeit 1 . Bereits der Titel zeigt deutlich das Hauptaugenmerk des Trauerspiels. Zum einen erzählt Andreas Gryphius die wahre Geschichte über die Königin Catharina von Georgien-Gurgistan, die sich 8 Jahre in Gefangenschaft am persischen Hof unter Schah Abas befand. Zum anderen geht es dem Autor um die Darstellung einer Tugend: Beständigkeit. Bereits in der Vorrede zu dem Trauerspiel weist Andreas Gryphius auf die ruhmwürdige Beständigkeit der Protagonistin hin: Catharine […] stellet dir dar in jhrem Leib vnd Leiden ein vor dieser Zeit kaum erhoeretes Beyspiel vnaußsprechlicher Bestaendigkeit 2 . Bereits durch diese Laudatio lenkt Gryphius den Blick des Lesers in die von ihm gewünschte Richtung und sensibilisiert ihn für eine Protagonistin deren Handeln Gryphius als unwiderrufliches Exempel versteht. Catharina von Georgien ist ein Trauerspiel, das dem Zuschauer vor Augen führt, welche Möglichkeiten sich ihm bieten sich innerhalb seiner Lebenszeit zu verhalten. Der Tenor liegt hierbei vor allem auf der Entgegenhaltung von zeitlichem und ewigem Leben. Die Nachteile des Einen und die Vorzüge des Anderen werden aufgeführt. Das Resultat dieser Entgegenstellung ist contemptus mundi - Weltverachtung. Als Märtyrerin verkörpert Catharina das Konzept der contemptus mundi am reinsten und bestätigt somit den nacheiferungswürdigen Charakter ihrer Lebensführung, wie es durch Gryphius bereits in der Vorrede herausgestellt wird. 3 Bei der Lektüre der Tragödie stellt sich zunächst einmal die Frage woher der Tugendbegriff der Beständigkeit stammt, dessen sich Gryphius hier als Paradigma bedient. Dieser Frage soll in dem Kapitel ‚Die Beständigkeit im Rahmen der Stoa’ nachgegangen werden. Im Anschluss daran soll das Trauerspiel an sich näher betrachtet werden. Hierbei wird zunächst die Rolle erörtert, die die Beständigkeit in der Catharina spielt. Im sich anschließenden Kapitel gilt es das Problem der Inszenierung einer solchen Tugendhaltung zu betrachten. Eine einwandfreie, vorbildliche Haltung ist primär auf eine geistige Überzeugung zurückzuführen und dadurch schwer darstellbar. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Beständigkeit im Rahmen der Stoa
- Das Trauerspiel Catharina von Georgien oder Bewehrete Beständigkeit
- Die Rolle der Beständigkeit im Trauerspiel
- Die Darstellung der Beständigkeit
- Die Reyen
- Catharinas Beständigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Andreas Gryphius' Trauerspiel "Catharina von Georgien oder Bewehrete Beständigkeit" und untersucht die Rolle der Beständigkeit als zentrales Motiv.
- Die Bedeutung der stoischen Philosophie für die Konzeption der Beständigkeit im 17. Jahrhundert
- Die Darstellung der Beständigkeit im Kontext der Vanitas-Idee
- Die Rolle der Figur Catharina als Verkörperung der Beständigkeit
- Die Inszenierung der Beständigkeit in der Tragödie
- Die Auswirkungen der Beständigkeit auf die Lebensführung der Protagonistin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Trauerspiels "Catharina von Georgien oder Bewehrete Beständigkeit" ein und erläutert die zentrale Bedeutung der Beständigkeit für das Werk. Im zweiten Kapitel werden die philosophischen Grundlagen der Beständigkeit im Kontext der stoischen Philosophie beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die Rolle der Beständigkeit im Trauerspiel selbst, wobei der Zeit-Ewigkeit-Gegensatz und die Darstellung der Vergänglichkeit alles Irdischen im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Beständigkeit, Stoa, Constantia, Vanitas, Märtyrerdrama, Catharina von Georgien, Andreas Gryphius, Zeit, Ewigkeit, Vergänglichkeit, Tugend, Weltverachtung.
- Citar trabajo
- Kristina Horn (Autor), 2005, Beständigkeit als Leitmotiv - Andreas Gryphius Trauerspiel: Catharina von Georgien oder bewehrete Beständigkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66226