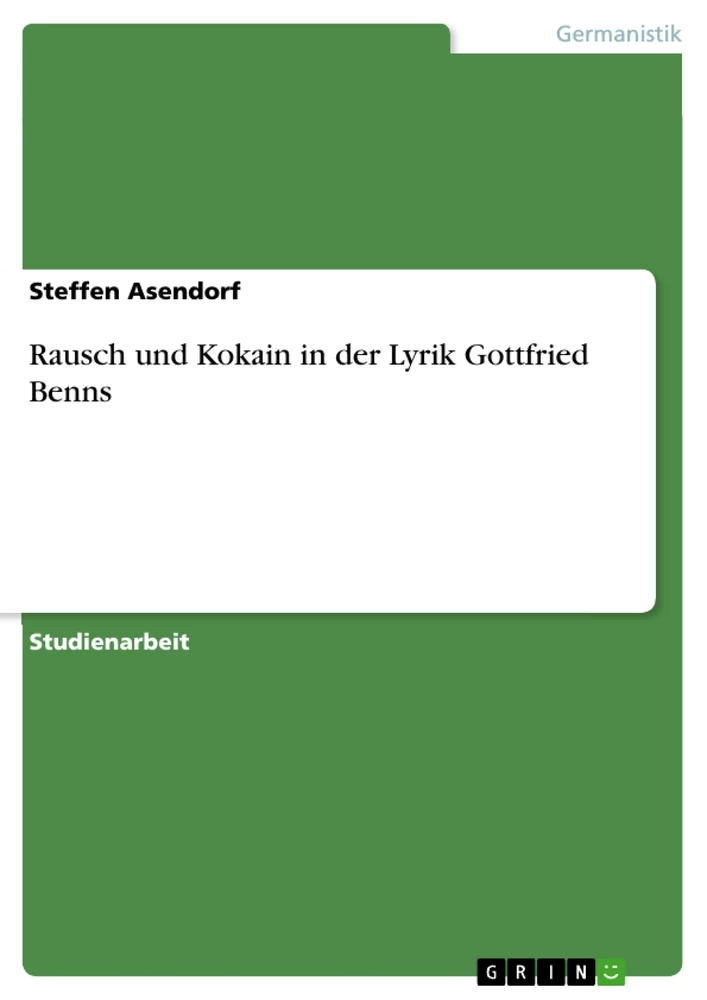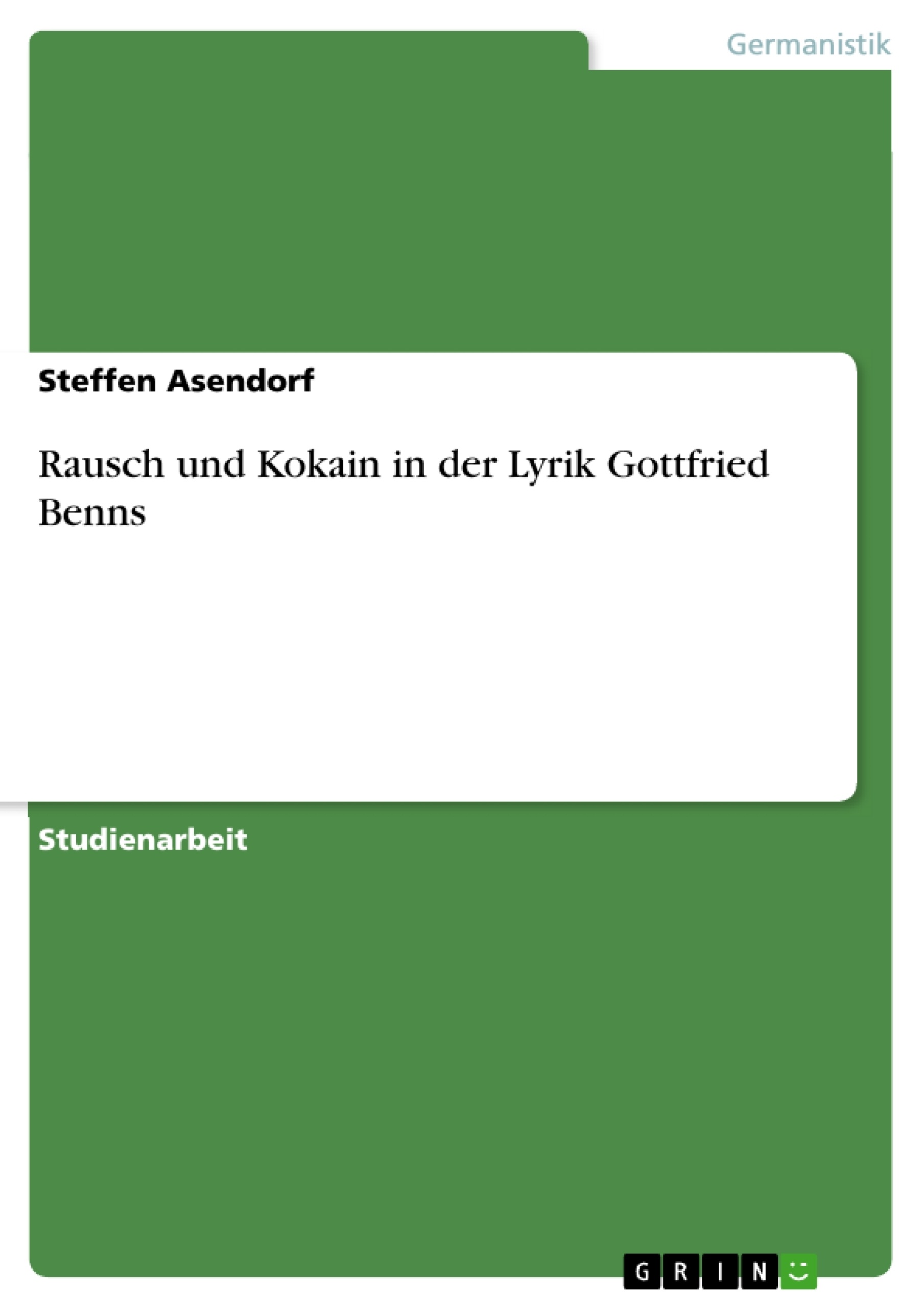Kunst, Rausch und Drogen sind in der Geschichte immer wieder eng miteinander verbunden gewesen und scheinen es auch heute noch zu sein.
Eine Vielzahl von Autoren suchte immer wieder die Nähe von leistungssteigernden, aufputschenden oder aber halluzinogenen Drogen und verarbeitete deren Wirkung dann in ihren Werken. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschreibt beispielsweise der französische Literat Charles Baudelaire in seinen Werken „Künstliche Paradiese“ oder „Opium-Esser“ seine Erfahrungen mit Haschisch und Opiaten. Am Ende des 19. Jahrhunderts sollen die Werke von Arthur Conan Doyle „Sherlock Holmes“ und Robert Louis Stevenson „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ von deren persönlichen Erfahrungen mit Kokain beeinflusst worden sein. Stevenson soll seinen Roman dank des Kokains in nur sechs Tagen geschrieben haben.
In den 1920er Jahren schilderte dann der Schriftsteller und Arzt Gottfried Benn in Gedichten den Kokainrausch. Besonders stark vom Kokain inspirieren ließ sich der expressionistische Lyriker Georg Trakl, welcher dann 1914 an einer Überdosis der Droge verstarb.
Noch vor dem zweiten Weltkrieg verarbeitete Klaus Mann seine Erfahrung mit einer weiteren Droge, dem Heroin in dem 1939 erschienenem Roman „Der Vulkan. Roman unter Emigranten“. Im Jahr 1951 beschreibt der Schriftsteller Ernst Jünger in seinem Roman „Der Besuch auf Godenholm“ einen Selbstversuch mit der synthetischen Droge LSD. Kurz danach, im Jahr 1953, schildert der amerikanische Autor William Burroughs in seinem autobiographischem Roman „Junkie, Bekenntnisse eines unbekehrten Rauschgiftsüchtigen“ seine Erfahrungen mit diversen Opiaten und deren Entzugswirkungen. Einige Jahre später schildert der Autor Aldous Huxley in verschiedenen Werken seine Erfahrungen mit der halluzinogenen Droge Meskalin. Auch in der heutigen Zeit ist davon auszugehen, dass sich diverse Literaten Inspiration durch Drogen zu verschaffen versuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegensatz des Apollinischen und des Dionysischen
- Begriffsbestimmung Rausch
- Kokain als Rauschmittel
- Geschichte des Kokains
- Wirkungsweise von Kokain
- Interpretation „O Nacht -“
- Interpretation „Kokain“
- Kokain bei Benn
- Rausch bei Benn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das lyrische Werk Gottfried Benns auf die Motive Rausch und Kokain. Die Arbeit beleuchtet zunächst den Gegensatz zwischen Apollinischem und Dionysischem, definiert den Begriff Rausch und beschreibt Kokain als Rauschmittel, inklusive seiner Geschichte und Wirkungsweise. Anschließend werden zwei ausgewählte Gedichte Benns interpretiert. Abschließend erfolgt eine zusammenfassende Betrachtung von Rausch und Kokain in Benns Werk.
- Der Gegensatz zwischen Apollinischem und Dionysischem in Bezug auf Benns Werk
- Kokain als Rauschmittel und seine Darstellung in der Lyrik
- Interpretation ausgewählter Gedichte von Gottfried Benn
- Die Rolle des Rausches in Benns Lyrik
- Zusammenfassende Betrachtung von Rausch und Kokain bei Benn
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen Kunst, Rausch und Drogen in der Geschichte dar und nennt Beispiele von Autoren, die die Wirkung von Drogen in ihren Werken verarbeitet haben, von Baudelaire und Stevenson bis zu Burroughs und Huxley. Die Arbeit fokussiert sich auf die Untersuchung des lyrischen Werks von Gottfried Benn im Hinblick auf Rausch und Kokain.
Gegensatz des Apollinischen und des Dionysischen: Dieses Kapitel (angenommen, es ist vorhanden im vollständigen Text und behandelt dieses Thema) würde den von Nietzsche geprägten Gegensatz zwischen Apollinischem und Dionysischem erläutern und analysieren, wie sich dieser Gegensatz in Benns Werk manifestiert und inwiefern er den Gebrauch von Rauschmitteln und die damit verbundene künstlerische Inspiration beeinflusst. Es würde tiefgehend auf die philosophischen Implikationen eingehen und den Kontext im Werk Benns beleuchten.
Begriffsbestimmung Rausch: Dieses Kapitel (angenommen, es ist vorhanden im vollständigen Text) würde eine umfassende Definition des Begriffs "Rausch" liefern, verschiedene Arten von Rauschzuständen unterscheiden und die unterschiedlichen Ausprägungen und Ursachen von Rausch beschreiben, um ein fundiertes Verständnis für die weitere Analyse der Gedichte zu schaffen. Es würde sowohl physiologische als auch psychologische Aspekte beleuchten.
Kokain als Rauschmittel: Dieses Kapitel (angenommen, es ist vorhanden im vollständigen Text) würde sich eingehend mit Kokain befassen, beginnend mit seiner Geschichte, seinen Wirkungen auf den Körper und Geist und den sozialen und kulturellen Aspekten seines Konsums. Es würde die relevanten Fakten darlegen und einen Kontext für die Interpretation der Gedichte schaffen, die sich mit dem Kokainrausch befassen. Die Wirkungsweise würde detailliert und wissenschaftlich korrekt dargestellt werden.
Interpretation „O Nacht -“: (Dieses Kapitel, angenommen, es existiert im vollständigen Text und analysiert ein Gedicht mit dem Titel „O Nacht -“) Eine detaillierte Analyse des Gedichts „O Nacht -“, mit Fokus auf den Ausdruck des Rauscherlebnisses, den verwendeten Bildern und Symbolen sowie der Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und der Droge. Die Interpretation würde die sprachlichen Mittel und die Struktur des Gedichts analysieren und deren Bedeutung im Kontext des Themas beleuchten. Die Analyse würde Bezüge zu anderen Werken Benns und zum Thema des Rausches herstellen.
Interpretation „Kokain“: (Dieses Kapitel, angenommen, es existiert im vollständigen Text und analysiert ein Gedicht mit dem Titel „Kokain“) Eine gründliche Interpretation des Gedichts „Kokain“, unter Berücksichtigung von Themen wie Rausch, Sucht, Tod und Verfall. Die Analyse würde die sprachlichen und bildhaften Mittel detailliert untersuchen und die Beziehungen zwischen den einzelnen Strophen und Motiven aufzeigen. Die Interpretation würde die Bedeutung des Gedichts im Kontext von Benns Gesamtwerk und der Thematik Rausch und Kokain beleuchten.
Kokain bei Benn / Rausch bei Benn: Diese Kapitel (angenommen, sie existieren im vollständigen Text und behandeln die genannten Themen) bieten eine umfassende und zusammenfassende Betrachtung der Rolle von Kokain und Rausch in Benns Werk. Sie würden die verschiedenen Facetten dieser Thematik beleuchten, die Erkenntnisse aus den Gedichtinterpretationen zusammenführen und die Bedeutung von Rausch und Kokain für Benns Lyrik und seine künstlerische Entwicklung diskutieren. Die Analyse würde Bezüge zu Benns Biografie und dem historischen Kontext herstellen.
Schlüsselwörter
Gottfried Benn, Kokain, Rausch, Lyrik, Expressionismus, Apollinisch, Dionysisch, Drogen, Sucht, Gedichtinterpretation, Wirkungsweise Kokain, Drogen in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit über Gottfried Benn, Kokain und Rausch
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das lyrische Werk Gottfried Benns unter besonderer Berücksichtigung der Motive Rausch und Kokain. Sie beleuchtet den Gegensatz zwischen Apollinischem und Dionysischem, definiert den Begriff Rausch, beschreibt Kokain als Rauschmittel und interpretiert ausgewählte Gedichte Benns.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Gegensatz zwischen Apollinischem und Dionysischem in Benns Werk, Kokain als Rauschmittel und seine Darstellung in der Lyrik, Interpretation ausgewählter Gedichte von Gottfried Benn, die Rolle des Rausches in Benns Lyrik und eine zusammenfassende Betrachtung von Rausch und Kokain bei Benn.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet Kapitel zu Einleitung, dem Gegensatz zwischen Apollinischem und Dionysischem, der Begriffsbestimmung Rausch, Kokain als Rauschmittel (inklusive Geschichte und Wirkungsweise), Interpretationen der Gedichte „O Nacht -“ und „Kokain“, sowie zusammenfassende Kapitel zu Kokain und Rausch bei Benn.
Wie werden die Gedichte interpretiert?
Die Interpretationen der Gedichte „O Nacht -“ und „Kokain“ analysieren den Ausdruck des Rauscherlebnisses, verwendete Bilder und Symbole, die Beziehung zwischen lyrischem Ich und Droge, sprachliche Mittel, Struktur und Bedeutung im Kontext des Themas und Benns Gesamtwerk.
Welche Rolle spielt der Gegensatz zwischen Apollinischem und Dionysischem?
Das Kapitel zum Gegensatz zwischen Apollinischem und Dionysischem erläutert Nietzsches Konzept und analysiert dessen Manifestation in Benns Werk und den Einfluss auf den Gebrauch von Rauschmitteln und künstlerische Inspiration. Es beleuchtet die philosophischen Implikationen und den Kontext im Werk Benns.
Wie wird der Begriff „Rausch“ definiert?
Die Arbeit liefert eine umfassende Definition des Begriffs „Rausch“, unterscheidet verschiedene Arten von Rauschzuständen, beschreibt Ausprägungen und Ursachen und beleuchtet physiologische und psychologische Aspekte.
Wie wird Kokain als Rauschmittel dargestellt?
Das Kapitel zu Kokain behandelt dessen Geschichte, Wirkung auf Körper und Geist, sowie soziale und kulturelle Aspekte des Konsums. Die Wirkungsweise wird detailliert und wissenschaftlich korrekt dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Gottfried Benn, Kokain, Rausch, Lyrik, Expressionismus, Apollinisch, Dionysisch, Drogen, Sucht, Gedichtinterpretation, Wirkungsweise Kokain, Drogen in der Literatur.
Welche weiteren Autoren werden in der Einleitung erwähnt?
Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen Kunst, Rausch und Drogen in der Geschichte dar und nennt Beispiele von Autoren wie Baudelaire, Stevenson, Burroughs und Huxley.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, inklusive der Methodik und der angestrebten Ergebnisse der jeweiligen Kapitel.
- Quote paper
- Dipl.-Hdl. Steffen Asendorf (Author), 2006, Rausch und Kokain in der Lyrik Gottfried Benns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66116