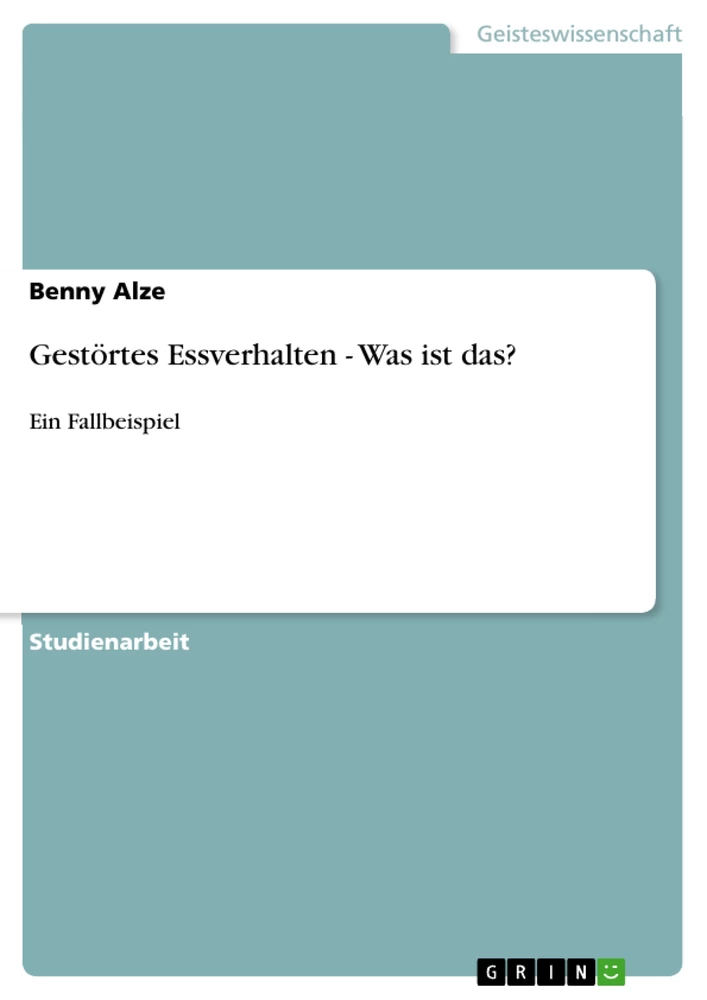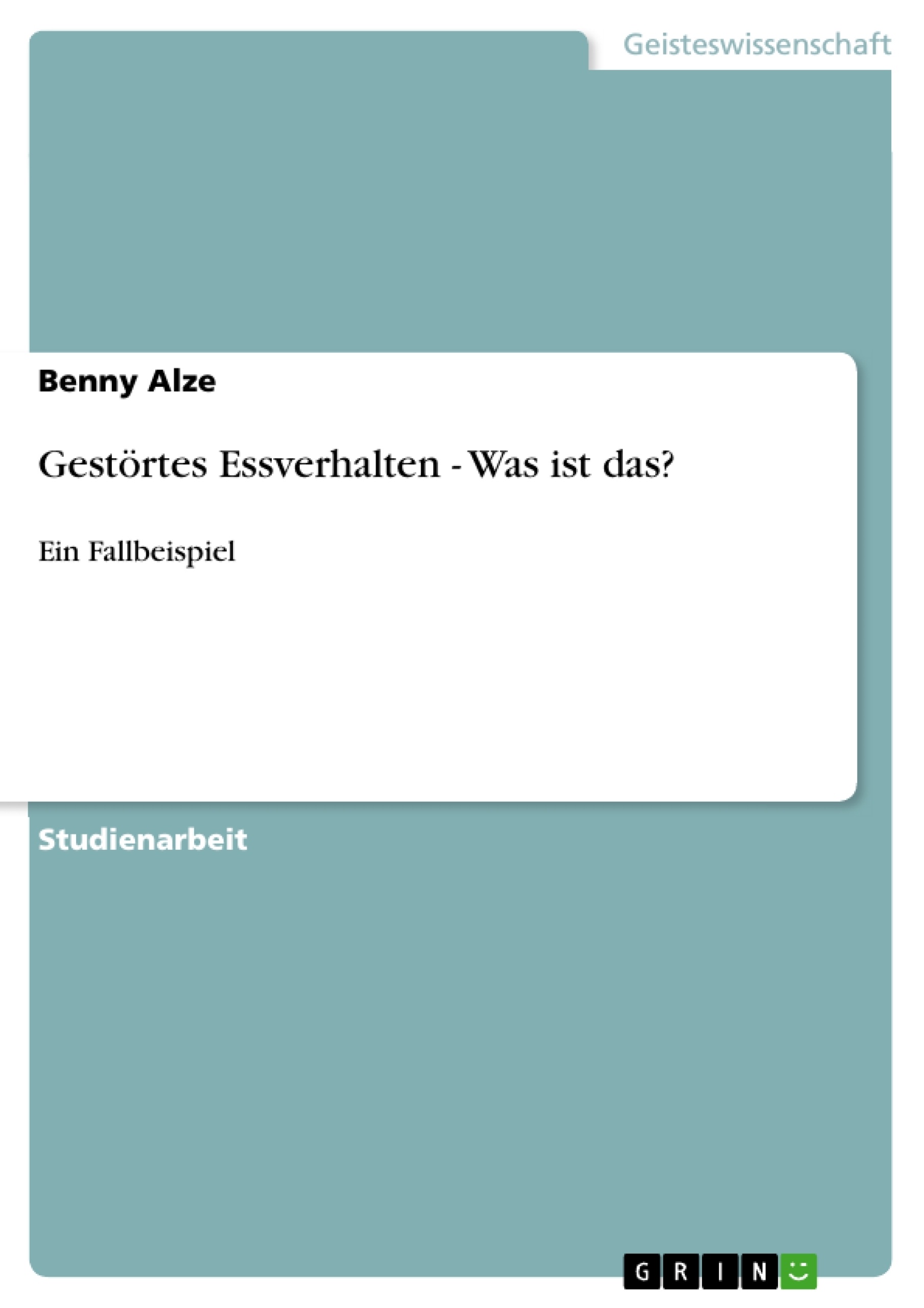Ich habe ein narratives Interview mit Leila durchgeführt. Wir kennen uns aus dem entfernten Bekanntenkreis. Leila ist heute 20 Jahre alt. Ich habe sie gebeten sich in die Zeit von damals zurück zu versetzen und mir möglichst viel darüber zu erzählen. Der Anfang der Magersucht liegt schon sechs Jahre zurück und daher ist die Geschichte mit einige Lücken behaftet. „Da kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern...!“ Außerdem konnte bzw. wollte ich an einigen Stellen nicht weiter nachhaken. „Das geht mir jetzt zu tief in die Geschichte rein. (...) Daran will ich mich auch gar nicht mehr erinnern.“ Ich habe an diesen Stellen aus emotionalen Gründen auch nicht weiter gefragt.
Man kann keine genaue Grenze zwischen gesundem und gestörtem Essverhalten ziehen. „Zwischen dem, was wir als normal akzeptieren, dem gestörtem und dem süchtigen Essverhalten sind die Grenzen fießend.“ In der heutigen Gesellschaft wird das Kalorienzählen, eine Diät oder die ausgiebige Mahlzeit akzeptiert und niemand würde denken, dass eine Essstörung die Ursache sei. Menschen mit einer Essstörung erleben ihr Essverhalten als eine Art Zwang, sei es das zwanghafte Abnehmen, ohne damit aufhören zu können (Magersucht) oder sei es das zwanghafte ‚Hineinstopfen’ von Nahrung, mit (Bulimie) oder ohne (Over-Eating- Störung) anschließendem Erbrechen. Die Verbindung dieser Zwänge besteht darin, dass die Kontrolle des Gewichts das Leben der betroffenen Personen bestimmt. Außerdem wird das Körperbild verzerrt wahr genommen und Gefühle ,z.B. satt oder hungrig, werden unterdrückt. Bei allen Formen ist ein „Drang nach Perfektion (...verbunden mit dem...) Gefühl, ihren eigenen und den Ansprüchen anderer nicht gerecht zu werden.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Fallbeispiel der 'ehemals' magersüchtigen Leila
- II. Gesundes Essverhalten oder Essstörung?
- a. Magersucht – eine Essstörung vor allem junger Frauen?
- b. Bulimie: die verschwiegene Sucht
- c. Was man unter einer Over-Eating-Störung versteht
- III. Der Einfluss der Umwelt
- a. Die Familie
- b. Kulturelle Aspekte: Idealfigur und Schlankheitswahn
- c. Individuelles Stresserleben: Aushalten von Spannung
- d. Mangelndes Selbstwertgefühl - geringe Selbstachtung
- IV. Den eigenen Weg finden - erwachsen werden
- V. Figur und Gewicht
- VI. Im Teufelskreis
- VII. Entwicklung weiterer Symptome: Folge der Essstörung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit präsentiert ein Fallbeispiel einer jungen Frau mit Magersucht und untersucht die komplexen Faktoren, die zu Essstörungen beitragen. Sie beleuchtet sowohl die individuellen Erfahrungen der Betroffenen als auch den Einfluss von Umweltfaktoren.
- Der Verlauf und die Bewältigung einer Magersucht anhand eines Fallbeispiels.
- Die Abgrenzung zwischen gesundem und gestörtem Essverhalten.
- Der Einfluss von sozialen und kulturellen Faktoren auf die Entstehung von Essstörungen.
- Die Rolle von Selbstwertgefühl und Stressbewältigung.
- Die langfristigen Folgen von Essstörungen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Fallbeispiel der 'ehemals' magersüchtigen Leila: Der Text beschreibt das narrative Interview mit Leila, einer jungen Frau, die im Alter von 14 Jahren an Magersucht erkrankte. Auslöser war der Einfluss von extrem dünnen Mädchengestalten in ihrem Sportverein und eine abfällige Bemerkung einer Nachbarin. Leilas anfängliche Kalorienrestriktion steigerte sich, obwohl sie kein verzerrtes Körperbild hatte. Der Text schildert detailliert ihren Tagesablauf, die Rolle des Sports, den Einfluss ihrer Freundin Anna (mit Bulimie), und die letztendliche Überwindung der Magersucht während eines Schulaustauschs in Frankreich, wo sie gezwungen war, regelmäßig zu essen und aufhörte, Kalorien zu zählen. Trotz der Genesung, besteht weiterhin eine Tendenz zur Kalorienkontrolle.
II. Gesundes Essverhalten oder Essstörung?: Dieses Kapitel diskutiert die fließenden Grenzen zwischen gesundem und gestörtem Essverhalten. Es wird betont, dass Kalorienzählen und Diäten nicht automatisch auf eine Essstörung hindeuten. Der Text differenziert zwischen Magersucht (zwanghaftes Abnehmen), Bulimie (zwanghaftes Essen mit anschließendem Erbrechen) und Over-Eating-Störung (zwanghaftes Essen ohne Erbrechen). Gemeinsam ist allen Störungen der Verlust der Kontrolle über das Essverhalten, eine verzerrte Wahrnehmung des Körpers und die Unterdrückung von Gefühlen. Es wird darauf hingewiesen, dass starke Gewichtsveränderungen auch organische Ursachen haben können.
Schlüsselwörter
Magersucht, Bulimie, Over-Eating-Störung, Essstörungen, Körperbild, Selbstwertgefühl, Stress, soziale Einflüsse, kulturelle Normen, Fallbeispiel, Gesundes Essverhalten, Genesungsprozess.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Essstörungen
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text behandelt das Thema Essstörungen anhand eines Fallbeispiels der ehemals magersüchtigen Leila. Er untersucht die komplexen Faktoren, die zu Essstörungen beitragen, sowohl individuelle als auch umweltbedingte. Der Text umfasst ein Fallbeispiel, eine Diskussion über verschiedene Essstörungen (Magersucht, Bulimie, Over-Eating-Störung), den Einfluss der Umwelt (Familie, Kultur, Stress), die Bedeutung von Selbstwertgefühl und die langfristigen Folgen von Essstörungen. Zusätzlich enthält er ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Essstörungen werden im Text behandelt?
Der Text beschreibt Magersucht (Anorexia nervosa), Bulimie (Bulimia nervosa) und Over-Eating-Störung (Binge-Eating-Störung). Es wird auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten eingegangen, insbesondere auf den Verlust der Kontrolle über das Essverhalten, die verzerrte Körperwahrnehmung und die Unterdrückung von Gefühlen.
Wie wird der Einfluss der Umwelt dargestellt?
Der Text analysiert den Einfluss der Familie, kultureller Aspekte (Idealfigur, Schlankheitswahn), individuellen Stresserlebens und mangelnden Selbstwertgefühls auf die Entstehung und den Verlauf von Essstörungen. Es wird gezeigt, wie soziale und kulturelle Normen zu einem Druck führen können, der zu ungesundem Essverhalten beiträgt.
Welchen Stellenwert hat das Fallbeispiel von Leila?
Leilas Fallbeispiel bildet den Ausgangspunkt des Textes. Es illustriert den Verlauf einer Magersucht, die Auslöser (Einfluss von schlanken Mädchengestalten, abfällige Bemerkung), den Umgang mit der Krankheit und den Genesungsprozess während eines Auslandsaufenthalts. Leilas Geschichte veranschaulicht die Komplexität der Erkrankung und die Bedeutung von Umweltfaktoren.
Wie wird gesundes von gestörtem Essverhalten abgegrenzt?
Der Text betont, dass Kalorienzählen und Diäten nicht automatisch auf eine Essstörung hindeuten. Die Abgrenzung erfolgt anhand von Kriterien wie Kontrollverlust über das Essverhalten, verzerrte Körperwahrnehmung, Unterdrückung von Gefühlen und starkem Leidensdruck. Es wird darauf hingewiesen, dass starke Gewichtsveränderungen auch organische Ursachen haben können.
Welche langfristigen Folgen von Essstörungen werden erwähnt?
Der Text deutet auf die langfristigen körperlichen und psychischen Folgen von Essstörungen hin, ohne diese detailliert zu beschreiben. Es wird implizit auf die Notwendigkeit einer Therapie und nachhaltigen Bewältigungsstrategien hingewiesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Magersucht, Bulimie, Over-Eating-Störung, Essstörungen, Körperbild, Selbstwertgefühl, Stress, soziale Einflüsse, kulturelle Normen, Fallbeispiel, gesundes Essverhalten, Genesungsprozess.
- Quote paper
- Benny Alze (Author), 2003, Gestörtes Essverhalten - Was ist das?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66025