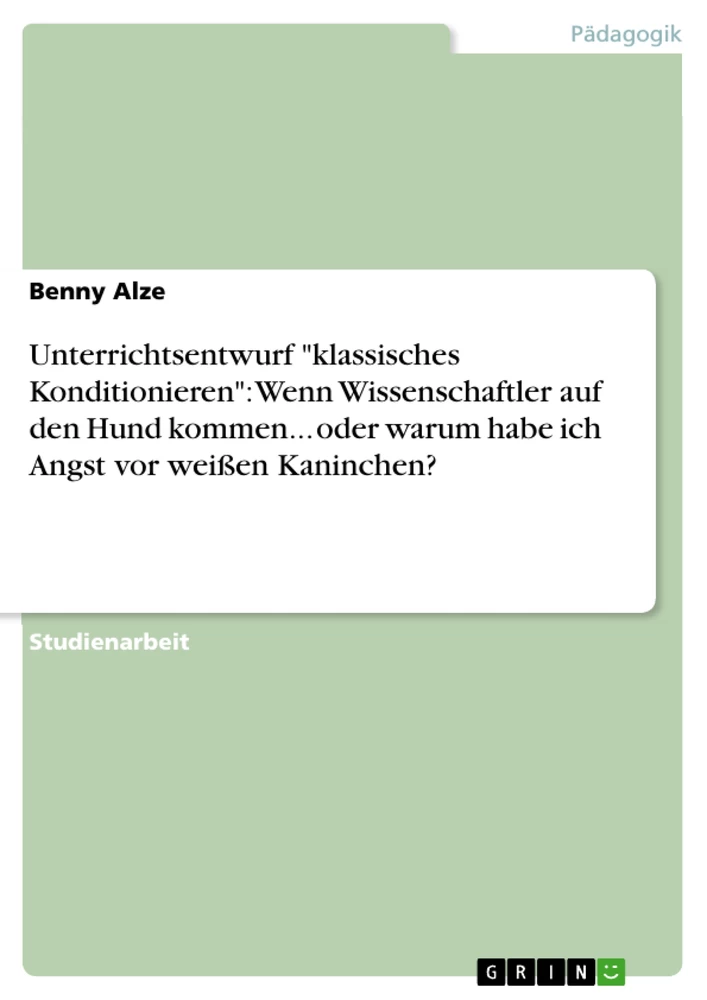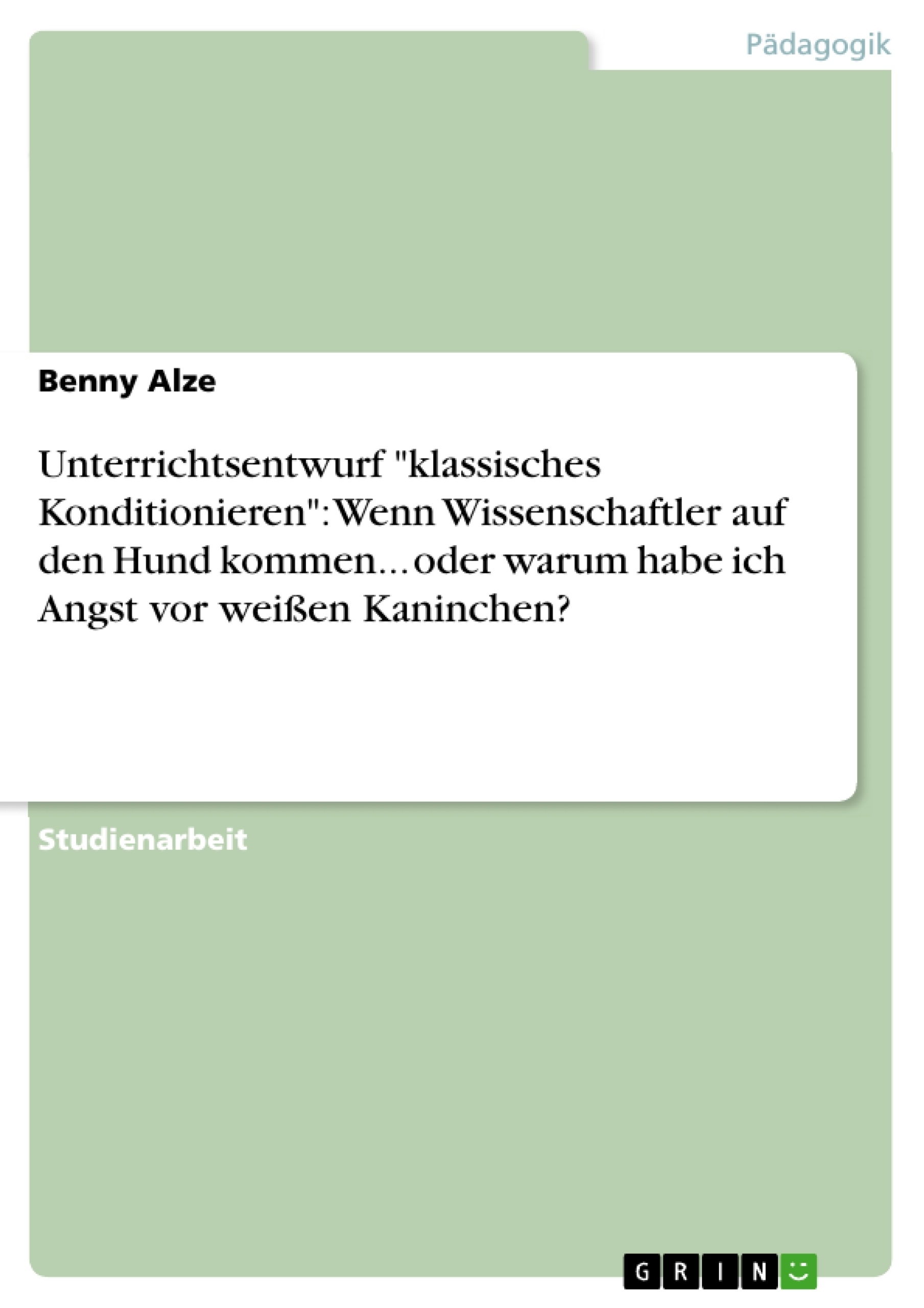Lernen bezieht sich auf „die Veränderung im Verhalten oder im Verhaltenspotential eines Organismus in einer bestimmten Situation, die auf wiederholte Erfahrungen des Organismus in dieser Situation zurückgeht.“ Somit schließt Lernen alle angeborenen Reaktionstendenzen, wie reifungsbedingte Veränderungen aus. Beim Lernen geht es um Verhalten, dass in einer Zeitspanne beobachtet werden kann. Das zu Erklärende wäre hierbei die Veränderung, welche auf Erfahrungen beruht. Im Gegensatz zum Erziehungsbegriff, werden die Veränderungen der Verhaltensdispositionen beim Lernen wertneutral gesehen. Erfahrungen sind schwierig zu fassen, da kurzfristige Anpassungen oder Ermüdungserscheinungen noch keine hinreichenden Erfahrungen für einen Lernprozess darstellen.
„Die psychologische Richtung, die sich auf das direkt wahrnehmbare Verhalten konzentriert wird Behaviorismus genannt. Diejenigen, die im direkt wahrnehmbaren Verhalten einen Hinweis darauf sehen, was im Gedächtnis eines Menschen vor sich geht, werden kognitive Psychologen genannt.“ Die Systematisierung der Kenntnisse über Lernen führt zu Lerntheorien. Diese lassen sich grob den beiden Bereichen zuordnen: Behavioristische und Kognitive Lerntheorien.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Unterrichtsvorhaben
- 1.1 Gegenstand des Unterrichtsvorhabens
- 1.1.1 Lerntheorien
- 1.1.2 Das klassische Konditionieren
- 1.2 Ziele im Pädagogikunterricht
- 1.3 Thema des Unterrichtsvorhabens
- 1.4 Aufbau des Unterrichtsvorhabens
- 1.5 Beschreibung des Unterrichtsvorhabens
- 2. Stundenentwurf für die 1. Stunde des Unterrichtsvorhabens
- 2.1 Thema der Stunde
- 2.2 Stundenziel
- 2.3 Einordnung der Stunde in den Kontext
- 2.4 Didaktischer Schwerpunkt
- 2.5 Fachkompetenz und Vorwissen
- 2.6 Methodenkompetenz
- 2.6.1 Bildbeschreibung
- 2.6.2 Mindmap
- 2.7 Sozialkompetenz
- 2.8 Synoptische Darstellung der geplanten Lehr-/Lernprozesse
- 2.9 Feinziele und erwartetes Schülerverhalten
- 2.9.1 Einstiegs- und Motivationsphase
- 2.9.2 Erarbeitungsphase I
- 2.9.3 Einteilungsphase
- 2.9.4 Erarbeitungsphase II
- 2.9.5 Sicherungsphase
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschreibt ein Unterrichtsvorhaben zum Thema Lernen und Entwicklung, wobei der Fokus auf dem klassischen Konditionieren liegt. Ziel ist die didaktische Aufbereitung und Planung einer Unterrichtsstunde, die die Prinzipien des klassischen Konditionierens verständlich vermittelt.
- Klassisches Konditionieren nach Pawlow
- Anwendung von Lerntheorien im Unterricht
- Didaktische Planung und Gestaltung einer Unterrichtsstunde
- Methodenkompetenz im Unterricht
- Verhaltensmodifikation durch Konditionierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Unterrichtsvorhaben: Dieses Kapitel legt den Grundstein für das gesamte Unterrichtsvorhaben. Es definiert den Gegenstand des Unterrichts, indem es verschiedene Lerntheorien einführt und das klassische Konditionieren als zentralen Fokus herausstellt. Die Ziele des Pädagogikunterrichts werden spezifiziert, das Thema des Unterrichtsvorhabens wird präzise formuliert und der Aufbau des gesamten Vorhabens wird detailliert beschrieben. Schließlich wird das Unterrichtsvorhaben selbst umfassend erläutert, was einen fundierten Rahmen für die folgenden Kapitel schafft.
2. Stundenentwurf für die 1. Stunde des Unterrichtsvorhabens: Dieses Kapitel präsentiert einen detaillierten Stundenentwurf für die erste Stunde des Unterrichtsvorhabens. Es spezifiziert das Thema der Stunde, das Stundenziel, und ordnet die Stunde in den Gesamtkontext des Unterrichtsvorhabens ein. Der didaktische Schwerpunkt wird definiert, und die notwendigen Fach- und Methodenkompetenzen der Schüler werden berücksichtigt. Sozialkompetenz spielt ebenfalls eine Rolle. Der Stundenentwurf gliedert sich in verschiedene Phasen (Einstieg, Erarbeitung, Sicherung), wobei für jede Phase Feinziele und das erwartete Schülerverhalten beschrieben werden.
Schlüsselwörter
Klassisches Konditionieren, Pawlow, Lerntheorien, Behaviorismus, Konditionierung erster und zweiter Ordnung, Generalisierung, Diskrimination, Unterrichtsplanung, Didaktik, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Verhaltenstherapie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Unterrichtsvorhaben: Klassisches Konditionieren
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsvorhabens?
Das Unterrichtsvorhaben konzentriert sich auf das klassische Konditionieren nach Pawlow und seine Anwendung im pädagogischen Kontext. Es beinhaltet die didaktische Aufbereitung und Planung einer Unterrichtsstunde, die die Prinzipien des klassischen Konditionierens verständlich vermittelt.
Welche Lerntheorien werden behandelt?
Der Schwerpunkt liegt auf dem klassischen Konditionieren, wobei auch allgemeinere Lerntheorien im Kontext eingeführt werden. Der Behaviorismus wird als theoretischer Hintergrund erwähnt.
Welche Ziele werden mit dem Unterrichtsvorhaben verfolgt?
Ziel ist die didaktische Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde zum Thema klassisches Konditionieren. Die Schüler sollen die Prinzipien des klassischen Konditionierens verstehen und anwenden können. Weiterhin werden Methoden- und Sozialkompetenzen gefördert.
Wie ist das Unterrichtsvorhaben aufgebaut?
Das Unterrichtsvorhaben ist in zwei Hauptkapitel gegliedert: Das erste Kapitel beschreibt das gesamte Unterrichtsvorhaben, seine Ziele, den Aufbau und die theoretischen Grundlagen. Das zweite Kapitel beinhaltet einen detaillierten Stundenentwurf für die erste Stunde, einschließlich der didaktischen Planung, der Methoden und der erwarteten Schüleraktivitäten.
Was sind die zentralen Themen des Stundenentwurfs?
Der Stundenentwurf behandelt das Thema klassisches Konditionieren im Detail. Er beinhaltet die Definition des Themas und des Stundenziels, die Einordnung in den Gesamtkontext, die didaktischen Schwerpunkte und die benötigten Kompetenzen (Fach-, Methoden-, Sozialkompetenz). Der Entwurf umfasst verschiedene Phasen: Einstieg, Erarbeitung (in zwei Teilen) und Sicherung. Für jede Phase werden Feinziele und erwartetes Schülerverhalten spezifiziert.
Welche Methoden werden im Unterricht eingesetzt?
Der Stundenentwurf sieht unter anderem die Methoden Bildbeschreibung und Mindmap vor.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Klassisches Konditionieren, Pawlow, Lerntheorien, Behaviorismus, Konditionierung erster und zweiter Ordnung, Generalisierung, Diskrimination, Unterrichtsplanung, Didaktik, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Verhaltenstherapie.
Wie wird das klassische Konditionieren im Unterricht vermittelt?
Der Stundenentwurf beschreibt eine detaillierte Planung, wie die Prinzipien des klassischen Konditionierens nach Pawlow im Unterricht vermittelt werden, unter Berücksichtigung der didaktischen Prinzipien und der zu fördernden Kompetenzen der Schüler.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler erwerben?
Die Schüler sollen Fachkompetenz (Verständnis des klassischen Konditionierens), Methodenkompetenz (Anwendung von Methoden wie Bildbeschreibung und Mindmap) und Sozialkompetenz (Zusammenarbeit im Unterricht) erwerben.
- Arbeit zitieren
- Benny Alze (Autor:in), 2005, Unterrichtsentwurf "klassisches Konditionieren": Wenn Wissenschaftler auf den Hund kommen... oder warum habe ich Angst vor weißen Kaninchen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66023