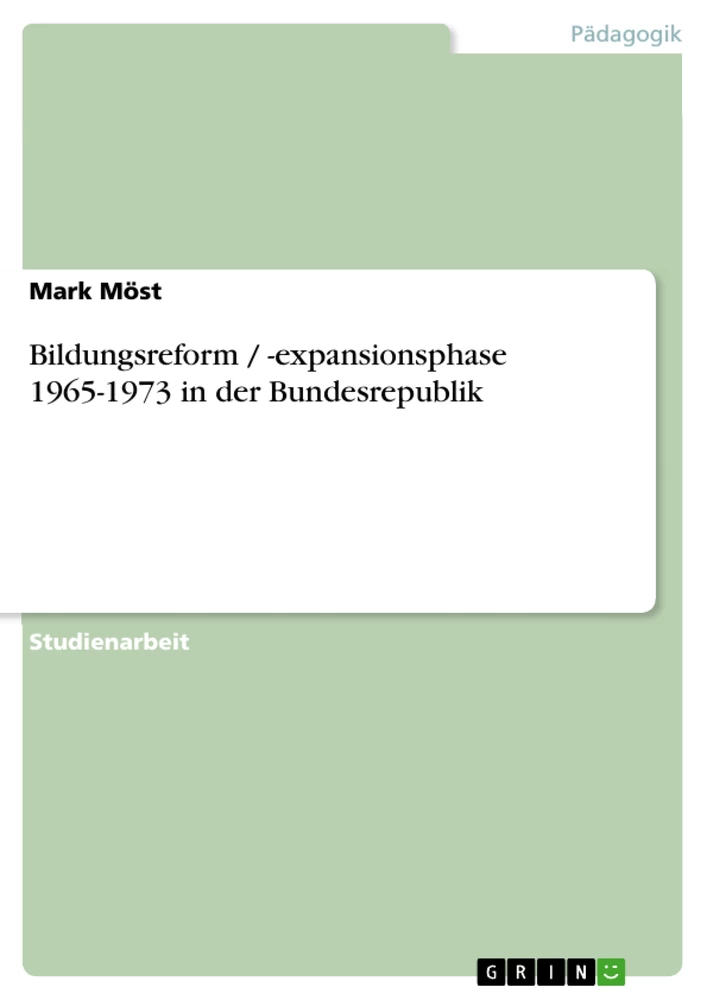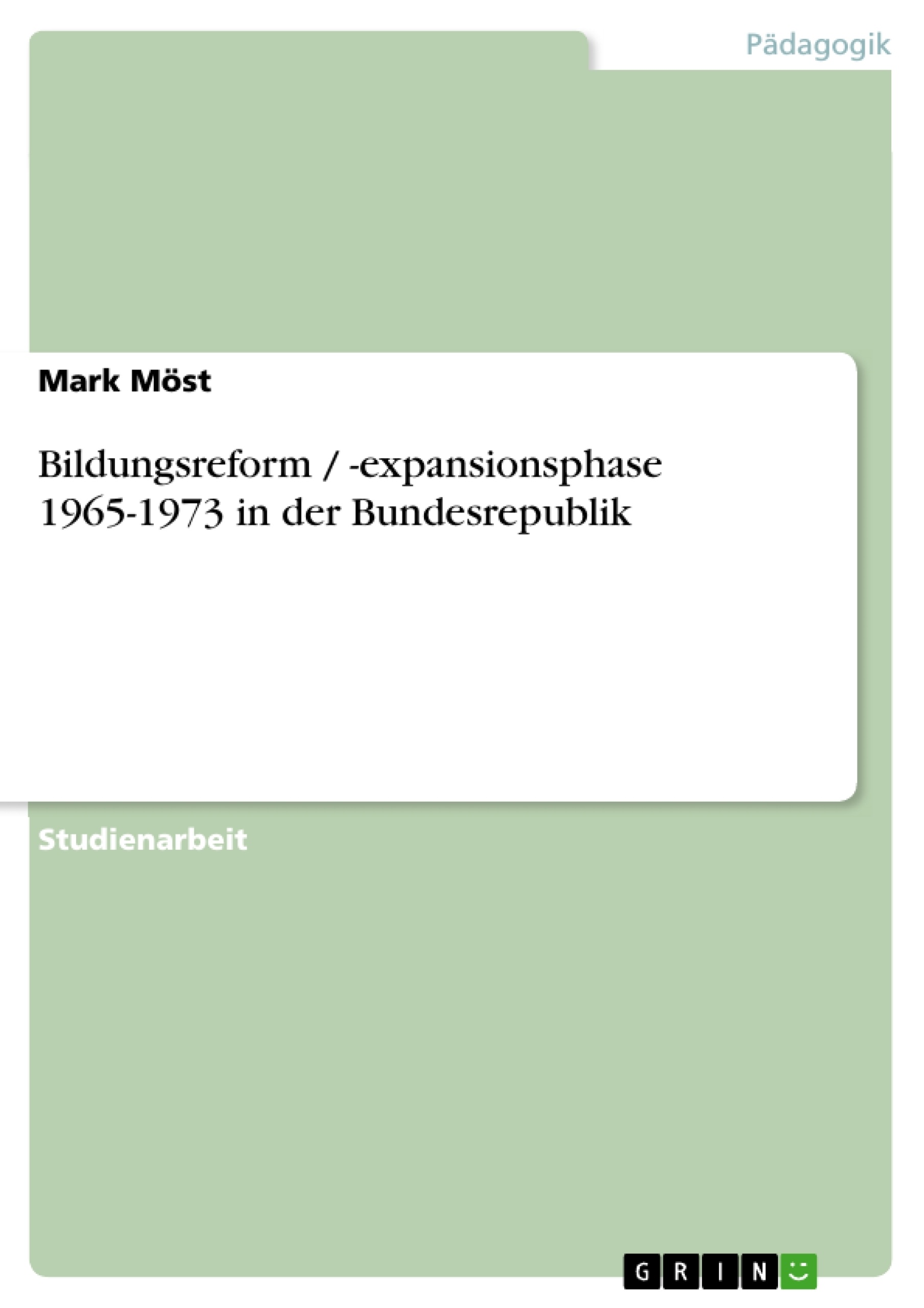Im genannten Zeitraum herrschte in der Bundesrepublik Deutschland ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften; ihr Anteil an den Arbeitskräften insgesamt betrug schätzungsweise 50 %. Ökonomisch ist diese Periode gekennzeichnet durch einen raschen wirtschaftlichen Aufschwung. Wenn damals auch schon soziale Probleme im Bildungsbereich vorhanden waren, so waren diese jedoch noch nicht ins öffentliche Bewußtsein vorgedrungen, um dort Gegenstand einer kontroversen Diskussion zu werden. Zu den bereits zum damaligen Zeitpunkt augenfälligen Schwachstellen gehört, daß das dreigliedrige Schulsystem zwar offiziell keine Selektion nach sozialen Gesichtspunkten vorsieht, denn „kein Gesetzestext sieht als Kriterium für die Schullaufbahn eines Kindes die soziale Herkunft vor“; de facto muß aber weiterhin von einem Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht und entsprechenden Bildungschancen ausgegangen werden, denn es läßt sich nachweisen, „daß die Verteilung der Schulpopulation auf die einzelnen Schularten immer noch eine Selektion nach der sozialen Schicht darstellt. Am bekanntesten ist hier die Unterrepräsentation von Kindern aus Arbeiterfamilien [an Gymnasien]“1. Beim Wiederaufbau des Schulsystems in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man auf die Institutionen der Weimarer Republik zurückgegriffen, damit am dreigliedrigen Schulsystem festgehalten und keine Verwirklichung der Gesamtschule in Angriff genommen: „In den fünfziger Jahren vollzogen sich in der Bundesrepublik Wiederherstellung und Konsolidierung des Schulwesens im Anschluß an Organisationsstrukturen der Weimarer Republik. In dieser Restaurationsperiode wurden Reformansätze der unmittelbaren Nachkriegszeit [...] zurückgedrängt.“2
[...]
1 Lenhart (1972), S. 32
2 Baumert (1979), S. 57
Inhaltsverzeichnis
- Erste Phase: Soziale und ökonomische Rahmenbedingungen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre
- Zweite Phase: Zuspitzung der Situation Anfang der 60er Jahre
- Dritte Phase: Reformdiskussion verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und ihre Konsequenzen
- Modernistische Position
- Gesellschaftsreformerische Position
- Strukturreformerische Position
- Traditionalisten und reformkritisch-revolutionäre Position
- Die Bildungsreform seit Ende der 60er Jahre und ihre Motive
- Vierte Phase: Ernüchterung seit Beginn der 70er Jahre
- Fünfte Phase: Ausklang der Bildungsreformphase bis etwa 1975
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bildungsreform- und Expansionsphase in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1965 und 1973. Sie analysiert die sozioökonomischen Bedingungen, die zu den Reformen führten, die verschiedenen Positionen und Akteure in der Reformdebatte und die letztendlichen Folgen der Reformbemühungen. Die Arbeit verzichtet auf eine abschließende Bewertung der Erfolgsbilanz der Reformen.
- Sozioökonomische Rahmenbedingungen der Bildungsreform
- Der Einfluss des „Sputnikschocks“ und die öffentliche Kritik am Bildungssystem
- Die verschiedenen Positionen in der Reformdebatte (modernistisch, gesellschaftsreformerisch, strukturreformerisch, traditionell)
- Die Umsetzung der Reformen und regionale Unterschiede
- Die Entwicklungen der frühen 1970er Jahre und das Ende der Reformära
Zusammenfassung der Kapitel
Erste Phase: Soziale und ökonomische Rahmenbedingungen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre: Diese Phase zeichnet sich durch einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in der Bundesrepublik aus, begleitet von einem starken Wirtschaftswachstum. Obwohl soziale Probleme im Bildungssystem existierten, waren diese noch nicht Gegenstand breiter öffentlicher Debatten. Das dreigliedrige Schulsystem, obwohl offiziell nicht sozial selektiv, reproduzierte in der Praxis soziale Ungleichheiten, besonders deutlich in der Unterrepräsentation von Kindern aus Arbeiterfamilien an Gymnasien. Die Nachkriegszeit sah eine Wiederherstellung des Schulsystems der Weimarer Republik, wodurch Reformen der unmittelbaren Nachkriegszeit zurückgedrängt wurden.
Zweite Phase: Zuspitzung der Situation Anfang der 60er Jahre: Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften verschärfte sich ab 1962. Der „Sputnikschock“ führte zu einer öffentlichen Diskussion über die Defizite des deutschen Bildungssystems. Publikationen wie „Die deutsche Bildungskatastrophe“ von Georg Picht zeichneten ein düsteres Bild und verglichen die Bildungsstände der BRD mit anderen Ländern. Während Picht einen ökonomischen Ansatz wählte, betonte Ralf Dahrendorf in „Bildung ist Bürgerrecht“ die soziale Dimension und forderte Chancengleichheit im Bildungssystem, was eine expansive Bildungspolitik implizierte.
Dritte Phase: Reformdiskussion verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und ihre Konsequenzen: Die ökonomische Krise von 1966/67 und die Studentenproteste der späten 1960er Jahre verstärkten die Diskussionen über notwendige Reformen. Die Debatten waren stark polarisiert, was einen bundesweiten Konsens verhinderte. 1969 wurden Reformen mit den Zielen „Modernisierung“ und „Demokratisierung“ eingeleitet, mit der Empfehlung des Deutschen Bildungsrates, integrierte und differenzierte Gesamtschulen als Versuchsschulen einzurichten. Lenhart's Typologie kategorisiert die verschiedenen Positionen in der Reformdebatte (modernistisch, gesellschaftsreformerisch, strukturreformerisch, traditionell).
Vierte Phase: Ernüchterung seit Beginn der 70er Jahre: (Diese Zusammenfassung wurde aufgrund der Anweisungen ausgelassen, da es sich um eine spätere Phase handelt und keine Kapitelzusammenfassung im Sinne der Anweisungen verlangt wird)
Fünfte Phase: Ausklang der Bildungsreformphase bis etwa 1975: (Diese Zusammenfassung wurde aufgrund der Anweisungen ausgelassen, da es sich um eine spätere Phase handelt und keine Kapitelzusammenfassung im Sinne der Anweisungen verlangt wird)
Schlüsselwörter
Bildungsreform, Bundesrepublik Deutschland, Wirtschaftswachstum, qualifizierte Arbeitskräfte, dreigliedriges Schulsystem, soziale Ungleichheit, Sputnikschock, Bildungskatastrophe, Chancengleichheit, expansive Bildungspolitik, Studentenproteste, Modernisierung, Demokratisierung, Gesamtschule.
Häufig gestellte Fragen zur Bildungsreform in der Bundesrepublik Deutschland (1965-1973)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bildungsreform- und Expansionsphase in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1965 und 1973. Sie analysiert die sozioökonomischen Bedingungen, die zu den Reformen führten, die verschiedenen Positionen und Akteure in der Reformdebatte und die Folgen der Reformbemühungen. Eine abschließende Bewertung der Erfolgsbilanz der Reformen wird vermieden.
Welche Phasen der Bildungsreform werden unterschieden?
Die Arbeit gliedert die Bildungsreform in fünf Phasen: 1. Soziale und ökonomische Rahmenbedingungen Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre; 2. Zuspitzung der Situation Anfang der 60er Jahre; 3. Reformdiskussion verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und ihre Konsequenzen; 4. Ernüchterung seit Beginn der 70er Jahre; 5. Ausklang der Bildungsreformphase bis etwa 1975. Die letzten beiden Phasen werden jedoch nur kurz angeschnitten.
Welche sozioökonomischen Rahmenbedingungen prägten die Reform?
Die erste Phase ist gekennzeichnet durch einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften bei starkem Wirtschaftswachstum. Das bestehende dreigliedrige Schulsystem reproduzierte soziale Ungleichheiten. Die Nachkriegszeit sah eine Wiederherstellung des Schulsystems der Weimarer Republik, wodurch Reformen der unmittelbaren Nachkriegszeit zurückgedrängt wurden.
Welche Rolle spielte der „Sputnikschock“?
Der „Sputnikschock“ und die darauf folgenden Veröffentlichungen wie „Die deutsche Bildungskatastrophe“ von Georg Picht führten zu einer öffentlichen Diskussion über die Defizite des deutschen Bildungssystems und verstärkten den Druck auf Reformen. Pichts ökonomischer Ansatz wurde durch Ralf Dahrendorfs Fokus auf soziale Chancengleichheit ergänzt.
Welche Positionen gab es in der Reformdebatte?
Die Reformdebatte war stark polarisiert. Die Arbeit unterscheidet verschiedene Positionen: modernistische, gesellschaftsreformerische, strukturreformerische und traditionell/reformkritisch-revolutionäre Positionen. Die Umsetzung der Reformen und regionale Unterschiede werden ebenfalls behandelt. 1969 wurden Reformen mit den Zielen „Modernisierung“ und „Demokratisierung“ eingeleitet, mit der Empfehlung des Deutschen Bildungsrates, integrierte und differenzierte Gesamtschulen als Versuchsschulen einzurichten. Lenhart's Typologie dient zur Kategorisierung dieser Positionen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thematik?
Schlüsselwörter sind: Bildungsreform, Bundesrepublik Deutschland, Wirtschaftswachstum, qualifizierte Arbeitskräfte, dreigliedriges Schulsystem, soziale Ungleichheit, Sputnikschock, Bildungskatastrophe, Chancengleichheit, expansive Bildungspolitik, Studentenproteste, Modernisierung, Demokratisierung, Gesamtschule.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen für die ersten drei Phasen der Bildungsreform. Die Zusammenfassungen der Phasen vier und fünf wurden aufgrund der Vorgaben ausgelassen.
- Quote paper
- Mark Möst (Author), 2004, Bildungsreform / -expansionsphase 1965-1973 in der Bundesrepublik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65984