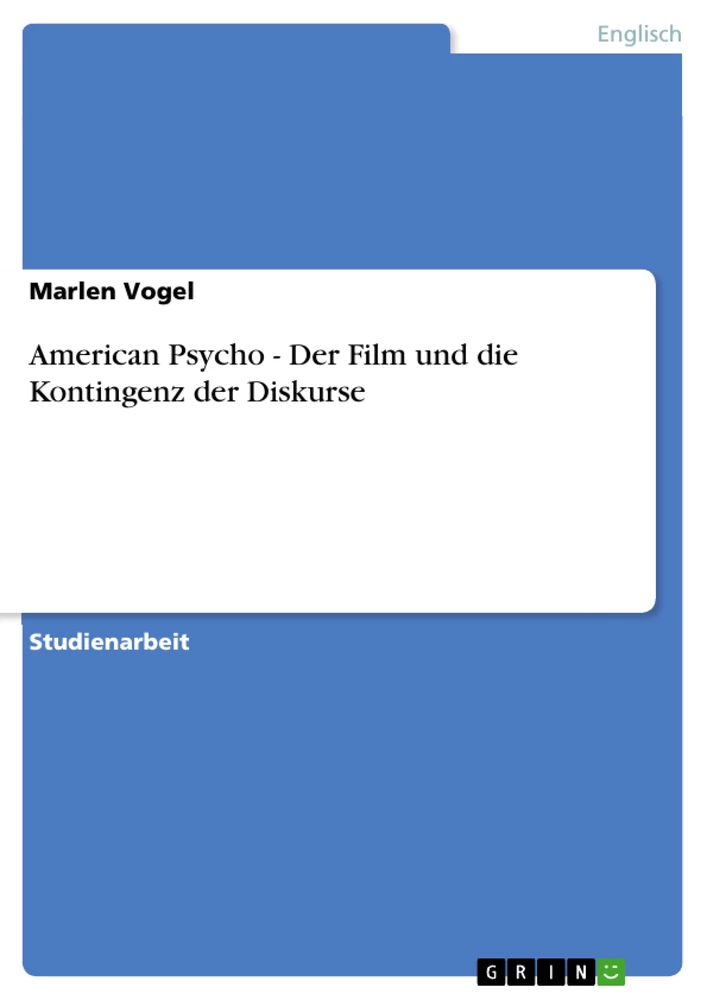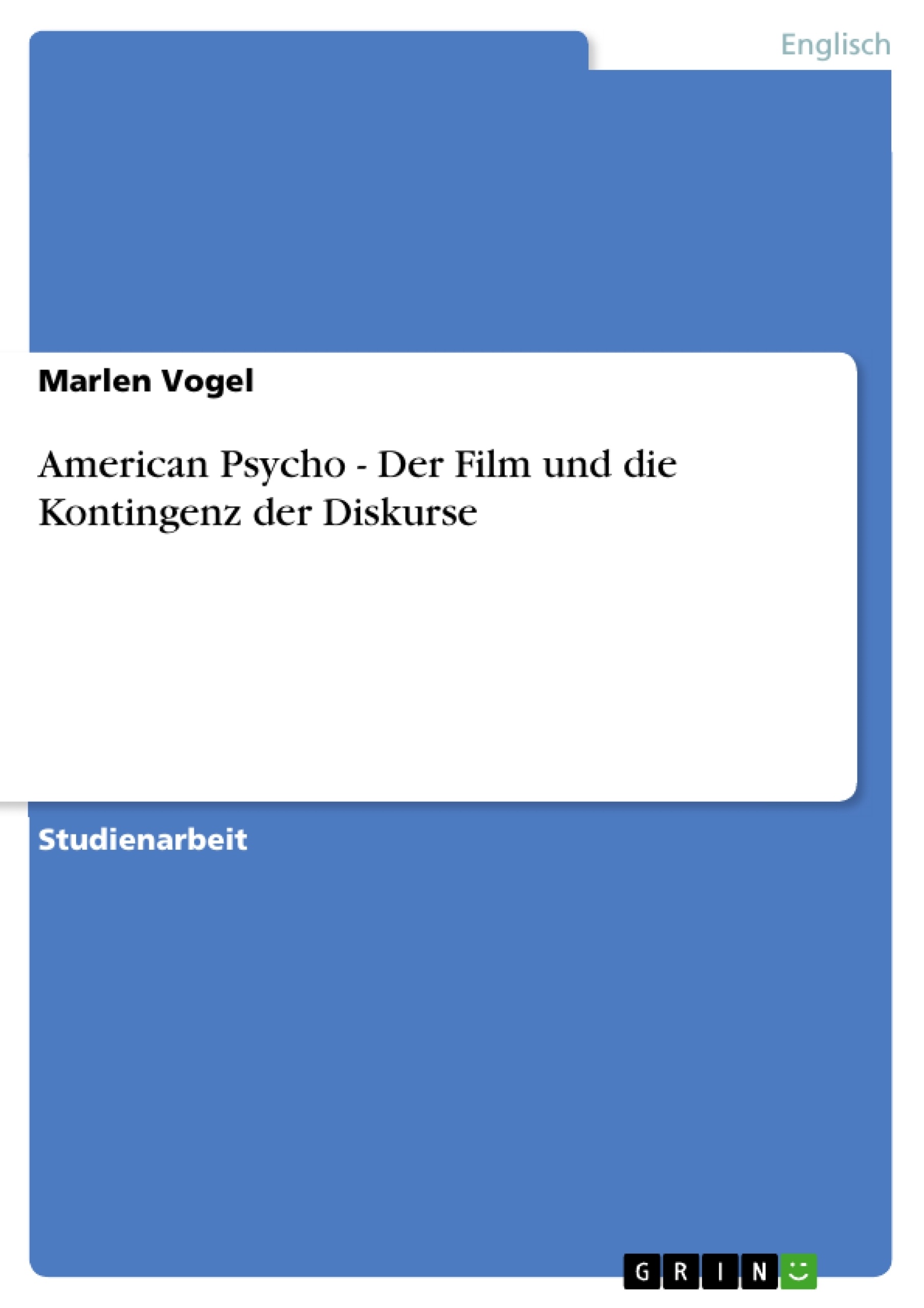Er ist Repräsentant einer Ära, die sich als eine Art soziale, sowie politische Subkultur etabliert hat. Als „Young Urban Professional“, kurz „Yuppie“, füllt die Figur des Patrick Bateman die erste Lücke, den ersten Definitionsraum, in dem Existenz- innerhalb des Szenarios von „American Psycho“- manifestiert wird. Sein diskursiver Werdegang ist ein Sprechen zweier Realitäten.
Die Einführung in die Handlung kreiert ein Bild, ein überspitztes Klischeebild, das explizit die kulturelle Bewegung ausstellt, die sich durch den Film als verlaufende Spur bis ins Perverse ausreizt. Die Annahme des urbanen Zeichensystems erfolgt von selbst. Es ist nicht Bateman selbst, der als agens fungiert. Der reziproke Prägungsprozess etabliert sich als Performativ. Bateman steht den Gepflogenheiten des Bankerlebens in nichts nach, fernerhin steht er ihnen gegenüber. Das Phänomen der Gegenüberstellung findet noch auf anderen Ebenen seine Realisierung, die die Diskurse zur Tiefe begehbar machen (Benjamin, Lacan et al.). Zu Beginn scheint es eine Spur, eine Prägung, einen Einschnitt zu geben, der sich hier als das urbane Gefüge ausstellt, in dem Bateman selbst eine Art Ornament darstellt. Auf der ersten Ebene ist er Repräsentant, eine Markierung, die sagt „Hier bin ich, das bin ich, ich bin diese Welt.“ Man erkennt hier also ein synekdochisches Verhältnis. Eine Synekdoche ist eine Trope auf der Ebene des Teiles vom Ganzen. Ein Teil repräsentiert das ganze den Zeichenprozessen unterliegende kulturelle System. Es soll gezeigt werden, dass der kontingente Charakter der Person Patrick Bateman sich in seiner Funktion als Synekdoche materialisiert.
Der Begriff der Kontingenz im Kontext von „American Psycho“ scheint eine Dimension zu verfassen, deren Ausleuchtung ganz und gar der Kamera überlassen ist. Kontingenz meint einen erahnten, halb “ausgesprochenen“ begrenzten Raum, in dem mehrere Subsysteme möglich sind, diese Möglichkeiten jedoch permanent bestehen bleiben. Der Begriff des Subsystems ist hier angebracht, da die Möglichkeiten durch Leerstellen markiert werden und somit als Diskurse zum Vorschein kommen, welche nach ihren eigenen autonomisierten Regelwerken funktionieren. Die Ausstellung der Diskurse erfolgt explizit, das, was an der Oberfläche bleibt, wird fasst pornografisch, provokant ausgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Diskurs als Sprechakt
- „American Psycho“ und die technische Reproduzierbarkeit
- Gesten technischer Reproduzierbarkeit
- Verlust der Aura
- Vom Kultwert zum Ausstellungswert
- Bedeutung des Films
- Die neue Dimension des Narziss
- Narziss und die Metamorphose
- Exkurs: Lacan und das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion
- Versuch einer Positionierung von „moi“ und „je“ im Film „American Psycho“
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Film „American Psycho“ im Hinblick auf die Darstellung von Diskursen und die Kontingenz der Identität der Hauptfigur Patrick Bateman. Es wird analysiert, wie Batemans Persönlichkeit und Handlungen durch die Wechselwirkung verschiedener sozialer und kultureller Diskurse geprägt sind. Der Fokus liegt auf der Dekonstruktion der scheinbar festen Identität Batemans und der Untersuchung der Mehrdeutigkeit seiner Darstellung.
- Die Darstellung von Diskursen im Film „American Psycho“
- Die Kontingenz der Identität von Patrick Bateman
- Die Rolle der technischen Reproduzierbarkeit
- Der Narzissmus als zentrales Thema
- Die Synekdoche als literarisches Stilmittel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Kontingenz der Diskurse und der Identität von Patrick Bateman in "American Psycho" vor. Sie positioniert den Film als Repräsentant einer spezifischen soziokulturellen Ära und der "Yuppie"-Kultur der 80er Jahre. Die Einführung des Protagonisten als "Synekdoche" für ein komplexes kulturelles System wird bereits hier angedeutet und als zentrales Untersuchungsobjekt präsentiert.
Der Diskurs als Sprechakt: Dieses Kapitel analysiert die zwei zentralen Diskurse im Film: den Diskurs des Banker-Milieus und den Diskurs des Psychopathen. Es wird gezeigt, wie diese Diskurse nebeneinander existieren, ohne sich vollständig zu vereinbaren oder zu widersprechen. Die Präsentation der High-Society-Welt im Film wird als oberflächlich und symbolisch beschrieben, wobei die äußere Erscheinung der Figuren im Vordergrund steht und die innere Welt verborgen bleibt. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz und der Mehrdeutigkeit der dargestellten Diskurse, die durch die filmische Inszenierung betont werden.
„American Psycho“ und die technische Reproduzierbarkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der technischen Reproduzierbarkeit als Mittel der Darstellung und ihrer Bedeutung für die Interpretation des Films. Es werden Aspekte wie der "Verlust der Aura" und die Transformation von "Kultwert" zu "Ausstellungswert" im Kontext des Films untersucht. Die Analyse betont die Rolle der Medien und der medialen Repräsentation in der Konstruktion von Identität und Realität. Die Wiederholung von Motiven und die Spiegelungen im Film werden als Ausdruck eines "mise en abyme" interpretiert, das die komplexe Struktur der dargestellten Wirklichkeit hervorhebt.
Die neue Dimension des Narziss: Dieses Kapitel beleuchtet die Thematik des Narzissmus im Film. Es wird auf die Metamorphose der Figur Patrick Bateman eingegangen und der Bezug zu Lacans Spiegelstadium hergestellt, um das Bild der Ich-Funktion zu analysieren. Die Analyse des "moi" und "je" in Bezug auf Batemans Persönlichkeit und Handlungen soll die Komplexität seines psychischen Zustands verdeutlichen. Die Untersuchung der Selbstinszenierung Batemans vor dem Spiegel als Reflexion seines inneren Konflikts wird als Schlüssel zur Interpretation seines Verhaltens präsentiert.
Schlüsselwörter
American Psycho, Diskursanalyse, Kontingenz, Identität, Narzissmus, technische Reproduzierbarkeit, Synekdoche, Yuppie-Kultur, Mise en abyme, Lacan, Spiegelstadium, Filmsprache.
Häufig gestellte Fragen zu "American Psycho": Eine Diskursanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Film "American Psycho" im Hinblick auf die Darstellung von Diskursen und die Kontingenz der Identität der Hauptfigur Patrick Bateman. Es wird untersucht, wie Batemans Persönlichkeit und Handlungen durch die Wechselwirkung verschiedener sozialer und kultureller Diskurse geprägt sind. Ein Schwerpunkt liegt auf der Dekonstruktion der scheinbar festen Identität Batemans und der Untersuchung der Mehrdeutigkeit seiner Darstellung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Diskursen im Film, der Kontingenz der Identität von Patrick Bateman, der Rolle der technischen Reproduzierbarkeit, dem Narzissmus als zentrales Thema und der Synekdoche als literarisches Stilmittel. Der Film wird als Repräsentant einer spezifischen soziokulturellen Ära und der "Yuppie"-Kultur der 80er Jahre betrachtet.
Welche Diskurse werden im Film analysiert?
Es werden der Diskurs des Banker-Milieus und der Diskurs des Psychopathen analysiert. Die Arbeit zeigt, wie diese Diskurse nebeneinander existieren, ohne sich vollständig zu vereinbaren oder zu widersprechen. Die Präsentation der High-Society-Welt wird als oberflächlich und symbolisch beschrieben, wobei die äußere Erscheinung der Figuren im Vordergrund steht und die innere Welt verborgen bleibt. Die Ambivalenz und Mehrdeutigkeit der dargestellten Diskurse stehen im Fokus.
Welche Rolle spielt die technische Reproduzierbarkeit?
Die Arbeit untersucht die technische Reproduzierbarkeit als Mittel der Darstellung und ihre Bedeutung für die Interpretation des Films. Aspekte wie der "Verlust der Aura" und die Transformation von "Kultwert" zu "Ausstellungswert" werden im Kontext des Films untersucht. Die Rolle der Medien und der medialen Repräsentation in der Konstruktion von Identität und Realität wird hervorgehoben. Wiederholungen von Motiven und Spiegelungen werden als "mise en abyme" interpretiert.
Wie wird der Narzissmus im Film behandelt?
Das Kapitel über den Narzissmus beleuchtet die Metamorphose von Patrick Bateman und bezieht Lacans Spiegelstadium ein, um die Ich-Funktion zu analysieren. Die Analyse von "moi" und "je" soll die Komplexität seines psychischen Zustands verdeutlichen. Die Selbstinszenierung Batemans vor dem Spiegel wird als Reflexion seines inneren Konflikts und als Schlüssel zur Interpretation seines Verhaltens präsentiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel über den Diskurs als Sprechakt, ein Kapitel über "American Psycho" und die technische Reproduzierbarkeit, ein Kapitel über die neue Dimension des Narzissmus und eine Konklusion. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: American Psycho, Diskursanalyse, Kontingenz, Identität, Narzissmus, technische Reproduzierbarkeit, Synekdoche, Yuppie-Kultur, Mise en abyme, Lacan, Spiegelstadium, und Filmsprache.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach der Kontingenz der Diskurse und der Identität von Patrick Bateman in "American Psycho".
- Quote paper
- Marlen Vogel (Author), 2006, American Psycho - Der Film und die Kontingenz der Diskurse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65928