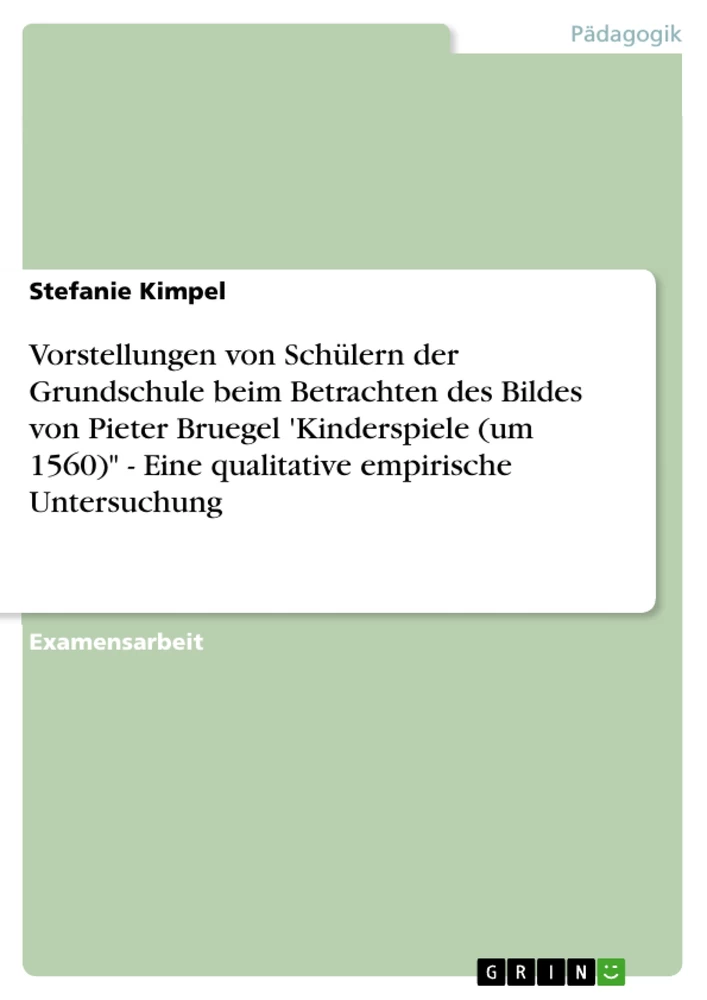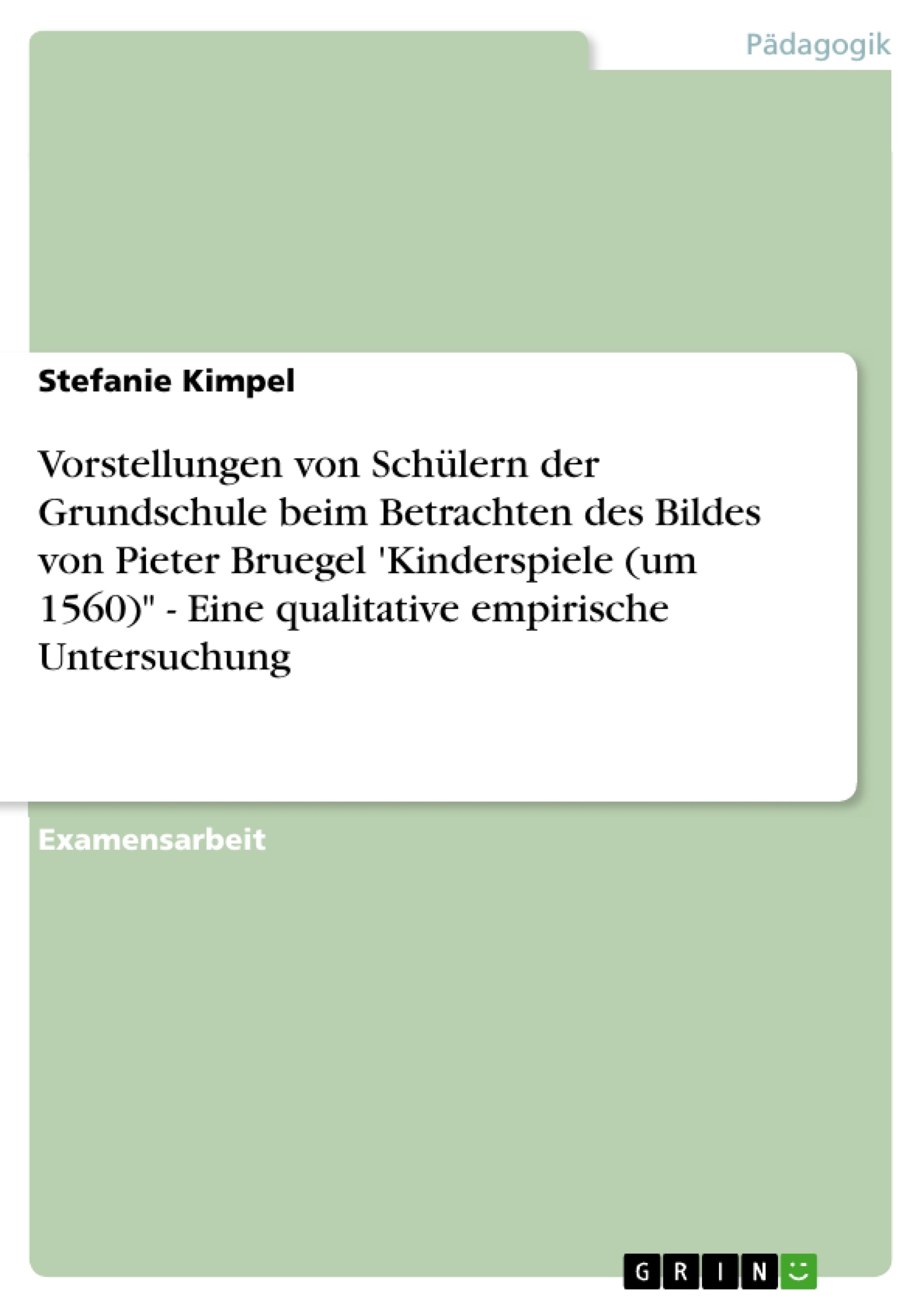Der Perspektivrahmen Sachunterricht fordert innerhalb des historischen Lernens die Kompetenz zu erlangen, zu „Erkennen, dass unser Wissen von der Geschichte von überlieferten Quellen abhängt und dass das bei der Auswertung der Quellen entstehende Wissen kein genaues Abbild vergangenen Geschehens ist, sondern immer nur eine vorläufige, begrenzte, perspektivische Annäherung an die damalige Wirklichkeit sein kann.“
Dieses einleitende Zitat spricht bereits Probleme an, die durch die Beschäftigung mit historischen Quellen entstehen können und beim Umgang mit ihnen berücksichtigt werden müssen. Doch wie soll diese Kompetenz erlangt werden, wenn nicht klar ist, wie man angemessen mit historischen Quellen umgehen sollte und vor allem wie Kinder der Grundschule Quellen und Darstellungen überhaupt wahrnehmen und aus ihnen lernen?
Zu fordern wäre also, dass die Geschichtsdidaktik über empirische Daten zur Bildwahrnehmung von SchülerInnen verfügen muss, um zu einer Optimierung der Bildarbeit im Unterricht zu gelangen. Gegenwärtig existiert nur eine ältere Untersuchung von Kurt Fina aus dem Jahre 1974, die sich mit der Bildwahrnehmung von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt.
Ziel dieser Arbeit soll es deshalb sein, aufbauend auf den Ergebnissen vorheriger Examensarbeiten zu diesem Thema, empirische Daten zu: „Vorstellungen von Kindern der Grundschule beim Betrachten des Bildes von Pieter Bruegel ‚Kinderspiele (um 1560)‛“ , zu liefern. Die Untersuchungen bewegen sich auf einer untersten Stufe, die dem Fernziel folgen, eine methodische Optimierung der Bildarbeit im historischen Lernen zu erreichen. Allerdings wird hier ein Schritt weitergegangen und nicht mehr nur gefragt, was und wie SchülerInnen wahrnehmen, wenn sie eine historische Bildquelle vorgelegt bekommen, sondern es wird danach gefragt, wie man diese Wahrnehmung möglicherweise beeinflussen kann. Es wird also nicht nur das Bild vorgelegt und dazu erzählt, sondern die Kinder erhalten Zusatzinformationen durch eine Bildunterschrift.
Des Weiteren werden fünf von zehn Befragten sogenannte Erschließungsfragen gestellt. Durch diese Methode, die emotionale Kanäle öffnen soll, wird in einem ersten Schritt der Versuch unternommen herauszufinden, in welcher Art und Weise die Kinder mit dieser Methode umgehen, inwieweit die Wahrnehmung möglicherweise beeinflusst und gelenkt werden kann. Werden überhaupt emotionale Bezüge zum Bild hergestellt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Historische Bildquellen im Unterricht der Grundschule
- Zum Umgang mit Bildquellen im Unterricht
- Handlungsorientierte Verfahren
- Das Bild im Schulgeschichtsbuch
- Die Bildunterschrift/ Bildlegende
- Forderungen und Ausblick
- Psychologische Erkenntnisse/ Aspekte verschiedener Disziplinen zur Bildwahrnehmung
- Das Bildverstehen
- Ökologisches vs. Indikatorisches Bildverstehen
- Gelenkte Wahrnehmung? Bild und Bildunterschrift sowie die Vervollständigung von Sätzen
- Empirischer Teil
- Untersuchungsbeschreibung
- Bisherige Ergebnisse empirischer Untersuchungen
- Rahmenbedingungen der Interviews
- Interviewmethode
- Interviewphase 1: Gruppe Lautes Denken
- Interviewphase 1: Gruppe Gedankenstichproben
- Interviewphase 2: Nachfrageteil
- Gegenstand der Interviews: Pieter Bruegel: „Kinderspiele“
- Pieter Bruegel der Ältere
- Gemälde
- „Kinderspiele (um 1560)“
- Auswertungsstrategie
- Auswertung der Interviews
- Interpretation der Einzelinterviews
- Interview I
- Interview II
- Interview III
- Interview IV
- Interview V
- Interview VI
- Interview VII
- Interview VIII
- Interview IX
- Interview X
- Kategorienbildung
- Die Methode des Sätzevervollständigens im Vergleich zu der Methode des „,lauten Denkens“
- Was passiert bevor auf die Bildunterschrift aufmerksam gemacht wird? Lenkt oder beeinflusst diese womöglich den Wahrnehmungsprozess?
- Was passiert nachdem auf die Bildunterschrift hingewiesen wird? Wurde sie überhaupt registriert?
- Wird das Bild zeitlich zugeordnet? Oder wurde durch das Datum innerhalb der Bildunterschrift ein Bezug zu einer Epoche ergestellt?
- Weitere Auffälligkeiten bezüglich der Bildwahrnehmung
- Abschlussbetrachtung
- Wahrnehmung von historischen Bildquellen durch Grundschüler
- Der Einfluss von Bildunterschriften auf die Bildwahrnehmung
- Die Rolle von Bildern im Geschichtsunterricht
- Methoden zur Analyse von Bildwahrnehmung
- Das Bild „Kinderspiele (um 1560)“ von Pieter Bruegel als Forschungsgegenstand
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die „Vorstellungen von Schülern der Grundschule beim Betrachten des Bildes von Pieter Bruegel „Kinderspiele (um 1560)““. Das Ziel der Arbeit ist es, empirische Daten zu liefern, die aufbauend auf früheren Arbeiten zum Thema der Bildwahrnehmung von Kindern, eine methodische Optimierung der Bildarbeit im historischen Lernen ermöglichen. Die Arbeit geht dabei einen Schritt weiter und fragt nicht nur, was und wie SchülerInnen wahrnehmen, sondern auch, wie diese Wahrnehmung möglicherweise beeinflusst werden kann. Die Untersuchung analysiert die Wirkung von zusätzlichen Informationen, die den Schülern durch eine Bildunterschrift vermittelt werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 und 3 bilden den theoretischen Teil der Arbeit. Kapitel 2 befasst sich mit historischen Bildquellen im Unterricht der Grundschule. Es analysiert bestehende Forschungsergebnisse zum Thema Bilder im Geschichtsunterricht und beleuchtet den Umgang mit diesen, beispielsweise durch handlungsorientierte Verfahren. Das Kapitel beleuchtet außerdem das Bild im Schulgeschichtsbuch und widmet der Bildunterschrift/Bildlegende besondere Aufmerksamkeit, da diese für die qualitative Untersuchung innerhalb der Arbeit von Bedeutung ist.
Kapitel 3 untersucht psychologische Erkenntnisse verschiedener Disziplinen zur Bildwahrnehmung. Es geht auf das Modell des Bildverstehens und zwei Modi des Bildverstehens, nämlich das ökologische sowie das indikatorische Bildverstehen ein. Vor allem die psychologische Sicht auf Bild und Bildunterschrift sowie die Vervollständigung von Sätzen werden innerhalb dieses Kapitels analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Untersuchungsbeschreibung. Es beschreibt die Grundlagen zu qualitativen Studien, die Methoden der Durchführung und Planung der Untersuchung. Außerdem wird näher auf den Gegenstand der Interviews, das Bild „Kinderspiele (um 1560)“ von Pieter Bruegel, eingegangen.
Kapitel 5 widmet sich der Auswertung der Interviews. Es interpretiert die Einzelinterviews und untersucht Kategorienbildung in Bezug auf die Methode des Sätzevervollständigens im Vergleich zu der Methode des „,lauten Denkens“ sowie die Auswirkungen der Bildunterschrift auf den Wahrnehmungsprozess.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie der Bildwahrnehmung von Grundschülern, dem Einfluss von Bildunterschriften, dem Umgang mit historischen Bildquellen im Unterricht und den methodischen Möglichkeiten der Bildarbeit im historischen Lernen. Die Untersuchung verwendet qualitative Methoden, insbesondere Interviewtechniken wie das „laute Denken“ und das Sätzevervollständigen, um Einblicke in die kognitive und emotionale Verarbeitung von Bildern durch Kinder zu gewinnen. Das Bild „Kinderspiele (um 1560)“ von Pieter Bruegel dient als Forschungsgegenstand und bietet einen Kontext für die Analyse der Bildwahrnehmung.
- Quote paper
- Stefanie Kimpel (Author), 2006, Vorstellungen von Schülern der Grundschule beim Betrachten des Bildes von Pieter Bruegel 'Kinderspiele (um 1560)" - Eine qualitative empirische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65883