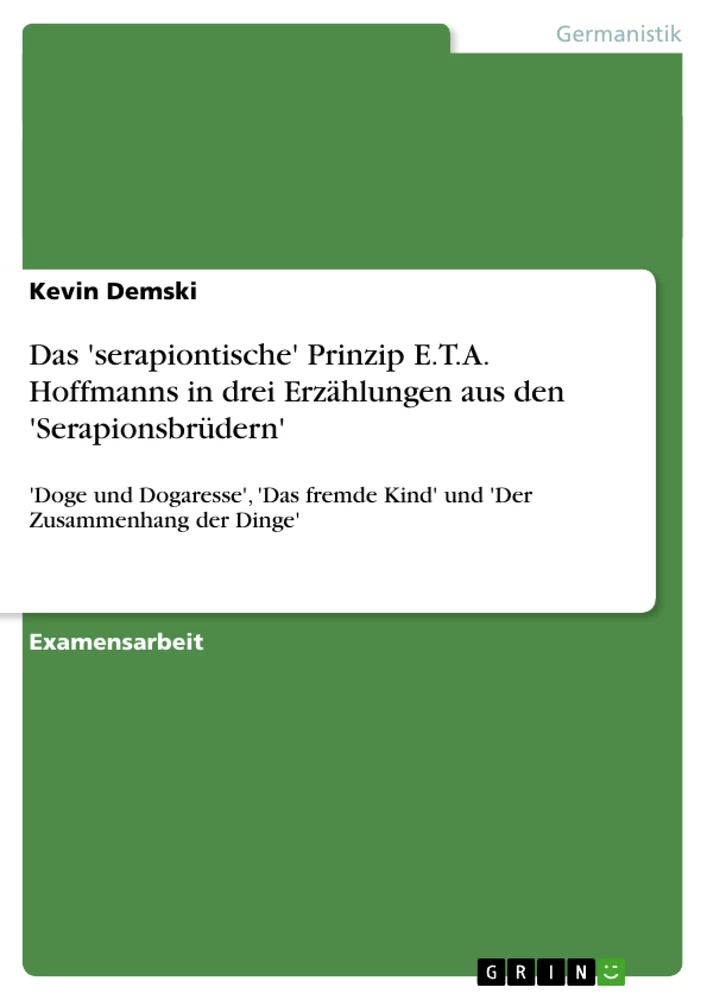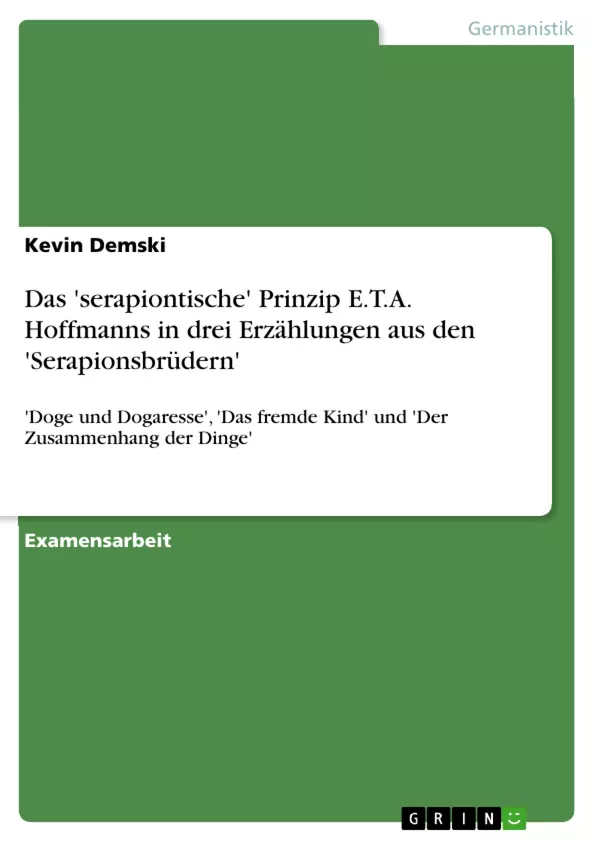Theodor, Ottmar und Cyprian waren darin einig, daß ohne alle weitere Abrede sich die literarische Tendenz von selbst bei ihren Zusammenkünften eingefunden haben würde und gaben sich das Wort der Regel des Einsiedlers Serapion, wie sie Lothar sehr richtig angegeben, nachzuleben, wie es nur in ihren Kräften stehe […]. (S. 70)
So heißt es an exponierter Stelle in E.T.A. Hoffmanns Erzählzyklus „Die Serapionsbrüder“, nachdem Cyprian von seinem „Einsiedler Serapion“ sowie Theodor vom „Rat Krespel“ berichtet haben und Lothar den Serapionsbrüdern schließlich folgenden Vorschlag unterbreitet: „sprechen wir von dem Serapionischen Prinzip!“ (Ebd.). Was unter diesem Prinzip eigentlich und genau zu verstehen ist, darüber wird in der Hoffmann-Forschung viel und anhaltend diskutiert. Einig ist man sich jedenfalls darin, dass es für E.T.A. Hoffmanns Auffassung vom Wesen und von den Aufgaben der Dichtung von zentraler Bedeutung ist.
Mit dem obigen Zitat aus dem Erzählzyklus ist auf die Schwierigkeiten, die für die Forschung aus der Befassung mit dem „serapiontischen“ Prinzip von jeher erwachsen, bereits hingewiesen: Hoffmann selbst verfasst keine eigene Poetik, vielmehr transportiert er sie über die Erzählungen und Unterhaltungen der fiktiven Serapionsbrüder. Schon deshalb erscheint es mir hinsichtlich eines möglichst soliden theoretischen Fundamentes unabdingbar, die poetologischen Äußerungen der Freunde stets rückbezüglich der beiden oben genannten poetologischen Erzählungen (auf deren Grundlage die Serapionsbrüder jenes „serapiontische“ Prinzip entwickeln) zu betrachten. Die sich mit dem Erzählprinzip beschäftigende Forschung nimmt nun zwar gelegentlich noch etwas ausführlicher den „Einsiedler Serapion“ in den Blick, „Rat Krespel“ wird daneben jedoch zumeist kaum bedacht.
Offenbar ist hierin auch ein Grund etwa für die Position Peter von Matts zu sehen, der das „serapiontische“ Prinzip als ein Bekenntnis zur „absolute[n] Autonomie der produktiven Einbildungskraft“ missversteht. Jochen Schmidt folgt ihm darin weitgehend.
In der Nachfolge von Wolfgang Preisendanz betont Wulf Segebrecht dagegen die Distanz, die zwischen „serapionischem“ und „serapiontischem“ Erzählen liegt. Für Segebrecht evoziert das „serapiontische“ Prinzip fernerhin notwendig die Frage, wie „erlebte Wirklichkeit“ Dichtungscharakter gewinnen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlegung in „gemütlicher“ Runde: Ein Versuch über das „serapiontische“ Prinzip
- Der analytische Blick auf die Erzählungen „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“ oder Zur Entwicklung eines Erzählprinzips
- „Der Einsiedler Serapion“. Ein auf die innere Schau beschränkter Poet
- „Rat Krespel“. Von der Duplizität des Daseins und dem Geheimnis der Kunst
- Das Fundament oder Die Vorbedingungen „serapiontischen“ Erzählens: Vom wirklichen Schauen, von der Duplizität des Daseins und vom ordnenden Verstand
- Niemals schlechtes Machwerk: Poetologische Merkmale „serapiontischen“ Erzählens
- Durch feine Fäden fest zusammengehalten. Zur Integration in der „serapiontischen“ Erzählung.
- Lebendigkeit oder Über das „Ins-Leben-Treten“
- Mystifikation: Was der „historische Besen“ für den geneigten Leser übrig lässt.
- Das Prädikat „serapiontisch“ – Zur komplexen Poetik der Serapionsbrüder
- Exkurs: Ironie und Humor - Dualismus und Duplizität
- Zur Umsetzung des „serapiontischen“ Prinzips in drei ausgewählten Erzählungen aus den „Serapionsbrüdern“
- „Doge und Dogaresse“
- Text und Bild - Die Erzählung eines Gemäldes.
- Das „redende Gespenst aus der Vorzeit“.
- Annunziata, Antonio und der Doge – Ikonographie und Karikatur
- Zu Margaretha... diesem „seltsamen Bettelweib“
- Über das „eigensinnig tolle Ding“
- Kolbes Gemälde „tritt ins Leben“
- Vom retardierenden Moment zur Katastrophe
- Die Auflösung der Perspektive – Verlust des Zentrums?
- Eine „serapiontische“ Bild-Interpretation
- „Das fremde Kind“
- „Es war einmal“……
- Der große hagere Mann“ aus der Stadt
- Thaddäus von Brakel: „Lasse die Kinder nur gewähren“
- Herrmann und Adelgunde als „kleine Roboter des Wissens“
- Wider das steife Zeremoniell von Onkel und Tante. Felix und Christlieb
- Pepasilio – Gnomenkönig Pepser - Magister Tinte. Wenn ein „serapiontischer“ Hofmeister „ins Leben tritt“...
- Über das „seltsame Wunderkind“
- Dramaturgie und Uneindeutigkeit
- Der Wald als „fester Kern“
- „Der Zusammenhang der Dinge“
- „medias in res“ – Zwei Freunde und zwei Thesen
- Der „wahre Ausbund von Bildung“ mit seinem „kurzen Gesicht“
- Von den „Torheiten“ der Gesellschaft
- Euchar - Edgar
- Emanuela und der Talisman - Euchars „Angelegenheit“
- Über die Präsidentin
- Ein doppelter „Zusammenhang der Dinge“.
- Literatur und Wirklichkeit - wen man so Edgar nennt...
- Der „über uns, in uns waltende höhere Geist“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht E.T.A. Hoffmanns „serapiontisches Prinzip“, wie es in seinen Erzählungen „Doge und Dogaresse“, „Das fremde Kind“ und „Der Zusammenhang der Dinge“ aus den „Serapionsbrüdern“ zum Ausdruck kommt. Ziel ist es, das Prinzip zu definieren und seine Umsetzung in den ausgewählten Erzählungen zu analysieren.
- Definition des „serapiontischen Prinzips“ in Hoffmanns Werk
- Analyse der poetologischen Aspekte des Prinzips
- Untersuchung der Umsetzung des Prinzips in den drei ausgewählten Erzählungen
- Beziehung zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit in den Erzählungen
- Rolle von Ironie und Humor im „serapiontischen“ Erzählen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des „serapiontischen Prinzips“ bei E.T.A. Hoffmann ein und skizziert die Schwierigkeiten seiner Definition aufgrund des Mangels an einer expliziten Poetik des Autors. Sie hebt die Bedeutung der Erzählungen „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“ als Grundlage für die Entwicklung des Prinzips hervor und weist auf unterschiedliche Interpretationen in der Forschung hin. Der Fokus der Arbeit auf die Analyse dreier ausgewählter Erzählungen wird begründet.
Theoretische Grundlegung in „gemütlicher“ Runde: Ein Versuch über das „serapiontische“ Prinzip: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des „serapiontischen Prinzips“ anhand der Erzählungen „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“. Es analysiert die poetologischen Ansätze, die Hoffmann durch die Figuren und deren Gespräche vermittelt. Die Kapitel untersuchen die Bedeutung von innerer Schau, der Duplizität des Daseins, dem ordnenden Verstand und der Integration von Wirklichkeit und Fiktion im „serapiontischen“ Erzählen. Der Abschnitt über Ironie und Humor beleuchtet deren Funktion im Kontext des Prinzips.
Zur Umsetzung des „serapiontischen“ Prinzips in drei ausgewählten Erzählungen aus den „Serapionsbrüdern“: Dieses Kapitel analysiert die Anwendung des „serapiontischen Prinzips“ in den drei Erzählungen „Doge und Dogaresse“, „Das fremde Kind“ und „Der Zusammenhang der Dinge“. Es untersucht, wie Hoffmann in jeder Erzählung die Integration von Wirklichkeit und Fiktion, innere und äußere Welten, sowie die Rolle von Ironie und Humor umsetzt. Die Analyse deckt die spezifischen Merkmale auf, die jede Erzählung als Beispiel „serapiontischen“ Erzählens auszeichnen.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Serapionsbrüder, serapiontisches Prinzip, Poetik, Erzählkunst, Innere Schau, Duplizität des Daseins, Wirklichkeit und Fiktion, Ironie, Humor, Bildinterpretation, Romantik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des „serapiontischen Prinzips“ bei E.T.A. Hoffmann
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns „serapiontisches Prinzip“, wie es in seinen Erzählungen „Doge und Dogaresse“, „Das fremde Kind“ und „Der Zusammenhang der Dinge“ aus den „Serapionsbrüdern“ zum Ausdruck kommt. Ziel ist die Definition und Analyse der Umsetzung dieses Prinzips in den ausgewählten Erzählungen.
Wie wird das „serapiontische Prinzip“ definiert?
Die Arbeit definiert das „serapiontische Prinzip“ durch die Analyse der Erzählungen „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“. Es werden poetologische Aspekte wie innere Schau, Duplizität des Daseins, der ordnende Verstand und die Integration von Wirklichkeit und Fiktion untersucht, um das Prinzip zu erfassen. Die Rolle von Ironie und Humor wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Erzählungen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei Erzählungen aus den „Serapionsbrüdern“: „Doge und Dogaresse“, „Das fremde Kind“ und „Der Zusammenhang der Dinge“. Jede Erzählung wird hinsichtlich der Umsetzung des „serapiontischen Prinzips“ analysiert, wobei die spezifischen Merkmale und die Integration von Wirklichkeit und Fiktion im Vordergrund stehen.
Welche Aspekte der Erzählungen werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Integration von Wirklichkeit und Fiktion, die Beziehung zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit, die Rolle von Ironie und Humor, sowie die spezifischen Merkmale jeder Erzählung, die sie als Beispiele „serapiontischen“ Erzählens auszeichnen. Im Fall von „Doge und Dogaresse“ wird auch die Bildinterpretation eine Rolle spielen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur theoretischen Grundlegung des „serapiontischen Prinzips“, ein Kapitel zur Umsetzung des Prinzips in den drei ausgewählten Erzählungen und ein Kapitel mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Einleitung skizziert die Thematik und die Herausforderungen bei der Definition des Prinzips. Das Kapitel zur theoretischen Grundlegung verwendet „Der Einsiedler Serapion“ und „Rat Krespel“ als Grundlage. Das Hauptkapitel analysiert detailliert die drei ausgewählten Erzählungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E.T.A. Hoffmann, Serapionsbrüder, serapiontisches Prinzip, Poetik, Erzählkunst, Innere Schau, Duplizität des Daseins, Wirklichkeit und Fiktion, Ironie, Humor, Bildinterpretation, Romantik.
Wo findet man detaillierte Informationen zum „serapiontischen Prinzip“ in den einzelnen Erzählungen?
Detaillierte Analysen der drei ausgewählten Erzählungen („Doge und Dogaresse“, „Das fremde Kind“, „Der Zusammenhang der Dinge“) finden sich im Kapitel „Zur Umsetzung des „serapiontischen“ Prinzips in drei ausgewählten Erzählungen aus den „Serapionsbrüdern““. Dieses Kapitel untersucht die Anwendung des Prinzips in jeder Erzählung einzeln und hebt die spezifischen Merkmale hervor.
Welche Rolle spielen Ironie und Humor in Hoffmanns „serapiontischem“ Erzählen?
Die Rolle von Ironie und Humor wird sowohl im Kapitel zur theoretischen Grundlegung als auch in der Analyse der einzelnen Erzählungen untersucht. Sie werden als wichtige Elemente des „serapiontischen Prinzips“ betrachtet und ihre Funktion im Kontext der Erzählungen wird analysiert.
- Arbeit zitieren
- Kevin Demski (Autor:in), 2006, Das 'serapiontische' Prinzip E.T.A. Hoffmanns in drei Erzählungen aus den 'Serapionsbrüdern', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65784