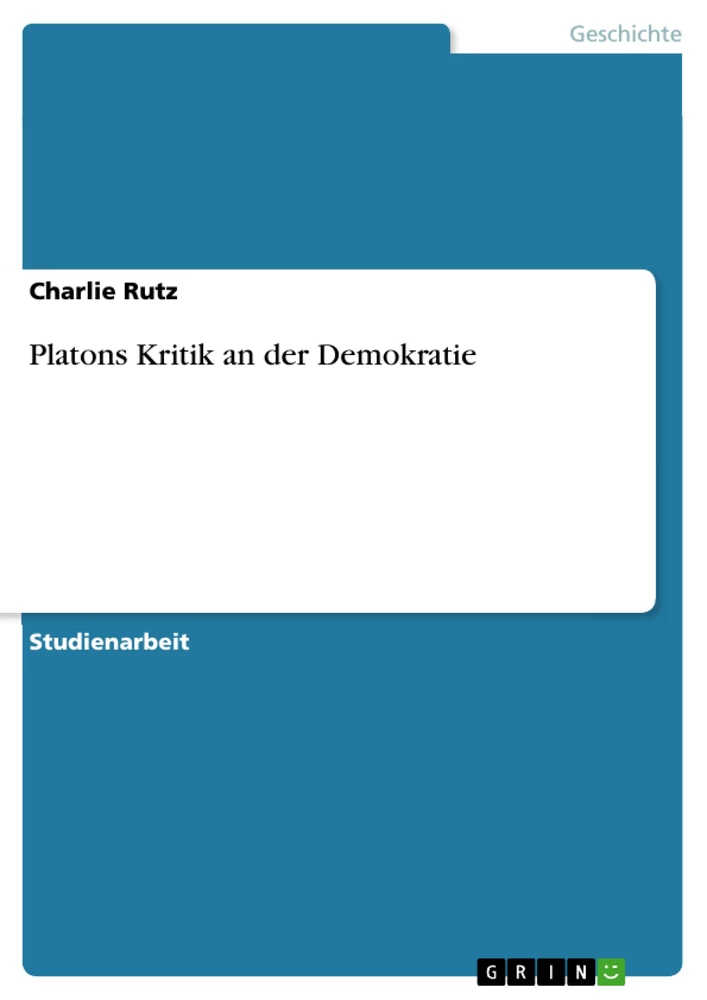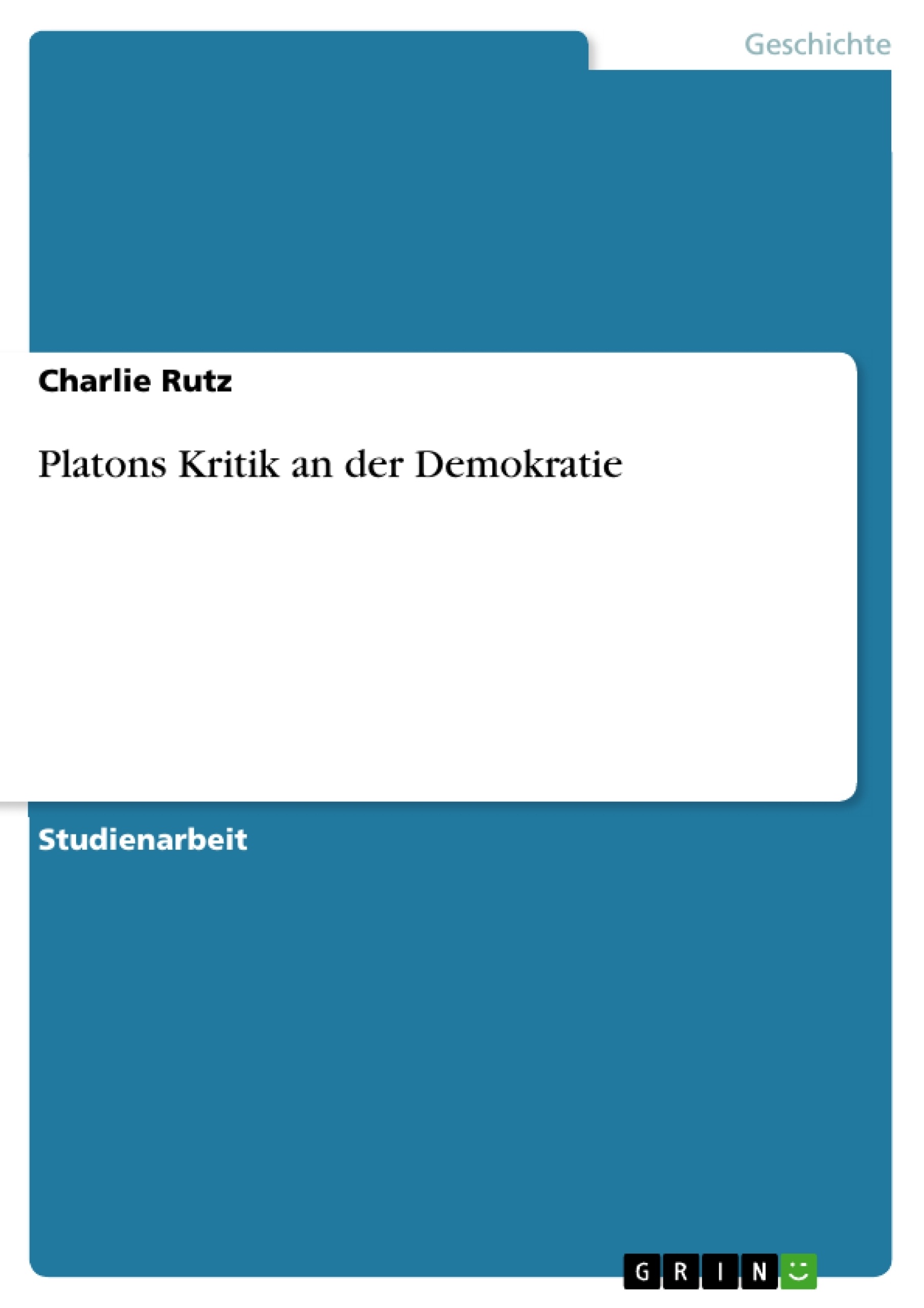Perikles, der im 5. Jahrhundert v.Chr. als langjähriger Stratege maßgeblich die Politik der attischen Demokratie mitbestimmt hatte, soll die Demokratie als Volksherrschaft beschrieben haben, wo der „Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf eine größere Zahl gestellt ist.“ Damit benannte er die sowohl in antiker als auch moderner Zeit wohl grundsätzlichsten Wesensmerkmale der Demokratie: die Volksherrschaft und das Prinzip der Mehrheitsherrschaft. Doch so unbestritten diese allgemeinen Prinzipien dem Begriff der Demokratie innewohnen, so unterschiedlich sind und waren bis in die heutige Zeit hinein die Auffassungen darüber, wie diese Volks- und Mehrheitsherrschaft denn auszuüben ist. Und natürlich gibt und gab es auch immer wieder Menschen, die das Wesen und Prinzip der Demokratie nicht nur kritisier(t)en, sondern auch infragestell(t)en. Ein scharfer Kritiker der attischen Demokratie war der griechische Philosoph Platon. In seinem Werk Politikos bezeichnete er die Demokratie als Regierung der Menge, die „mit Gewalt oder mit ihrem guten Willen [...] über die, welche das Vermögen in Händen haben“, regiert [Politikos 291d-292a]. In dieser geschichtsphilosophischen Arbeit wird hinterfragt, was genau Platon unter dem Demokratiebegriff verstand und was ihn zum Kritiker der Demokratie werden ließ.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Kurze Skizzierung der antiken Persönlichkeit Platon
- Siebter Brief – Fälschung oder authentisches Dokument?
- Politeia - Auf der Suche nach der richtigen Staatsverfassung
- Demokratiebegriff und Demokratie-Kritik bei Platon
- Die möglichen Ursachen für Platons Demokratiekritik
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In dieser Arbeit wird Platons Kritik an der Demokratie untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, was Platon zur Kritik an der Demokratie veranlasste und wie er den Begriff der Demokratie selbst verstand. Die Arbeit beleuchtet auch Platons Rückzug aus der Politik und seine Rolle in der attischen Demokratie, insbesondere im Lichte des Siebten Briefes, der als eine Art Selbstbiografie interpretiert werden kann.
- Platons Kritik an der attischen Demokratie
- Platons Verständnis von Demokratie
- Der Siebte Brief als Selbstbiographie
- Platons Rolle in der Politik
- Der Einfluss von Sokrates auf Platons Denken
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Fragestellung und die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie führt in die Thematik der Demokratie-Kritik Platons ein und stellt die Relevanz des Siebten Briefes im Kontext seiner Selbstbiographie heraus.
- Kurze Skizzierung der antiken Persönlichkeit Platon: Dieses Kapitel skizziert Platons Leben und Wirken, insbesondere seinen Einfluss auf die Philosophie und seine Beziehung zu Sokrates. Es beleuchtet Platons Entscheidung, sich aus der Politik zurückzuziehen, die durch seine Erfahrungen mit der Herrschaft der Dreißig und der attischen Demokratie beeinflusst wurde.
- Siebter Brief – Fälschung oder authentisches Dokument?: Dieses Kapitel diskutiert die Authentizität des Siebten Briefes als Selbstbiographie und beleuchtet seine Bedeutung als Quelle für Platons politische Ansichten und seine Motivationen, sich aus der Politik zurückzuziehen. Die Debatte um die Echtheit des Briefes wird beleuchtet und seine Rolle als politisches Sendschreiben und Rechtfertigung für Platons Handeln in Syrakus wird untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Platons Kritik an der Demokratie, dem Siebten Brief, der attischen Demokratie, Platons politischer Karriere, Platons Verhältnis zu Sokrates und dem Einfluss von Platons Denken auf die Philosophie.
- Quote paper
- Charlie Rutz (Author), 2006, Platons Kritik an der Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65746