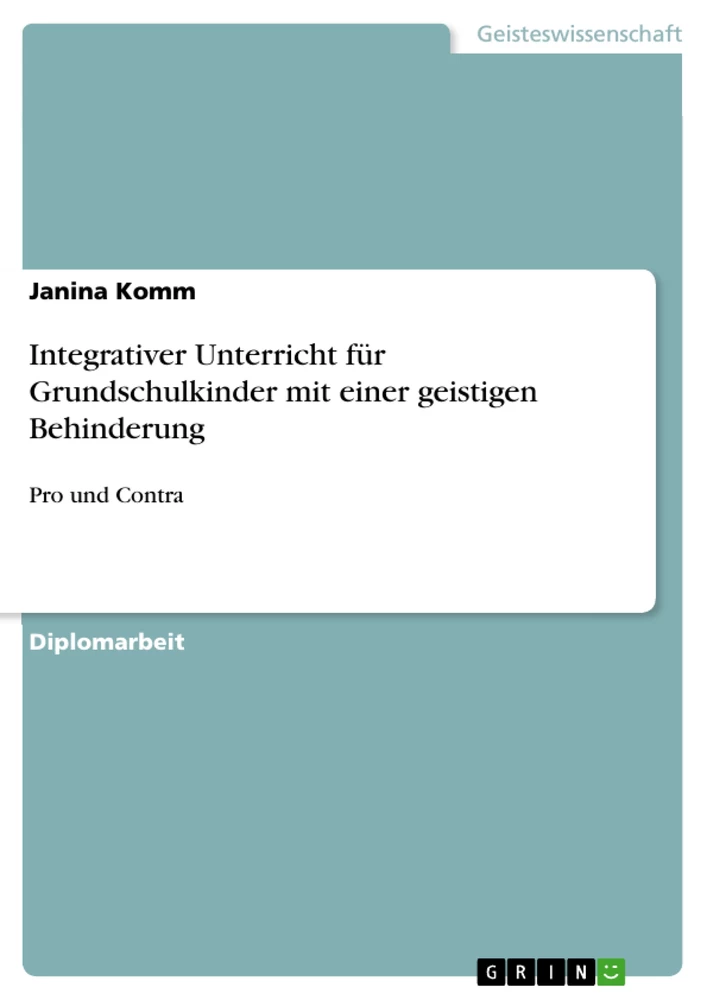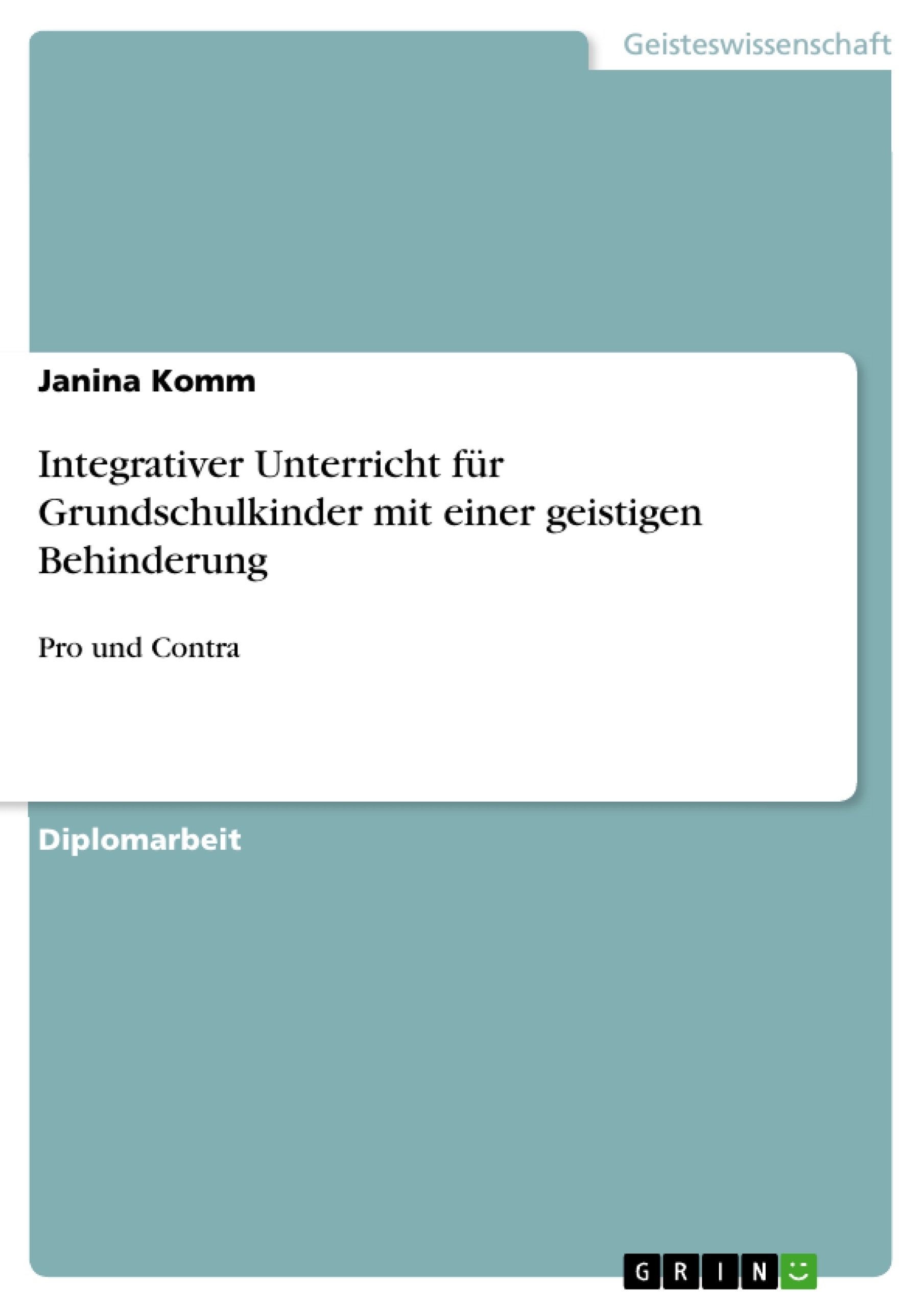„Der Begriff ‚Integrationspädagogik’, d.h. die Theorie und Praxis des gemeinsamen Lernens, steht für eine neue Sichtweise zur Erziehung und Unterrichtung von Kindern mit Beeinträchtigung sowie für einen veränderten Auftrag in Vorschule und Schule.“(Eberwein & Knauer 2002, S. 17) Die aktuelle Debatte um das gemeinsame Lernen, also den integrativen Unterricht von Kindern mit und ohne „Behinderung“, greife ich in meiner Arbeit anhand der folgenden leitenden Fragestellung auf. Diese lautet: Integrativer Unterricht an der Grundschule oder Unterricht an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ für Kinder mit einer „geistigen Behinderung“? Weiterhin stellt sich für mich die Frage, wie integrativer Unterricht für alle Kinder mit einer „Behinderung“ egal welcher Art mit den heutigen Möglichkeiten realisiert werden kann, ohne das gegebenenfalls Benachteiligungen entstehen. Gerade die Gruppe der Kinder mit einer „geistigen Behinderung“ ist bislang sehr dürftig in die integrativen Grundschulklassen aufgenommen worden. Im Jahre 2003 besuchten in der Bundesrepublik Deutschland lediglich gut drei Prozent der gesamten Schülerinnen und Schüler mit einer „geistigen Behinderung“ den integrativen Unterricht. (weiteres dazu in Kapitel 7, Abschnitt 7.1) Hinzu kommt, dass Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“, „soziale und emotionale Entwicklung“ (ehemalige Schule für Erziehungshilfe) und „Sprache“ das Fernziel haben, ihre Schülerinnen und Schüler (wieder) in die Regelschule zu führen. Dagegen arbeitet die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ hauptsächlich mit dem Fernziel, seine Schülerinnen und Schüler auf das spätere Leben vorzubereiten.
Zurzeit fordern zahlreiche Integrations-Experten vehement, hier sind beispielhaft Eberwein und Feuser zu nennen, eine Integration von allen Kindern und Jugendlichen mit einer „Behinderung“. Da stellt sich für mich ebenfalls die Frage, wie eine Umsetzung bzw. was für Probleme bei der Umsetzung entstehen können. Weiterhin bleibt es fragwürdig, ob eine Integration für alle überhaupt in der jetzigen Gesellschaft realisierbar ist oder ob die finanziellen Mittel in den einzelnen Bundesländern ausreichen? Inwieweit bezieht sich das Studium der Sonderpädagogik auf den Bereich Integration und wird den Kindern mit einer „geistigen Behinderung“ genug Selbstbestimmung entgegengebracht?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff „geistige Behinderung“
- Soziale Integration
- Begriffsklärung
- Geschichte der sozialen Integration
- Soziale Integration heute
- Das Kind im Grundschulalter
- entwicklungspsychologische Sichtweisen
- sozialpsychologische Sichtweisen
- soziologische Sichtweisen
- institutionelle Sichtweisen
- pädagogische Sichtweisen
- Konzeptionelle Aspekte des Unterrichts an der Förderschule für Kinder mit einer „geistigen Behinderung“
- Curriculum
- Ziele
- Inhalte
- Methoden
- Schlussfolgerung und Bilanz
- Curriculum
- Konzeptionelle Aspekte des Unterrichts an Grundschulen
- Curriculum
- Ziele
- Inhalte
- Methoden
- Schlussfolgerung und Bilanz
- Curriculum
- Konzeptionelle Aspekte des integrativen Unterrichts an Grundschulen
- Curriculum
- Ziele
- Inhalte
- Methoden
- Schlussfolgerung und Bilanz
- Curriculum
- Pro und Contra des integrativen Unterrichts
- Vergleiche
- Pro
- Contra
- Folgen, Möglichkeiten und Grenzen
- Vergleiche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile des integrativen Unterrichts für Grundschulkinder mit geistiger Behinderung im Vergleich zum Unterricht an Förderschulen. Ziel ist es, die aktuelle Situation zu beleuchten und die Chancen und Herausforderungen der Integration für diese bislang benachteiligte Gruppe zu diskutieren. Die Arbeit analysiert die Curricula beider Schulformen und bewertet die Umsetzbarkeit und Wirkung des integrativen Unterrichts.
- Der Begriff „geistige Behinderung“ und seine Implikationen für den Unterricht.
- Soziale Integration und ihre Geschichte im Kontext von Bildung.
- Vergleich der Curricula von Grundschulen und Förderschulen.
- Analyse der Vor- und Nachteile des integrativen Unterrichts.
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Kindern mit geistiger Behinderung in den integrativen Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des integrativen Unterrichts für Kinder mit geistiger Behinderung ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Vor- und Nachteilen des integrativen Unterrichts gegenüber dem Unterricht an Förderschulen. Sie hebt die geringe Teilnahme von Kindern mit geistiger Behinderung am integrativen Unterricht hervor und benennt weitere Forschungsfragen bezüglich der Realisierbarkeit, finanzieller Mittel und der Selbstbestimmung der Kinder. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die Methodik.
Der Begriff „geistige Behinderung“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „geistige Behinderung“ und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Besonderheiten im Bildungskontext. Es legt die Grundlage für das Verständnis der spezifischen Bedürfnisse dieser Kindergruppe.
Soziale Integration: Dieses Kapitel behandelt den Begriff der sozialen Integration, seine historische Entwicklung und den aktuellen Stand der Diskussion. Es analysiert verschiedene Aspekte der Integration, von der Begriffsklärung bis hin zur gesellschaftlichen Umsetzung und den damit verbundenen Herausforderungen.
Das Kind im Grundschulalter: Der Abschnitt beleuchtet die entwicklungspsychologischen, sozialpsychologischen, soziologischen, institutionellen und pädagogischen Aspekte der Entwicklung von Grundschulkindern, insbesondere im Hinblick auf die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit geistiger Behinderung. Es stellt die notwendigen Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Lernen dar.
Konzeptionelle Aspekte des Unterrichts an der Förderschule für Kinder mit einer „geistigen Behinderung“: Dieses Kapitel analysiert die Curricula der Förderschulen für Kinder mit geistiger Behinderung, einschließlich der Ziele, Inhalte und Methoden. Es beleuchtet die spezifischen Lehrpläne und die pädagogischen Ansätze, die für diese Schulform charakteristisch sind.
Konzeptionelle Aspekte des Unterrichts an Grundschulen: Analog zum vorherigen Kapitel analysiert dieser Abschnitt die Curricula von Grundschulen, ihre Ziele, Inhalte und Methoden. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Vergleich zu Förderschulen.
Konzeptionelle Aspekte des integrativen Unterrichts an Grundschulen: Dieses Kapitel widmet sich den spezifischen Aspekten des integrativen Unterrichts an Grundschulen. Es beschreibt die Curricula, Ziele, Inhalte und Methoden, die für den inklusiven Unterricht relevant sind und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
Pro und Contra des integrativen Unterrichts: In diesem Kapitel werden die Vor- und Nachteile des integrativen Unterrichts für Kinder mit geistiger Behinderung ausführlich verglichen und gegeneinander abgewogen. Es werden sowohl die positiven Aspekte wie auch die potenziellen Herausforderungen und Probleme diskutiert.
Schlüsselwörter
Integrativer Unterricht, geistige Behinderung, inklusive Bildung, Förderschule, Grundschule, Curriculum, soziale Integration, Inklusion, Sonderpädagogik, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Integrativer Unterricht für Grundschulkinder mit geistiger Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile des integrativen Unterrichts für Grundschulkinder mit geistiger Behinderung im Vergleich zum Unterricht an Förderschulen. Sie beleuchtet die aktuelle Situation und diskutiert Chancen und Herausforderungen der Integration für diese Kinder.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Curricula von Grundschulen und Förderschulen, bewertet die Umsetzbarkeit und Wirkung des integrativen Unterrichts und behandelt den Begriff „geistige Behinderung“, soziale Integration und deren Geschichte im Bildungskontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung, Definition des Begriffs „geistige Behinderung“, sozialer Integration, der Entwicklung von Grundschulkindern, den Curricula von Förderschulen und Grundschulen, den konzeptionellen Aspekten des integrativen Unterrichts und einer Gegenüberstellung von Pro und Contra des integrativen Unterrichts.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, die aktuelle Situation des integrativen Unterrichts für Kinder mit geistiger Behinderung zu beleuchten und die Chancen und Herausforderungen der Integration zu diskutieren. Die Arbeit analysiert die Curricula beider Schulformen und bewertet die Umsetzbarkeit und Wirkung des integrativen Unterrichts.
Welche konkreten Fragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Realisierbarkeit des integrativen Unterrichts, die benötigten finanziellen Mittel, die Selbstbestimmung der Kinder und die Vor- und Nachteile des integrativen Unterrichts im Vergleich zum Unterricht an Förderschulen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einem strukturierten Aufbau mit Einleitung, Kapitel zur Begriffserklärung, Kapitel zur sozialen Integration, Kapitel zu den Entwicklungsaspekten von Grundschulkindern, Kapitel zur Analyse der Curricula von Förderschulen und Grundschulen, Kapitel zum integrativen Unterricht und einem abschließenden Kapitel mit Pro und Contra des integrativen Unterrichts.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Integrativer Unterricht, geistige Behinderung, inklusive Bildung, Förderschule, Grundschule, Curriculum, soziale Integration, Inklusion, Sonderpädagogik, Selbstbestimmung.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Methodik wird in der Einleitung der Arbeit beschrieben. Es wird ein Vergleich der Curricula und eine Analyse der Vor- und Nachteile des integrativen Unterrichts durchgeführt. Die genaue Methodik ist im Text detailliert dargestellt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Erzieher, Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung, Bildungspolitiker und alle, die sich mit inklusivem Bildungssystem auseinandersetzen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der vollständige Text mit detaillierten Ausführungen zu allen Aspekten findet sich im Hauptdokument.
- Quote paper
- Diplom Janina Komm (Author), 2006, Integrativer Unterricht für Grundschulkinder mit einer geistigen Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65693