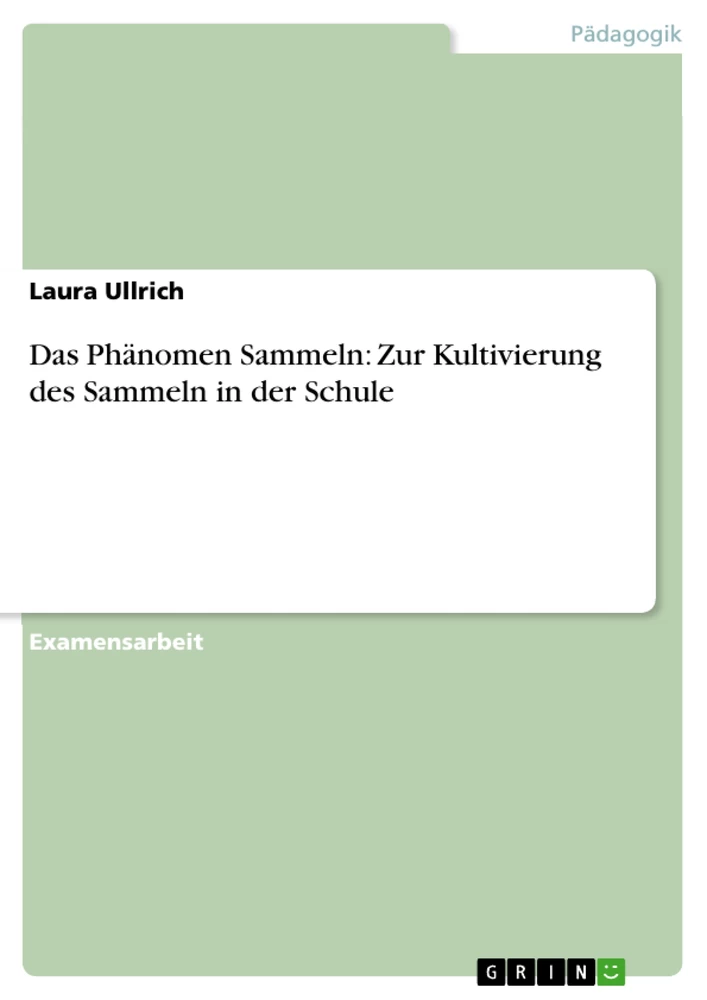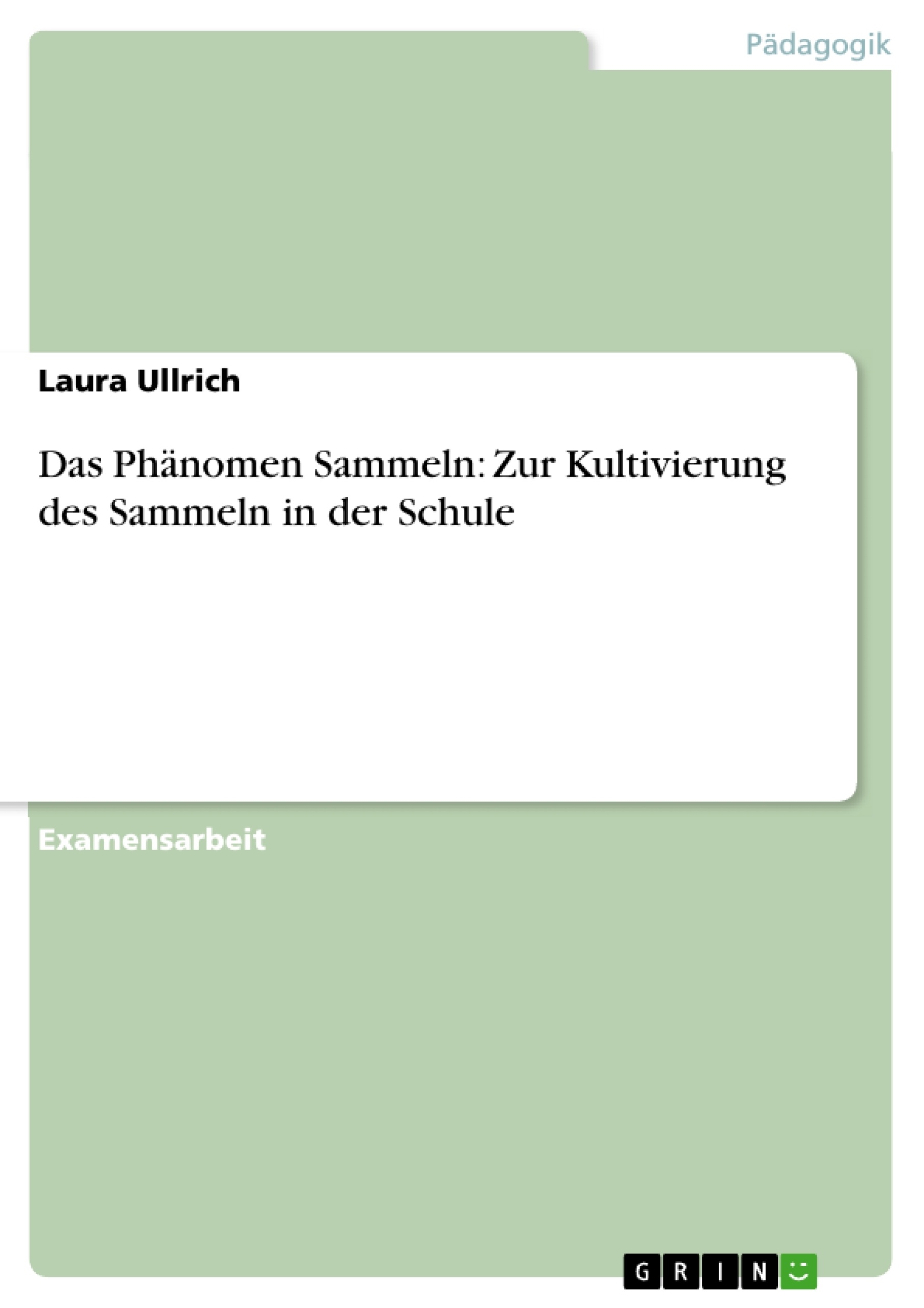Als Justus Jonas, der erste Detektiv der drei Fragezeichen, zu seinem Onkel auf den Schrottplatz zieht, hat der ihm ein Zimmer eingerichtet. Darin steht ein Bett mit einem angeschraubten Nachtkästchen, das sei für die Unterbringung seiner Sammlung gedacht, erklärt der Onkel. „Welche Sammlung“ fragt Justus. „Na, jeder sammelt doch irgendetwas, Schmetterlinge oder Käfer oder Modellautos“, antwortet sein Onkel. Der erste Detektiv muss lange überlegen bis ihm seine Sammlung einfällt: er sammelt mit seinen Detektivkollegen Fälle, also selbst gelöste Geheimnisse. Die werden dann zu den einzelnen Bänden und Kassetten der Serie Die drei Fragezeichen.
Als ich die Stelle mit dem Nachtschränkchen im ersten Buch der Detektivserie las, konnte ich nicht verstehen, warum Justus noch überlegen musste, was er sammelte. Mich beschäftigte daraufhin eher die Frage, welche meiner vielen Sammlungen Einzug in das Nachtschränkchen gehalten hätte. So ein „geheimer Ort“ in Bettnähe wäre mir sehr gelegen gekommen, um meine Kostbarkeiten aufzubewahren. Wahrscheinlich hätten mehrere Sammlungen darin Platz gefunden, denn zwar waren sie alle in meinen Augen kostbar, meist aber nur von geringer Größe. Mit einer Ausnahme, meiner Sammlung von Drei Fragezeichen Büchern und Kassetten.
Zum Stand der Forschung ist zu bemerken, dass allgemein bereits sehr viele Publikationen zum Sammeln veröffentlicht wurden. In der Kulturwissenschaft erschienen viele Beiträge über das Phänomen Sammeln, meist mit Konzentration auf einen historischen Typus der Sammlung: die Kunst- und Wunderkammer der frühen Neuzeit. Psychoanalytische Forschung zum Sammeln veröffentlichte Werner Muensterberger in seinem BuchSammeln. Eine unbändige Leidenschaft.Im Zuge meiner Recherchen bin ich auch auf eine große Anzahl philosophischer Abhandlungen zum Thema gestoßen. Nur mit dem Sammeln in der Kindheit und der schultheoretischen Bedeutung des Sammelns befasst sich lediglich eine nicht allzu große Menge an Zeitschriftenbeiträgen. Viele Publikationen zur pädagogischen Bedeutung des Sammelns beruhen, laut ihrer Autoren, auf Hypothesen oder Befragungen von SchülerInnen.
Das Sammeln hat der Menschheit vor der Sesshaftigkeit als Existenzsicherung gedient. Heute ist dies nur noch selten der Fall: es überwiegt der Bedeutungsaspekt der gesammelten Gegenstände vor dem Gebrauchsaspekt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Entwicklung des Phänomens Sammeln
- Anthropologie des Sammelns
- Geschichte
- Reliquienschätze des 12. – 15. Jahrhunderts
- Die Kunst- und Wunderkammern des 15.-18. Jahrhunderts
- Bürgerliche Sammlungen und erste öffentliche Museen des 18. – 19. Jahrhunderts
- Staatliche Museen des 20. - 21. Jahrhunderts
- Zur Kultur des Sammelns
- Sammlertypen
- Formen der Sammeltätigkeit
- Sammelobjekte
- Zur Funktion des Sammelns: Psychologische Perspektiven
- Pathologische Aspekte des Sammelns
- Zum Sammeln der Kinder
- Entwicklung des kindlichen Sammelns
- Formen und Objekte kindlichen Sammelns
- Funktionen des kindlichen Sammelns
- Zum Sammeln in der Schule (Aspekte kindlicher Entwicklung in der Grundschule)
- Argumente für und wider das Sammeln in der Schule
- Sammeln als Didaktik
- Sammeln als Gegenstand
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht das Phänomen des Sammelns, seine historische Entwicklung und seine Bedeutung für die kindliche Entwicklung, insbesondere im Kontext der Grundschule. Das Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen einer sinnvollen Integration des Sammelns in den Grundschulunterricht zu beleuchten.
- Historische Entwicklung des Sammelns
- Psychologische und kulturelle Aspekte des Sammelns
- Sammeln im Kindesalter und seine Funktionen
- Didaktische Potenziale des Sammelns im Grundschulunterricht
- Argumente für und gegen das Sammeln im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einer Anekdote aus der Kinderbuchreihe „Die drei Fragezeichen“, die den Leser zum Nachdenken über die eigene Sammelleidenschaft anregt. Sie führt in die Thematik ein und benennt den Forschungsstand, der sich vor allem auf historische Sammlungstypen und psychoanalytische Perspektiven konzentriert, während die pädagogische Bedeutung des Sammelns im Grundschulunterricht weniger umfassend erforscht ist. Die Arbeit skizziert das Ziel, die geschichtliche Entwicklung, das Phänomen selbst und dessen didaktische Einsetzbarkeit im Grundschulunterricht zu untersuchen.
Zur Entwicklung des Phänomens Sammeln: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Sammelns von seinen ursprüglichen, existenzsichernden Funktionen bis hin zu seiner heutigen Bedeutung als kulturelle Praxis. Es werden anthropologische Aspekte diskutiert und die historische Entwicklung vom Sammeln von Reliquien über Kunst- und Wunderkammern bis hin zu staatlichen Museen nachgezeichnet. Der Fokus liegt auf dem Wandel des Sammelns von einem primär nutzenorientierten Akt hin zu einer Tätigkeit mit kultureller, psychologischer und ästhetischer Bedeutung.
Zur Kultur des Sammelns: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Aspekte der Kultur des Sammelns. Es werden verschiedene Sammlertypen, Formen der Sammeltätigkeit, typische Sammelobjekte sowie die psychologischen Funktionen des Sammelns betrachtet. Besonders wird auf die unterschiedlichen Beweggründe und die psychologischen Hintergründe eingegangen, um das Sammeln als komplexes kulturelles und individuelles Phänomen zu verstehen. Der Abschnitt über pathologische Aspekte des Sammelns setzt einen Kontrapunkt und beleuchtet die Schattenseiten der Sammelleidenschaft.
Zum Sammeln der Kinder: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Sammeln im Kindesalter. Es beschreibt die Entwicklung des kindlichen Sammelns, die typischen Formen und Objekte sowie die Funktionen, die das Sammeln für Kinder erfüllt. Dabei werden die besonderen Bedürfnisse und die Entwicklungsphasen von Kindern im Zusammenhang mit dem Sammeln betrachtet, und die Bedeutung des Sammelns für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder wird hervorgehoben.
Zum Sammeln in der Schule (Aspekte kindlicher Entwicklung in der Grundschule): Dieses Kapitel widmet sich der Frage, wie das Sammeln sinnvoll in den Grundschulunterricht integriert werden kann. Es werden Argumente für und gegen eine solche Integration diskutiert, und es werden verschiedene didaktische Ansätze vorgestellt, um das Sammeln als Lernmethode zu nutzen. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Sammelns als didaktisches Mittel und als Gegenstand der Auseinandersetzung im Unterricht.
Schlüsselwörter
Sammeln, Anthropologie des Sammelns, Geschichte des Sammelns, Kultur des Sammelns, Sammlertypen, kindliches Sammeln, pädagogische Bedeutung des Sammelns, Grundschulunterricht, Didaktik, Museen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: "Das Phänomen des Sammelns"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen des Sammelns umfassend. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Sammelns, seine kulturellen und psychologischen Aspekte, seine Bedeutung für die kindliche Entwicklung und die Möglichkeiten seiner Integration in den Grundschulunterricht.
Welche Aspekte der Geschichte des Sammelns werden behandelt?
Die Hausarbeit verfolgt die Entwicklung des Sammelns von seinen anthropologischen Ursprüngen über verschiedene historische Phasen (Reliquien, Kunst- und Wunderkammern, bürgerliche und staatliche Museen) bis in die Gegenwart. Der Wandel vom nutzenorientierten zum kulturell, psychologisch und ästhetisch bedeutenden Akt wird analysiert.
Welche kulturellen und psychologischen Aspekte des Sammelns werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Sammlertypen, Formen der Sammeltätigkeit und Sammelobjekte. Sie analysiert die psychologischen Funktionen des Sammelns, geht auf unterschiedliche Beweggründe ein und beleuchtet auch pathologische Aspekte des Sammelns.
Wie wird das kindliche Sammeln behandelt?
Ein Kapitel konzentriert sich auf das Sammeln im Kindesalter. Es beschreibt die Entwicklung, typische Formen und Objekte sowie die Funktionen des kindlichen Sammelns für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung.
Welche Rolle spielt das Sammeln im Grundschulunterricht?
Die Hausarbeit untersucht die didaktischen Potenziale des Sammelns im Grundschulunterricht. Sie diskutiert Argumente für und gegen seine Integration, präsentiert verschiedene didaktische Ansätze und betrachtet das Sammeln sowohl als Lernmethode als auch als Gegenstand der Auseinandersetzung im Unterricht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Möglichkeiten und Herausforderungen einer sinnvollen Integration des Sammelns in den Grundschulunterricht zu beleuchten und die historische Entwicklung, das Phänomen selbst und dessen didaktische Einsetzbarkeit zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Entwicklung des Phänomens Sammeln, zur Kultur des Sammelns, zum Sammeln der Kinder, zum Sammeln in der Schule und eine Schlussbetrachtung mit Ausblick. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sammeln, Anthropologie des Sammelns, Geschichte des Sammelns, Kultur des Sammelns, Sammlertypen, kindliches Sammeln, pädagogische Bedeutung des Sammelns, Grundschulunterricht, Didaktik, Museen.
- Citar trabajo
- Laura Ullrich (Autor), 2005, Das Phänomen Sammeln: Zur Kultivierung des Sammeln in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65635