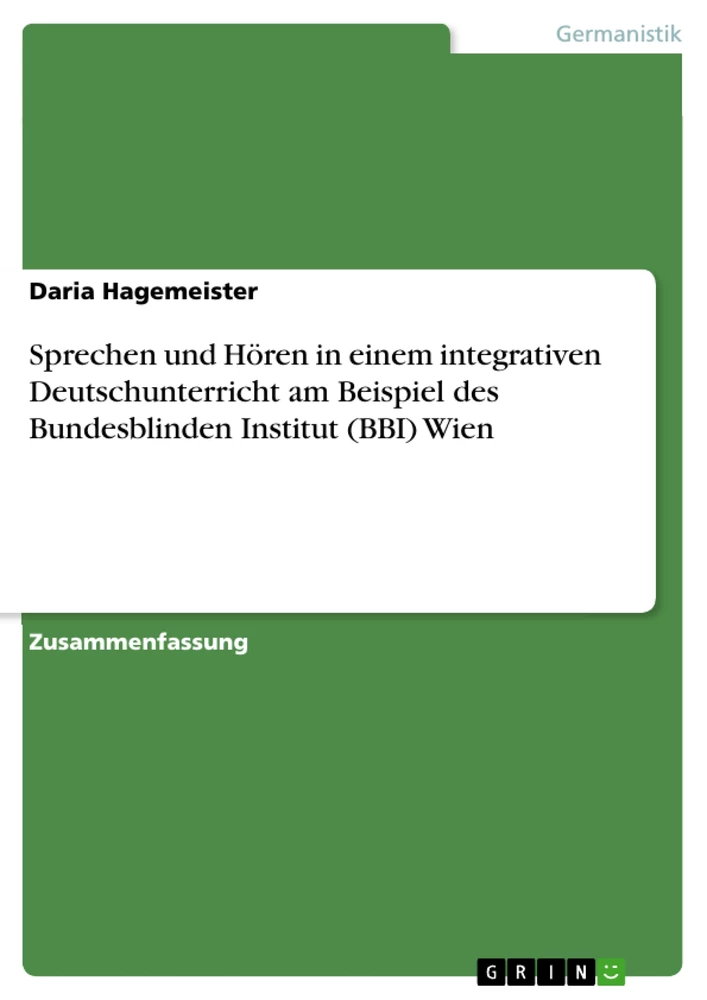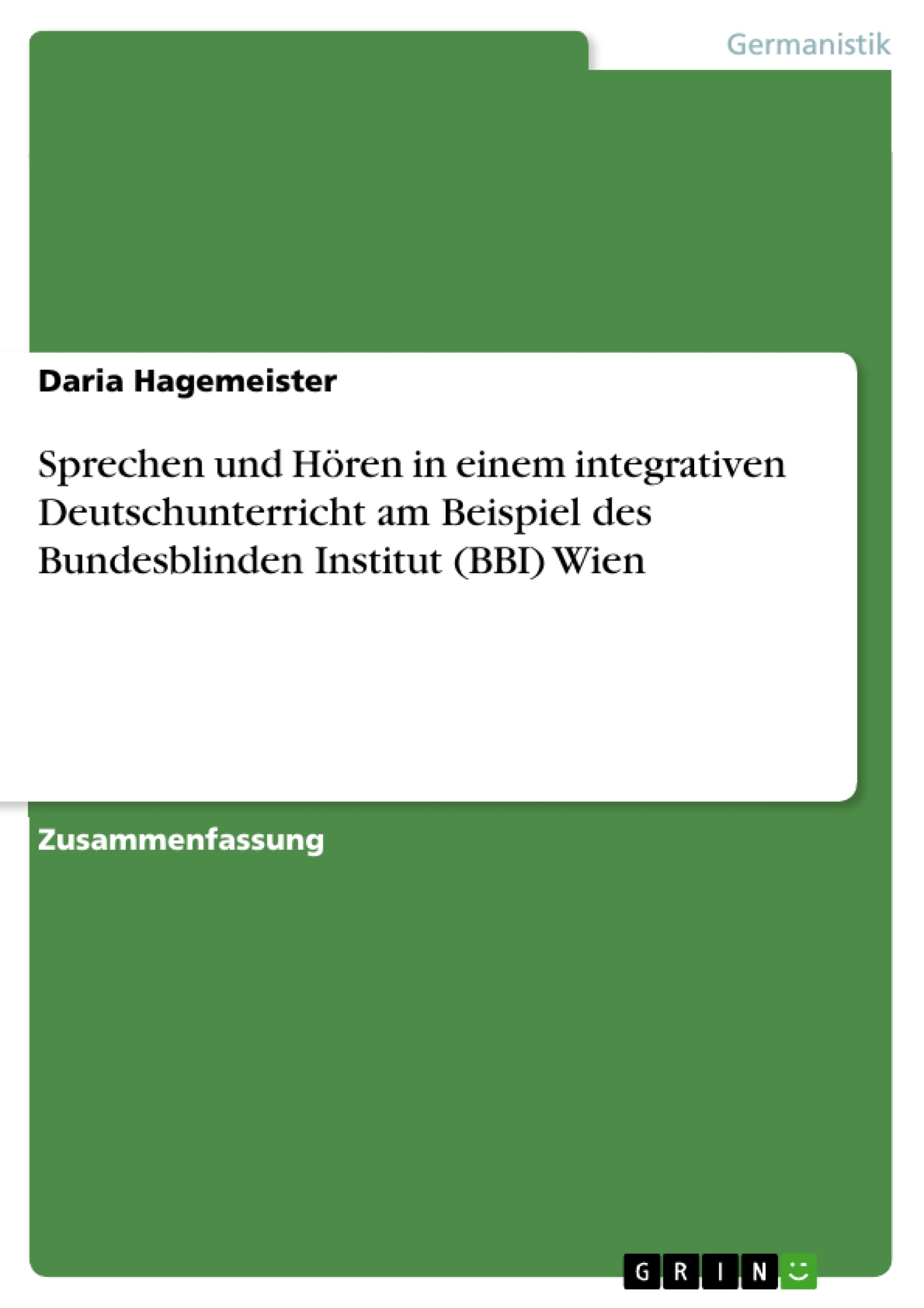Davon ausgehend, dass im Normalfall 3 Komponenten an einer funktionierenden Kommunikation beteiligt sind, nämlich das Sprechen, das Hören und das Sehen, wobei letzteres Mimik, Gestik, Körpersprache, aber auch die Schrift als Mittel der Kommunikation umfasst, möchte ich mich in meinem heutigen Vortrag mit Kommunikationsteilnehmern beschäftigen, bei denen eben diese dritte Komponente ganz, bzw. großteils ausfällt, nämlichen mit Blinden. Blindheit im weiteren Sinne umfasst allerdings ein breites Spektrum an Ausformungen.
Prinzipiell gibt es vom Gesetzgeber festgelegte Kriterien zur Beurteilung, um diverse Rechte und Ansprüche, wie etwa den Bezug des Pflegegeldes, oder den Erhalt eines Behindertenausweises zu regeln. Diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten der Blindheit ist auch wichtig für die richtige Wahl der Lehrstrategien.
Im Jahr 1824 hat der damals 15-jährige blinde Louis Braille die Blindenschrift, die "Brailleschrift" entwickelt. Es handelt sich dabei um ein System von 6-Punkt-Zellen (bzw. 8-Punkt-Zellen), wobei mittels verschiedener Kombinationen aus erhabenen Punkten die Buchstaben des Alphabets, Zahlen, Musiknoten und Kürzel dargestellt werden können. Manche Blinde können aber auch Großdruck (ab Schriftgröße 18) verwenden. Weiters kann die Verwendung von Sehhilfen (Lupenbrillen und Monokeln) in vielen Fällen eine große Erleichterung beim Lernen und im täglichen Leben darstellen. Auch Lehrkassetten, Hörbücher und wöchentliche Zusammenfassungen des Weltgeschehens auf Audiokassetten werden produziert.
Heute gibt es dank der Technologie wenige Barrieren für Blinde in Bezug auf Kommunikationsmöglichkeiten im weitesten Sinn, und im Bezug auf Zugang zu Informationen und Wissen. Es gibt CCTVs, die bis zu 60-fache Vergrößerung auf dem Bildschirm ermöglichen, Software für den PC, die Texte auf dem Bildschirm vergrößert, oder solche, die eine Sprachausgabe des Geschriebenen ermöglicht, Braille-Displays (mit 80 Zellen) und OCRs, Scanner, die mit dem PC verbunden sind, mit welchen das gesamte Material an die Bedürfnisse des Blinden angepasst und aufbereitet werden kann. Während dieser Präsentation habe ich selbst folgende Methoden, die am BBI angewendet werden, demonstriert: visuelles Lernen (Hand-outs), taktiles Lernen (mitgebrachte Braille-Schrift), exemplarisches Lernen (herumgereichte Monokel und Lupengläser), auditives Lernen (Präsentation selbst) und Wiederholen und Zusammenfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Beobachtungen am BBI
- Eigene Beobachtungen in der 5./6. Schulstufe ASO (= allgemeine Sonderschule) am BBI Wien
- Kurz ein paar Zahlen zum BBI allgemein
- Ausstattung der Klasse und Sitzordnung
- Lehrinhalte
- Lob/Tadel/Feedback durch die Lehrkraft
- Organisation/Disziplin
- Methoden/Strategien
- Haltung der Schüler zum Unterricht
- Fragebogen
- Beurteilung der mittels Fragebogen befragten Lehrer (in Anlehnung an den Fragebogen im "Kommunikationstraining"-Buch von Klippert)
- Technische Hilfsmittel erleichtern Kommunikation und Zugang zu Wissen
- Beobachtungen am BBI
- Schlussfolgerung und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Vortrag befasst sich mit der Kommunikation von Blinden im integrativen Deutschunterricht. Er untersucht die besonderen Herausforderungen, die sich aus dem Fehlen des Sehvermögens für den Lernprozess und die Interaktion in der Klasse ergeben.
- Beobachtungen am BBI Wien
- Kommunikationsbarrieren und -möglichkeiten bei Blinden
- Einsatz von technischen Hilfsmitteln im Deutschunterricht
- Lehrstrategien für blinde Schülerinnen und Schüler
- Integration von blinden Schülerinnen und Schülern in den Regelunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die besonderen Herausforderungen der Kommunikation für Blinde, wobei verschiedene Arten der Blindheit und ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung und das Vorstellungsvermögen erläutert werden. Die Kapitel im Hauptteil schildern detailliert die Beobachtungen in einer ASO-Klasse am BBI Wien. Die Analyse der Klassensituation, der Lehrinhalte und -methoden sowie die Auswertung des Fragebogens bieten Einblicke in die spezifischen Bedürfnisse von blinden Schülerinnen und Schülern im Deutschunterricht.
Schlüsselwörter
Blindenpädagogik, integrativer Deutschunterricht, Kommunikationsbarrieren, Braille-Schrift, technische Hilfsmittel, Lehrstrategien, Sehhilfe, Unterrichtsmethoden, Fragebogenanalyse.
- Quote paper
- Dr. phil. Daria Hagemeister (Author), 2006, Sprechen und Hören in einem integrativen Deutschunterricht am Beispiel des Bundesblinden Institut (BBI) Wien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65602