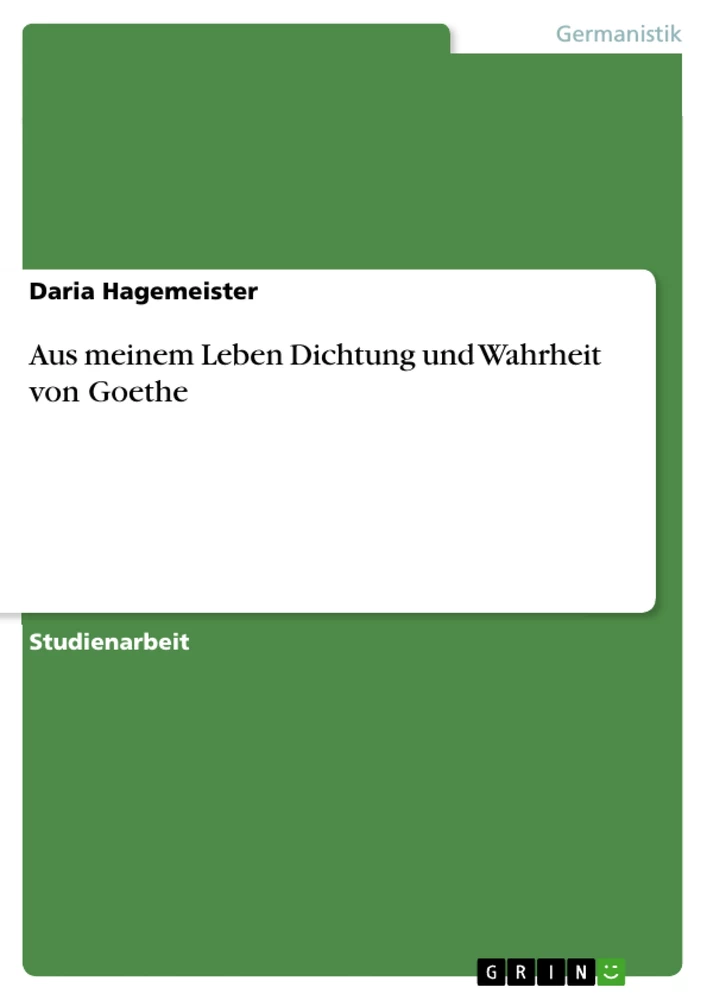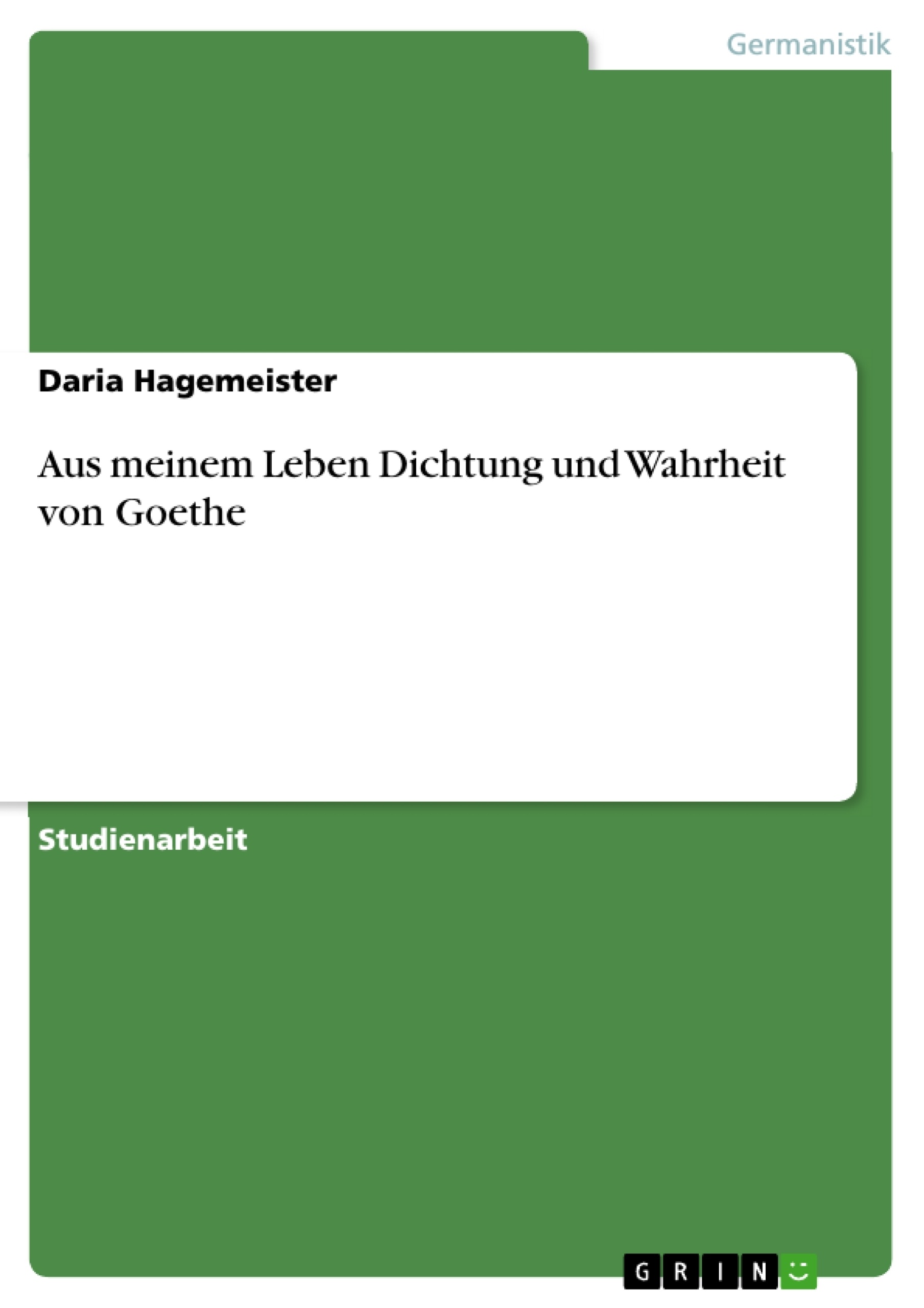Goethe versteht Dichtung als Mittel, um die Wahrheit ans Licht zu befördern und zu erkennen. Durch die Dichtung wird der Wahrheit des Daseins und den widersprüchlichen Lebensfragmenten Folge und Sinn zugewiesen. Goethes Autobiografie ist somit nicht nur ein Kunstwerk, sondern gleichzeitig auch ein Geschichtswerk. Durch die Alterssicht hat er retrospektives geschichtliches Verstehen und eine größere Urteilskraft. Bei der Rückerinnerung an Vergangenes wirkt allerdings die Einbildungskraft mit, dies ist die dichterische Komponente. Goethe bedient sich des Wahren zu seinem Zweck und erhebt eigene Erlebnisse und Entwicklungen zu Symbolen des Menschenlebens. Sie sollten eine „höhere“ Wahrheit bestätigen. Zwar müsse eine Biografie den Menschen in seinen Zeitverhältnissen zeigen, was ihm widerstrebt und was ihn begünstigt hat, doch Goethe war sich auch dessen bewusst, dass nicht alles von ihm wahrheitsgetreu wiedergegeben worden war, sondern perspektivische Verkürzungen einerseits und Auseinanderfaltungen andererseits unvermeidbar gewesen waren. Auch seine jugendlichen Krisen, Konflikte, Gefährdungen (er kam ja als etwa 15-Jähriger sogar mit dem Gesetz in Konflikt), seine religiösen Wandlungen, seine hypochondrischen und neurotischen Anwandlungen wurden oftmals bewusst oder unbewusst verschoben, beschönigt, gedämpft oder verdeckt. Obwohl Goethe sein Leben rückblickend als unter einem glücklichen Stern stehend betrachtete, nannte er es in einem Entwurf „ein einzig Abenteuer“ mit vielen wahren und falschen Tendenzen und es sei deshalb eine ewige Marter ohne eigentlichen Genuss gewesen. Im Zusammenhang mit „Egmont“ erörtert Goethe auch den Begriff des Dämonischen, der an ihm selbst seine produktive Seite erwiesen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung und Bedeutung des Werkes
- Inhaltsangabe
- Der erste Teil: Kindheit und Jugend
- Der zweite Teil: Studium in Leipzig
- Das siebente Buch: Literatur und Käthchen Schönkopf
- Der dritte Teil: Studien in Straßburg und Friederike Brion
- Das elfte Buch: Die Beziehung zu Friederike Brion
- Das zwölfte Buch: Studien in Straßburg und der Einfluss der französischen Literatur
- Das dreizehnte Buch: Wetzlar, Charlotte Buff und der Selbstmord Jerusalems
- Das vierzehnte Buch: Begegnungen mit Lavater, Basedow und Friedrich Heinrich Jacobi
- Das fünfzehnte Buch: Begegnung mit dem Erbprinzen Carl August von Sachsen-Weimar
- Entwicklung der Persönlichkeit Goethes
- Bedeutung von Literatur und Kunst für Goethes Leben
- Die Rolle der Religion und des Glaubens in Goethes Entwicklung
- Die Auseinandersetzung mit der Aufklärung und der Genie-Bewegung
- Goethes Beziehungen zu wichtigen Persönlichkeiten seiner Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Goethes „Dichtung und Wahrheit“ ist eine Autobiografie, die den Lebensweg des Autors von seiner Kindheit bis zu seinen jungen Erwachsenenjahren beschreibt. Sie zeichnet sich durch eine Verbindung von Faktizität und Poesie aus und stellt die Entwicklung Goethes im Kontext der kulturellen und politischen Ereignisse seiner Zeit dar.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Teil beschreibt Goethe seine Kindheit in Frankfurt am Main, geprägt von der Geborgenheit des Elternhauses und dem Einfluss seiner Großeltern. Er schildert seine ersten literarischen Versuche und die Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges auf seine Familie. Der erste Teil endet mit Goethes erster Liebesbeziehung zu Gretchen und einem einschneidenden Erlebnis von Schuld und Verzweiflung, das durch eine Dokumentenfälschungsaffäre ausgelöst wird.
Der zweite Teil beginnt mit Goethes Studienzeit in Leipzig. Er beschreibt die Enttäuschungen, die ihm die Universitätsstadt bereitet, und seine Auseinandersetzung mit der literarischen Szene seiner Zeit. Goethe schildert seine literarischen Einflüsse und sein sich entwickelndes Selbstverständnis als Dichter.
Im siebten Buch beleuchtet Goethe die deutsche Literatur um die Jahrhundertmitte und beschreibt seine Beziehung zu Käthchen Schönkopf, die ihn zu neuen Dichtungen inspiriert. Er betont die Bedeutung von Freundschaft und die heilende Kraft der Poesie. Goethes körperlicher Zusammenbruch beendet sein Studium in Leipzig, und er kehrt nach Frankfurt zurück.
Der dritte Teil beginnt mit Goethes Zeit in Straßburg, wo er einer Studentengruppe begegnet und mit der Eigenart des Bürgerlebens vertraut wird. Goethe schildert seine Begegnung mit dem Straßburger Münster und seine Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Literatur, insbesondere mit Klopstock und Herder. Diese Zeit ist geprägt von Goethes Beziehung zu Friederike Brion, die für ihn schicksalhaft wird.
Das elfte Buch konzentriert sich auf die Beziehung zu Friederike Brion, die Höhepunkte der Idylle aber auch die schmerzliche Distanzierung und das Ende der Beziehung beschreibt. Parallel dazu schildert Goethe den Abschluss seines Studiums und seine Auseinandersetzung mit der französischen Literatur, der Philosophie und Shakespeare.
Im zwölften Buch setzt Goethe seine Auseinandersetzung mit der französischen Literatur und der Philosophie fort. Er beschreibt seine neu gewonnenen Kontakte in Frankfurt und Darmstadt, die Begegnung mit Merck und seine ersten Schritte als Rezensent. In Wetzlar verliebt er sich in Charlotte Buff, die jedoch bereits verlobt ist. Der Selbstmord eines Freundes, Jerusalem, der in die unglückliche Liebe zu einer verheirateten Frau verwickelt war, prägt diese Zeit.
Das dreizehnte Buch erzählt von Goethes Erfahrungen in Wetzlar, der unglücklichen Liebe zu Charlotte Buff und dem Selbstmord seines Freundes Jerusalem. Dieser tragische Vorfall inspiriert Goethe zu seinem Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“, der zu einer Selbstmordwelle unter jungen Männern führt. Goethe reflektiert über die Natur des Selbstmords und die Beziehung zwischen Dichtung und Wirklichkeit.
Das vierzehnte Buch beschreibt Goethes Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit, darunter Lavater, Basedow und Friedrich Heinrich Jacobi. Goethe schildert seine Auseinandersetzung mit der Philosophie Spinozas, die ihm eine neue Perspektive auf die Welt eröffnet.
Im fünfzehnten Buch begegnet Goethe dem Erbprinzen Carl August von Sachsen-Weimar. Eine berufliche Verbindung zum Weimarer Fürstenhof wird ihm in Aussicht gestellt, die ihm auch von Susanne von Klettenberg, einer Freundin seines Elternhauses, nahegelegt wird. Goethe beschäftigt sich mit religiösen Themen und der Fabel des Prometheus.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte von „Dichtung und Wahrheit“ sind: Autobiografie, Entwicklung, Persönlichkeit, Literatur, Kunst, Religion, Glaube, Aufklärung, Genie-Bewegung, Beziehungen, Zeitgeschichte.
- Citar trabajo
- Dr. phil. Daria Hagemeister (Autor), 2006, Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Goethe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65597