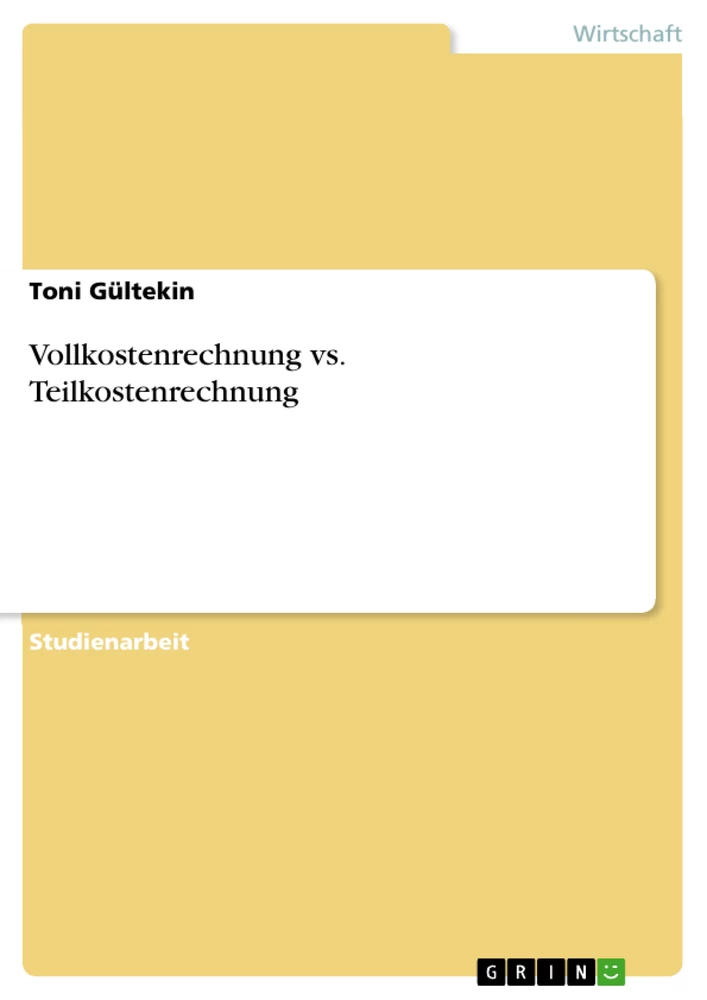Der Ursprung der Kostenrechnung lässt sich auf die Zeit der Entwicklung der Buchhaltung und somit in den Zeitraum 3000 bis 2900 v. Chr. einordnen. Hier wurden von den Sumerer (Völkerschaft ungewisser Herkunft, bewohnten das Gebiet am Unterlauf des Euphrat und Tigris im Süden Mesopotamiens) erste Ansätze von Aufzeichnungen über Nahrungsmittellieferungen festgehalten. Daraus folgt, dass der Ausgangspunkt der Kostenrechnung in der Kalkulation von Handel und Manufakturen liegt (14. Jahrhundert).
Die Anfänge der Kostenrechnung jedoch, entwickelten sich in der Zeit vom 18. Jahrhundert bis ca. 1919.
Nach der Publikation „Zurechnung von Kosten auf Betriebe“ von Klipstein (1781) und der Feststellung von Jung (1786) „Trennung in Fabrikbuchhaltung und Handlungsbuchhaltung“ erfolgten die ersten Anstöße zur Vereinheitlichung der Kostenrechnung. In den darauf folgenden Jahrzehnten wurde eine Vielzahl an Werken veröffentlicht, die unterschiedliche Ziele mit unterschiedlichen Kalkulationstypen verfolgte.
Doch aufgrund politischer Gegebenheiten stockte im Jahre 1933 die Entwicklung der Kostenrechnung. Erst nach 1945 konnte die Kontrollfunktion der Kostenrechnung allmählich an Bedeutung gewinnen. Insbesondere war die Teilkostenrechnung in den Achtzigerjahren ausschlaggebend dafür, dass Ziele neu definiert worden sind; jetzt ging es darum, nicht nur Kosten „zu rechnen“, sondern diese im Entstehungsprozess zu durchleuchten und zu beeinflussen. Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte dann die Trennung zwischen internem und externem Rechnungswesen.
Inhaltsverzeichnis
- Vollkostenrechnung vs. Teilkostenrechnung
- 1. Grundlagen
- 1.1 Geschichte der Kostenrechnung
- 1.2 Systeme der Kostenrechnung
- 1.3 Aufgaben und Ziele der Kostenrechnung
- 2. Vollkostenrechnung
- 2.1 Kritik an der Vollkostenrechnung
- 2.2 Notwendigkeit der Vollkostenrechnung
- 2.3 Ansätze zur Verbesserung der Vollkostenrechnung
- 2.3.1 Maschinenstundensatzkalkulation
- 2.3.2 Bezugsgrößenkalkulation
- 3. Teilkostenrechnung
- 3.1 Systeme der Teilkostenrechnung
- 3.1.1 Deckungsbeitragsrechnung (DBR)
- 3.1.1.1 Einstufige Deckungsbeitragsrechnung (Direct Costing)
- 3.1.1.2 Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
- 3.1.1.3 Notwendigkeit der Teilkostenrechnung / Problembe reiche der Vollkostenrechnung
- 3.1.2 Relative Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung
- 3.1.3 Grenzplankostenrechnung
- 3.1.1 Deckungsbeitragsrechnung (DBR)
- 3.1 Systeme der Teilkostenrechnung
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Proseminar befasst sich mit den Grundlagen der Kostenrechnung, insbesondere mit dem Vergleich zwischen Vollkostenrechnung und Teilkostenrechnung. Ziel ist es, die Unterschiede, Vor- und Nachteile beider Systeme zu verstehen und deren Anwendung im Kontext verschiedener betrieblicher Anforderungen zu beleuchten.
- Historische Entwicklung der Kostenrechnung
- Unterschiede zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung
- Anwendungsgebiete und Kritikpunkte der Vollkostenrechnung
- Systeme der Teilkostenrechnung (z.B. Deckungsbeitragsrechnung)
- Aufgaben und Ziele der Kostenrechnung im Allgemeinen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Grundlagen: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Kostenrechnung. Es beginnt mit einem historischen Überblick, der die Entwicklung der Kostenrechnung von den frühen Aufzeichnungen der Sumerer bis zur Trennung von internem und externem Rechnungswesen Ende des 19. Jahrhunderts nachzeichnet. Die verschiedenen Systeme der Kostenrechnung werden vorgestellt, klassifiziert nach dem Zeitbezug (Ist-, Normal-, Plankostenrechnung) und dem Sachumfang (Vollkosten- und Teilkostenrechnung). Die Kapitel verdeutlicht die Komplexität und Entwicklung des Gebietes, indem es auf verschiedene Publikationen und historische Entwicklungen eingeht. Schließlich werden die Aufgaben und Ziele der Kostenrechnung, wie die Ermittlungs-, Prognose- und Kontrollfunktion, sowie die damit verbundenen Ziele (z.B. Erfolgsermittlung, Preisentscheidungen) beschrieben.
2. Vollkostenrechnung: Das Kapitel widmet sich der Vollkostenrechnung, einem traditionellen Verfahren der Kostenrechnung. Es analysiert die Kritikpunkte an diesem System und beleuchtet gleichzeitig die Notwendigkeit seiner Anwendung in bestimmten Kontexten. Des Weiteren werden Ansätze zur Verbesserung der Vollkostenrechnung vorgestellt, wie z.B. die Maschinenstundensatzkalkulation und die Bezugsgrößenkalkulation. Der Fokus liegt auf der Diskussion der Stärken und Schwächen dieses Ansatzes und wie diese durch Modifikationen adressiert werden können. Dabei werden konkrete Beispiele und Methoden zur Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz der Vollkostenrechnung behandelt.
3. Teilkostenrechnung: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit verschiedenen Systemen der Teilkostenrechnung, die als modernere Alternative zur Vollkostenrechnung gelten. Der Schwerpunkt liegt auf der Deckungsbeitragsrechnung (DBR) mit ihren ein- und mehrstufigen Varianten. Es wird erklärt, warum die Teilkostenrechnung in bestimmten Situationen Vorteile gegenüber der Vollkostenrechnung bietet und welche Problemfelder der Vollkostenrechnung durch die Teilkostenrechnung adressiert werden. Zusätzlich werden weitere Systeme der Teilkostenrechnung wie die relative Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung sowie die Grenzplankostenrechnung kurz erläutert, wobei der Fokus auf den wesentlichen Unterschieden und Anwendungsfällen liegt.
Schlüsselwörter
Kostenrechnung, Vollkostenrechnung, Teilkostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Kostenarten, Kostenträger, Kostenrechnungssysteme, historische Entwicklung, Planung, Steuerung, Kontrolle.
FAQs: Vollkostenrechnung vs. Teilkostenrechnung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Vollkostenrechnung und die Teilkostenrechnung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Systeme, ihren Vor- und Nachteilen sowie ihren jeweiligen Anwendungsbereichen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Grundlagen der Kostenrechnung, die historische Entwicklung, die verschiedenen Systeme der Kostenrechnung (Vollkostenrechnung und Teilkostenrechnung mit ihren jeweiligen Unterarten wie z.B. Deckungsbeitragsrechnung), deren Kritikpunkte, Verbesserungsansätze und die jeweiligen Anwendungsgebiete. Es beleuchtet die Aufgaben und Ziele der Kostenrechnung im Allgemeinen und vergleicht die beiden Hauptmethoden im Detail.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Proseminars?
Das Proseminar zielt darauf ab, die Grundlagen der Kostenrechnung zu vermitteln und die Unterschiede, Vor- und Nachteile der Vollkostenrechnung und der Teilkostenrechnung zu verstehen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Anwendung beider Systeme im Kontext verschiedener betrieblicher Anforderungen.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Vollkostenrechnung und Teilkostenrechnung?
Der Hauptunterschied liegt in der Behandlung der Kosten. Die Vollkostenrechnung rechnet alle Kosten (fixe und variable) den Kostenträgern zu, während die Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten berücksichtigt. Dies führt zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Preisgestaltung und der Erfolgsmessung. Die Vollkostenrechnung ist traditioneller, während die Teilkostenrechnung als modernere Alternative gilt, die insbesondere in Entscheidungssituationen Vorteile bietet.
Welche Systeme der Teilkostenrechnung werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Systeme der Teilkostenrechnung, insbesondere die Deckungsbeitragsrechnung (DBR) in ihren ein- und mehrstufigen Varianten. Zusätzlich werden die relative Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung sowie die Grenzplankostenrechnung kurz erläutert.
Welche Kritikpunkte werden an der Vollkostenrechnung genannt?
Das Dokument nennt Kritikpunkte an der Vollkostenrechnung, die sich insbesondere auf die Zuordnung von Fixkosten und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung beziehen. Die Vollkostenrechnung kann in bestimmten Situationen zu verzerrten Ergebnissen führen und die Flexibilität bei der Preisgestaltung einschränken.
Welche Ansätze zur Verbesserung der Vollkostenrechnung werden vorgestellt?
Es werden Ansätze zur Verbesserung der Vollkostenrechnung vorgestellt, darunter die Maschinenstundensatzkalkulation und die Bezugsgrößenkalkulation. Diese Methoden zielen darauf ab, die Genauigkeit und Effizienz der Kostenrechnung zu erhöhen und die Zuordnung der Kosten zu verbessern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen Kostenrechnung, Vollkostenrechnung, Teilkostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Kostenarten, Kostenträger, Kostenrechnungssysteme, historische Entwicklung, Planung, Steuerung und Kontrolle.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Grundlagen der Kostenrechnung, Vollkostenrechnung, Teilkostenrechnung und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Kostenrechnung und bietet einen detaillierten Überblick über die jeweiligen Themen.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende, die sich mit Kostenrechnung auseinandersetzen, sowie für alle, die ein tiefergehendes Verständnis der Vollkostenrechnung und der Teilkostenrechnung benötigen. Es eignet sich als Nachschlagewerk und zur Vorbereitung auf Prüfungen.
- Quote paper
- Toni Gültekin (Author), 2006, Vollkostenrechnung vs. Teilkostenrechnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65530