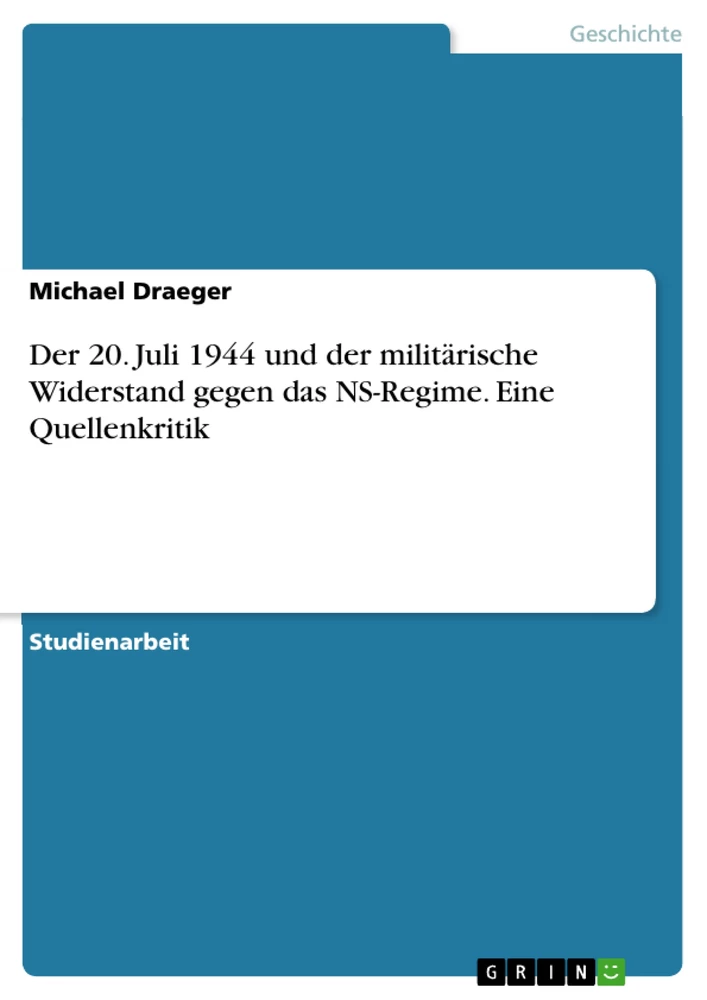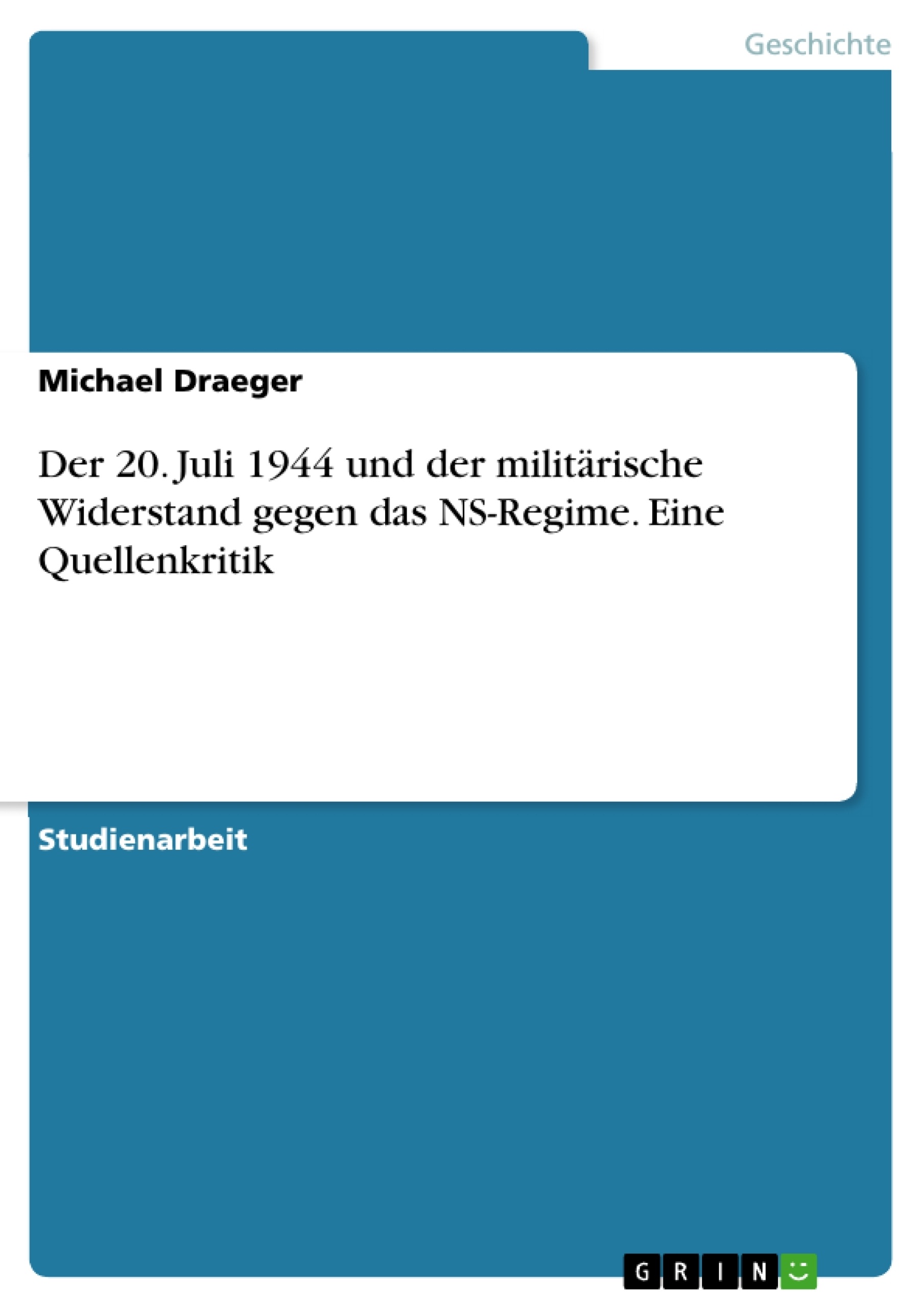Am 20. Juli 1944 efolgte ein Sprengstoffanschlag auf Adolf Hitler bei einer Lagebesprechung in seinem Führerhauptquartier Wolfsschanze in Ostpreußen. Claus Schenk Graf von Stauffenberg hatte den Koffer platziert, ein bloßer Zufall rettete Hitler das Leben. Der beginnende Staatsstreich brach noch in der Nacht zusammen, die Verschwörer – ranghohe Militärs, aber auch Zivilisten – wurden verhaftet und hingerichtet. In der deutschen (Militär)-Geschichte handelt es sich dennoch um ein wichtiges Datum. Das breite publizistische Echo zu den Jahrestagen des Attentates zeugen davon.
Die Rolle und Bedeutung des militärischen Widerstandes ist dabei in der Forschung schon immer umstritten gewesen und unterlag gravierenden Interpretations- und Legitimationswandeln, die auch durch die Teilung Deutschlands begründet waren.
Heute existiert in der Wissenschaft kein Bild des unermüdlichen Widerstandes von Anfang an, sondern es wird die Frage nach den Zeitpunkten individueller Gewissensentscheidungen gestellt, die ganze Breite zwischen Bereitschaft zur Anpassung und Mitwirkung und prinzipieller Opposition wird beschrieben. Der Widerstand eignet sich nicht mehr zur „unkritischen Heldenbildung“ (Gerd Ueberschär).
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der Einbettung der Ereignisse vom 20. Juli 1944 in den historischen Hintergrund auf dem Stand der Forschung. Wie sah das Verhältnis der Militärs zu Hitler aus? Was musste geschehen, damit einzelne von ihnen in die Opposition übertraten? Was geschah am 20. Juli 1944 und wie sah die Rache des NS-Regimes aus? Ziel dieser Arbeit ist es, einen Teilaspekt des Widerstandes gegen das NS-Regime herauszugreifen und darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung, Forschungsstand und Fragestellung
- Quellenbeschreibung
- Äußere Kritik
- Innere Kritik
- Sprachliche Aufschlüsselung
- Sachliche Aufschlüsselung
- Quelleninterpretation
- Inhaltsangabe
- Historischer Zusammenhang
- Hitler und das Militär - Das Bündnis der Eliten
- Von der Zusammenarbeit zur Opposition
- Der 20. Juli 1944
- Das Ende der Verschwörer
- Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rundfunkrede Adolf Hitlers nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 und untersucht die Hintergründe des militärischen Widerstands gegen das NS-Regime. Sie befasst sich mit der Entwicklung des Verhältnisses zwischen Hitler und dem Militär sowie den Beweggründen für den Umsturzversuch.
- Analyse der Rundfunkrede Adolf Hitlers nach dem Attentat
- Der militärische Widerstand gegen das NS-Regime
- Das Verhältnis zwischen Hitler und dem Militär
- Die Hintergründe des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944
- Die Rolle der Verschwörer
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung, Forschungsstand und Fragestellung: Das Attentat vom 20. Juli 1944 und die Rolle des militärischen Widerstands werden in ihrer historischen Bedeutung und der Forschungsgeschichte beleuchtet.
- Quellenbeschreibung: Die Rundfunkrede Adolf Hitlers nach dem Attentat wird als Quelle vorgestellt. Die äußere und innere Kritik an der Quelle wird erläutert.
- Quelleninterpretation: Die Rede wird hinsichtlich ihres Inhalts und ihres historischen Zusammenhangs analysiert, wobei die Beziehung zwischen Hitler und dem Militär, die Entstehung der Opposition und der Ablauf des Attentats sowie dessen Folgen im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
20. Juli 1944, Adolf Hitler, militärischer Widerstand, NS-Regime, Attentat, Widerstand, Opposition, Rundfunkrede, Quellenkritik, Historischer Kontext.
- Quote paper
- Michael Draeger (Author), 2006, Der 20. Juli 1944 und der militärische Widerstand gegen das NS-Regime. Eine Quellenkritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65375