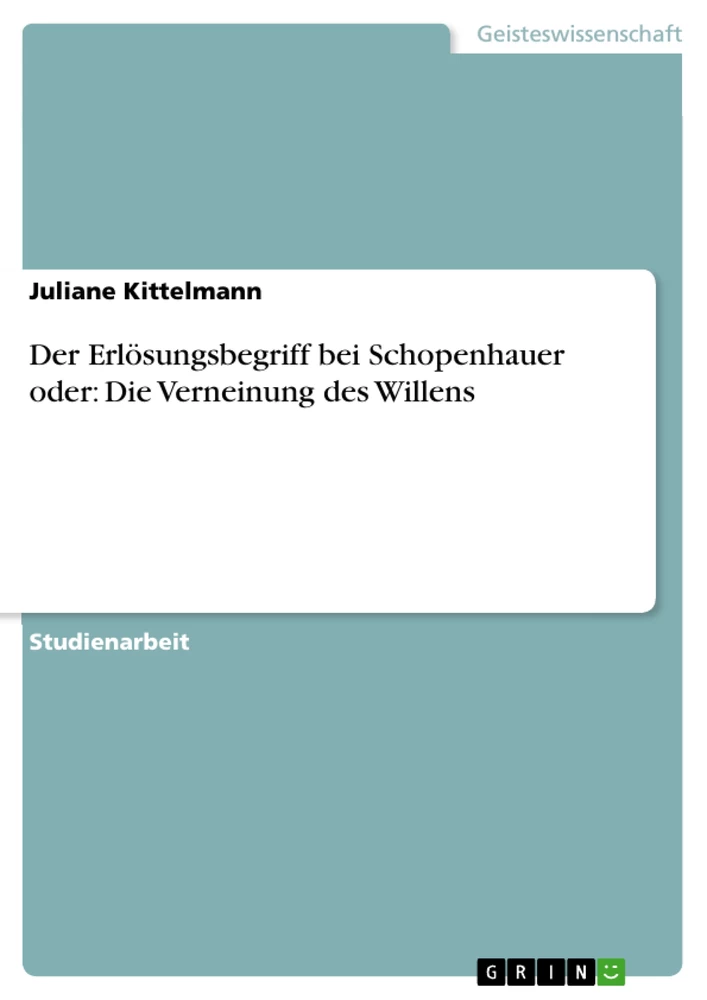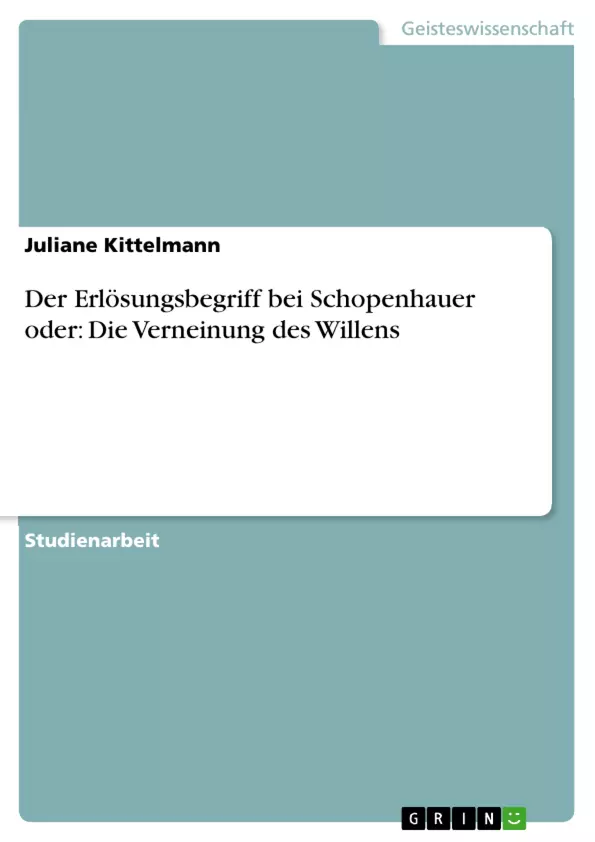Arthur Schopenhauer (*22. Februar 1788 in Danzig, † 21. September 1860 in Frankfurt am Main) ist einer der bedeutsamsten deutschen Philosophen. Durch die These, dass „(...) wesentlich alles Leben Leiden ist“ , welche er in seinem Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“ formulierte und auf der seine philosophische Auffassung zum Leben basiert, gilt er aber auch als einer der größten Pessimisten.
Wie soll man nun überhaupt Leben, wenn doch alles Leben Leiden ist? Was hat das Leben in Anbetracht dessen noch für einen Sinn? Schopenhauer stellt nicht nur die These auf, dass das Leben eine einzige Qual ist, sondern er beschreibt auch exemplarisch zwei Möglichkeiten, wie der Mensch mit dieser Erkenntnis leben kann- der Lebensweg der Bejahung und jener der Verneinung des Willens zum Leben, wobei jedoch nur zweiter zu einer wahren Erlösung vom Leben und somit von allen Leiden verhilft.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Erlösung in Arthur Schopenhauers Ethik mit besonderem Bezug auf das 4. Buch des Werkes „Die Welt als Wille und Vorstellung“. Dort beschreibt Schopenhauer die Möglichkeit, den Willen im Leben zu verneinen und so mit dem Tod von allem Leid der Welt erlöst zu werden.
Zunächst soll kurz erläutert werden, welche Rolle der Wille im Leben spielt, um für das Folgende ein Grundverständnis zu schaffen. Die Bejahung des Willens zum Leben repräsentiert eine verlockende und übliche Lebensart. Deswegen soll auf dessen Erörterung folgend die These Schopenhauers, dass alles Leben Leiden ist, erklärt werden, wodurch gerechtfertigt wird, warum es besser wäre, einen willensverneinenden Lebensstil zu pflegen. Daraufhin soll die Willensverneinung als der bessere, zur Erlösung führende Lebensweg erklärt und abschließend die Analogie zwischen der Auffassung von der Erlösung Schopenhauers und der des Christentums hervorgehoben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Wille- Eine kurze Erläuterung
- Die Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben
- Die Bejahung des Willens zum Leben
- Alles Leben ist Leiden
- Der Weg zur Erlösung- Die Verneinung des Willens zum Leben
- Schopenhauers Erlösungsbegriff und die Analogie zum Christentum
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Erlösungsbegriff in Arthur Schopenhauers Ethik, insbesondere im Kontext des vierten Buches von "Die Welt als Wille und Vorstellung". Die Arbeit untersucht die Rolle des Willens im Leben, die Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben, und die Analogie zwischen Schopenhauers Erlösungsauffassung und dem Christentum. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für Schopenhauers Philosophie und insbesondere seine Sicht auf die Erlösung vom Leiden zu entwickeln.
- Die Rolle des Willens im Leben
- Die Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben
- Der Weg zur Erlösung durch die Verneinung des Willens
- Die Analogie zwischen Schopenhauers Erlösungsauffassung und dem Christentum
- Schopenhauers Pessimismus und seine Sicht auf das Leben als Leiden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt Arthur Schopenhauer als einen bedeutenden deutschen Philosophen vor und erläutert die Grundthese seines Hauptwerks "Die Welt als Wille und Vorstellung", dass "alles Leben Leiden ist". Die Einleitung stellt auch Schopenhauers zwei Möglichkeiten für den Umgang mit dieser Erkenntnis vor: die Bejahung und die Verneinung des Willens zum Leben.
- Der Wille - Eine kurze Erläuterung: Dieses Kapitel erklärt die Bedeutung des Willens in Schopenhauers Philosophie. Der Wille wird als das "Ding-an-sich" beschrieben, die Grundlage aller Erscheinungen.
- Die Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben: Dieses Kapitel beleuchtet zwei Möglichkeiten, mit dem Willen umzugehen. Die Bejahung des Willens führt zu einem Leben, das von den Bedürfnissen des Willens gesteuert wird, während die Verneinung des Willens zum Leben eine Befreiung von diesen Bedürfnissen und somit von Leiden verspricht.
- Die Bejahung des Willens zum Leben: Dieses Kapitel beschreibt die Lebensweise, die den Willen bejaht. Es wird argumentiert, dass der Wille, als "Ding-an-sich", unzerstörbar ist und in einem Kreislauf von Leben und Tod fortbesteht.
- Alles Leben ist Leiden: Dieses Kapitel erläutert Schopenhauers Argument, dass das Leben von Natur aus mit Leiden verbunden ist. Die Bedürfnisse des Willens führen zu einem ständigen Streben und einer Suche nach Befriedigung, die jedoch nie vollständig erreicht werden kann.
- Der Weg zur Erlösung- Die Verneinung des Willens zum Leben: Dieses Kapitel stellt den Weg zur Erlösung dar, der durch die Verneinung des Willens zum Leben erreicht werden kann. Die Verneinung des Willens bedeutet, sich von seinen Bedürfnissen zu lösen und die Welt als "Vorstellung" und nicht als "Wille" zu betrachten.
- Schopenhauers Erlösungsbegriff und die Analogie zum Christentum: Dieses Kapitel untersucht die Parallelen zwischen Schopenhauers Erlösungsauffassung und dem Christentum. Beide Konzepte sehen eine Befreiung vom Leiden und ein Erreichen eines höheren Zustands durch die Verneinung des Willens zum Leben an.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Schlüsselkonzepte wie den Willen, die Vorstellung, die Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben, die Erlösung, das Leiden, das "Ding-an-sich", die philosophische Erkenntnis, den principium individuationis, den Kreislauf des Lebens und die Analogie zwischen Schopenhauers Philosophie und dem Christentum. Diese Schlüsselwörter repräsentieren die zentralen Themen und Argumente des Werkes "Die Welt als Wille und Vorstellung" und ermöglichen ein tieferes Verständnis von Schopenhauers Philosophie.
- Arbeit zitieren
- Juliane Kittelmann (Autor:in), 2006, Der Erlösungsbegriff bei Schopenhauer oder: Die Verneinung des Willens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65351