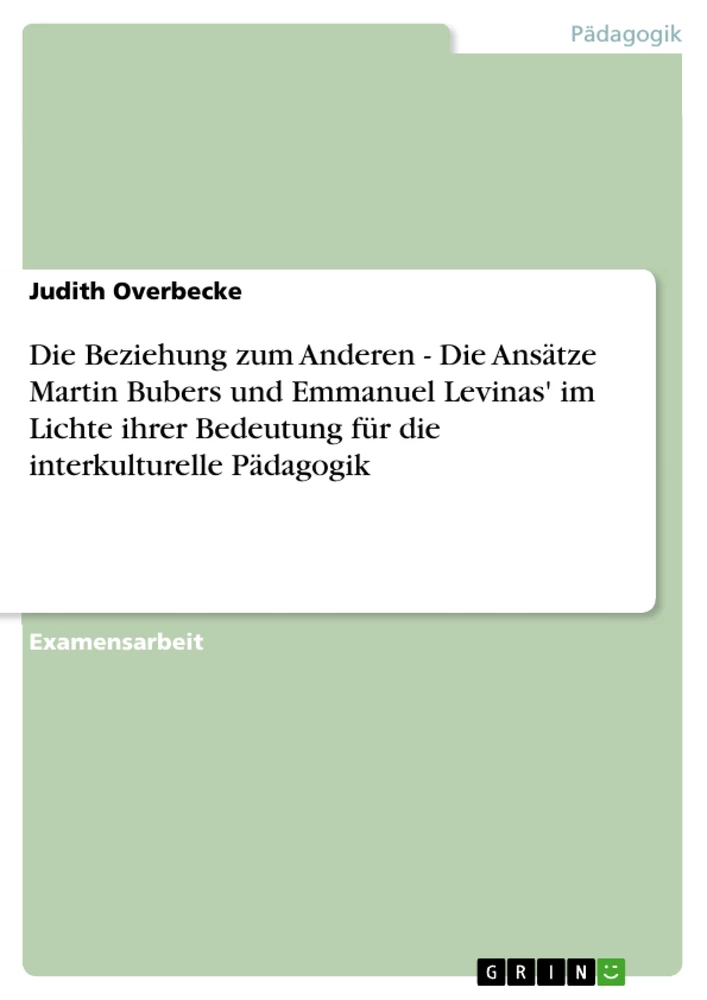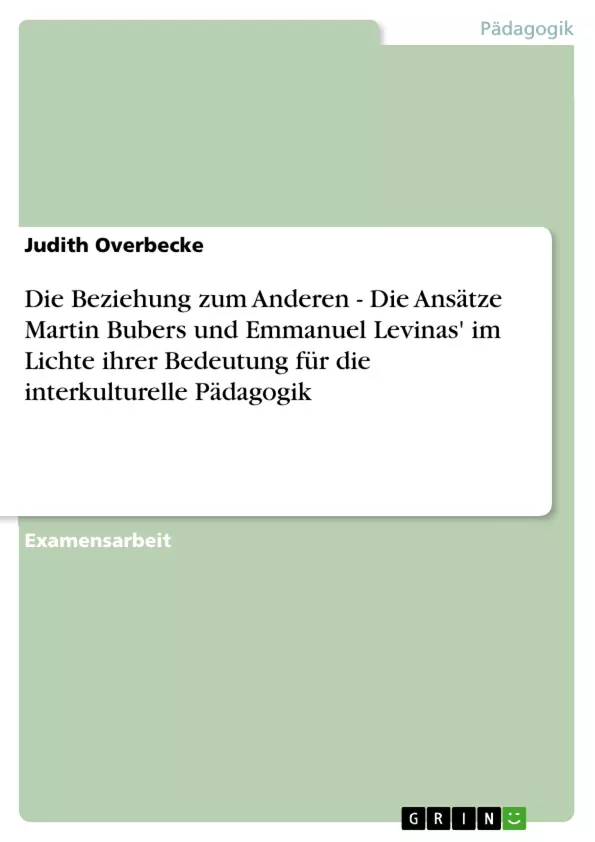Die Interkulturelle Pädagogik fragt danach, wie sie Subjekten dazu verhelfen kann, die Beziehung zum Anderen in einer fried- und respektvollen Weise zu gestalten. So zeigt die vorliegende Examensarbeit, welche Bedeutung das „dialogische Prinzip“ Bubers und Levinas´ Ethik der Verantwortung in dieser Hinsicht für die Interkulturelle Pädagogik haben.
Entgegen des häufig vorfindbaren Denkens unserer Zeit thematisieren Buber und Levinas, dass der Mensch kein egoistisches Wesen ist, dem es um Selbstbehauptung und Bewahrung seiner Identität geht, sondern dass er Wesen in Beziehung zum Anderen ist, hier in sein Ich findet, Identität entwickelt.
Nach Buber geschieht zwischenmenschliche Beziehung in der Begegnung, in der ich den Anderen als wirklichen Menschen in seiner Anderheit bejahe, als Person annehme. Beziehung ereignet sich als dialogische, ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen.
Levinas zeichnet die menschliche als eine ethische Beziehung zweier Getrennter, absolut Verschiedener, deren Gemeinsamkeit in ihrer Verschiedenheit besteht. Der jeweils Andere geht den Einen unendlich an, der Eine ist für den Anderen verantwortlich.
Interkulturelle Pädagogik hat es mit der aus Migrationsprozessen resultierenden ethnischen, sprachlichen und kulturellen Alterität zu tun. Fremdheit und Anderheit sind mit Buber, Levinas und den Erkenntnissen der Interkulturellen Pädagogik als relationales Phänomen und notwendige Bedingung für Eigenheit zu sehen.
Die philosophischen Ansätze Bubers und Levinas´ werden grundlegend dargestellt und verglichen, Anknüpfungspunkte für die allgemeine Pädagogik formuliert, daraufhin die Interkulturelle Pädagogik als Fachgebiet in den Erziehungswissenschaften vorgestellt. Die Identitätskonzeptionen Bubers, Levinas´ und diejenigen im Umfeld der Interkulturellen Pädagogik werden aufgezeigt, der Umgang mit dem differenten Anderen anhand der Erkenntnisse der Interkulturellen Pädagogik dargestellt. Aus den Ergebnissen werden Konsequenzen für die Interkulturelle Pädagogik im Hinblick auf Subjektbildung gezogen und als Fazit eine kleine Programmatik für eine Interkulturelle Pädagogik entworfen, die sich im Sinne Bubers und Levinas´ die Schaffung einer humaneren Schule, Gesellschaft und letztendlich globalisierten Welt zum Ziel macht und deren Schule die Personalisationsfunktion in den Mittelpunkt stellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung der Arbeit
- Quellen und Anmerkungen zur Literatur
- Vorgehensweise
- Martin Buber
- Leben
- Ansatz
- Die Beziehung zum Anderen: Das dialogische Prinzip
- Ich-Es
- Ich-Du
- Das dialogische Prinzip
- Das Erzieherische
- Zur Pluralität in der Bildungsarbeit
- Emmanuel Levinas
- Leben
- Ansatz
- Die Beziehung zum Anderen: Levinas' Ethik der Verantwortung
- Vergleich der Ansätze Bubers und Levinas'
- Einstellung und Leben
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Ansatz
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Einstellung und Leben
- Anknüpfungspunkte für die Pädagogik
- Grundannahmen
- Das pädagogische Verhältnis
- Buber
- Levinas
- Pädagogischer Ausgangspunkt
- Lernen
- Ziele und Orientierung
- Orte des Lernens
- Interkulturelle Pädagogik
- Entwicklung
- Grundsätze und Ziele
- Anknüpfungspunkte an die Ansätze Bubers und Levinas' und Ausblick
- Untersuchung einzelner Aspekte
- Identität
- Identitätskonzeption bei Buber
- Identitätskonzeption bei Levinas
- Identitätskonzeptionen im Umfeld der Interkulturellen Pädagogik
- Exkurs: Von der Gefahr des Fundamentalismus
- Zusammenschau und Ausblick
- Die Beziehung zum Anderen in der Interkulturellen Pädagogik: Vom Umgang mit (kultureller) Differenz
- Festschreibung des Anderen durch Anerkennung?
- Unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Differenz
- Die Wahrnehmung des Anderen
- Historische Aspekte
- Die Wahrnehmung des Einzelnen
- Fremdwahrnehmung
- Zum Bereich des Zwischen in der Interkulturellen Pädagogik
- Verstehen und Kommunikation
- Interkultureller Dialog
- Zusammenschau und Verknüpfung mit den Ansätzen Bubers und Levinas'
- Identität
- Konsequenzen für die Interkulturelle Pädagogik
- Subjektentwicklung
- Subjektentwicklung durch Interkulturelles Lernen: Didaktische Konzepte und Handlungsmöglichkeiten
- Subjektentwicklung durch Öffnung von Schule
- Religiöse Erziehung und interreligiöser Dialog
- Subjektentwicklung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ansätze von Martin Buber und Emmanuel Levinas im Hinblick auf ihre Bedeutung für die interkulturelle Pädagogik. Die Arbeit zielt darauf ab, die Relevanz dieser philosophischen Konzepte für die Herausforderungen einer zunehmend pluralen Gesellschaft aufzuzeigen.
- Die Beziehung zum Anderen als Grundprinzip der Menschlichkeit
- Die Bedeutung von Dialog und Verantwortung in der Bildung
- Die Rolle der Interkulturellen Pädagogik in einer globalisierten Welt
- Der Umgang mit kultureller Differenz und der Förderung von Identität
- Die Bedeutung von Lernen und Subjektentwicklung in einem interkulturellen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet den aktuellen Kontext einer globalisierten und multikulturellen Gesellschaft.
Es wird erläutert, warum die Ansätze von Buber und Levinas in dieser Situation relevant sind und auf die Herausforderungen im Umgang mit dem Anderen in einer postmodernen Welt eingegangen.
- Kapitel 2 beleuchtet das Leben und den Ansatz von Martin Buber, mit besonderem Fokus auf sein Konzept der „Beziehung zum Anderen“. Es wird die Bedeutung des Dialogischen Prinzips erläutert und die Unterscheidung zwischen „Ich-Es“ und „Ich-Du“ aufgezeigt.
- Kapitel 3 behandelt das Leben und den Ansatz von Emmanuel Levinas und stellt seine Ethik der Verantwortung vor.
- Kapitel 4 vergleicht die Ansätze von Buber und Levinas in Bezug auf ihre Einstellung und Lebenswelt sowie ihre philosophischen Konzepte. Es werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede herausgestellt.
- Kapitel 5 beleuchtet die Anknüpfungspunkte der Ansätze Bubers und Levinas' für die Pädagogik im Allgemeinen.
Es wird auf Grundannahmen, das pädagogische Verhältnis, den pädagogischen Ausgangspunkt, Lernformen, Ziele und Orte des Lernens eingegangen.
- Kapitel 6 behandelt die Entwicklung, Grundsätze und Ziele der Interkulturellen Pädagogik. Es wird erläutert, wie die Ansätze von Buber und Levinas in dieser Disziplin relevant werden können.
- Kapitel 7 untersucht einzelne Aspekte der Interkulturellen Pädagogik im Kontext der Ansätze von Buber und Levinas.
Dabei werden Themen wie Identität, der Umgang mit kultureller Differenz und die Bedeutung von Verstehen und Kommunikation behandelt.
- Kapitel 8 geht auf die Konsequenzen der Ansätze von Buber und Levinas für die Praxis der Interkulturellen Pädagogik ein.
Es werden Konzepte zur Subjektentwicklung und Möglichkeiten für die Öffnung der Schule sowie die Bedeutung von religiöser Erziehung und interreligiösem Dialog behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Schlüsselbegriffe und Themenfelder wie die Beziehung zum Anderen, Dialog, Verantwortung, Interkulturelle Pädagogik, Identität, kulturelle Differenz, Verstehen, Kommunikation, Subjektentwicklung, religiöse Erziehung und interreligiöser Dialog.
- Citation du texte
- Judith Overbecke (Auteur), 2006, Die Beziehung zum Anderen - Die Ansätze Martin Bubers und Emmanuel Levinas' im Lichte ihrer Bedeutung für die interkulturelle Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65275