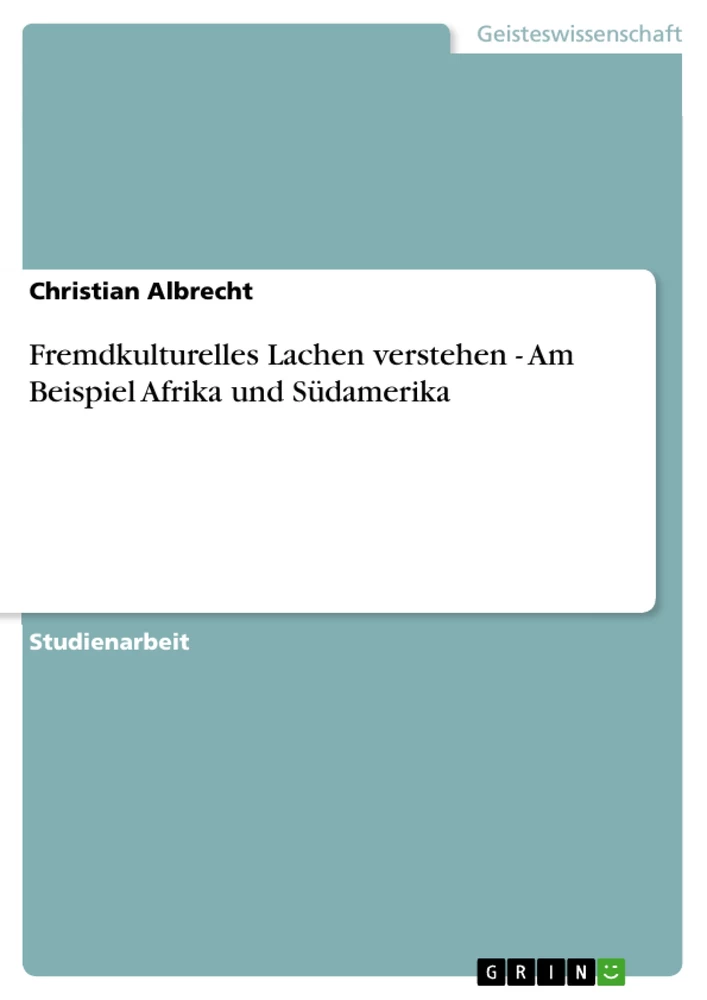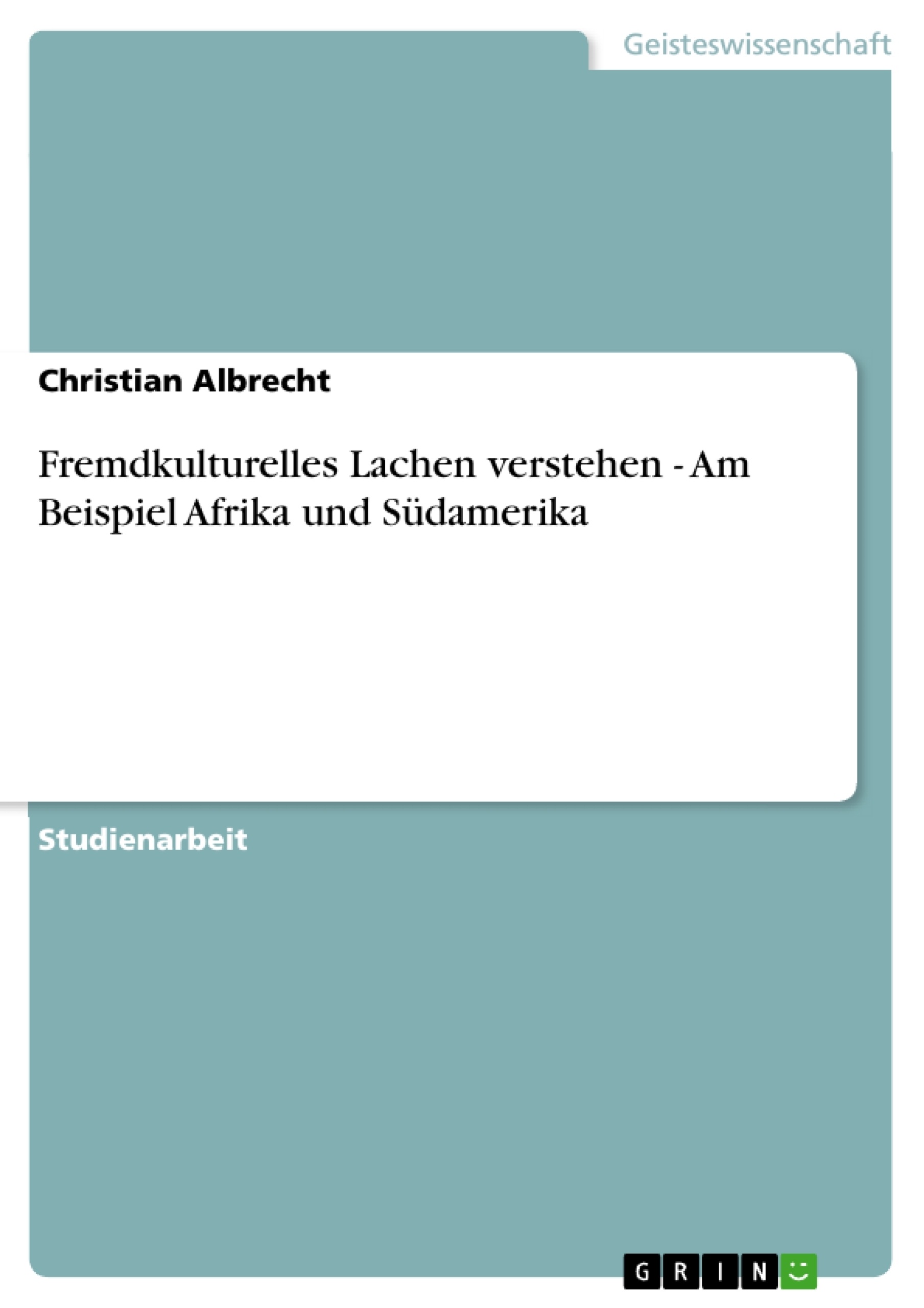Sobald Menschen in Beziehung zueinander treten, verhalten sie sich. Als Weisen des Verhaltens gibt es Ausdrucksformen wie Liebe, Wut und Aggression, Überraschung, Freude, Furcht und viele andere. In dieser Arbeit wird die Verhaltensweise des Lachens kulturvergleichend untersucht. Lachen ist eine universelle menschliche Ausdrucksform, während Tiere nicht lachen (mit Ausnahme vielleicht der dem Menschen am nächsten verwandten Menschenaffen, die im Ansatz zu Lachen fähig sind). Hitzige Debatten um die Natur des Menschen debattierten um Pro und Contra der „menschlichen Natur“, z.B. stritten der Kulturrelativismus und der Existentialismus universell verbindliche Vorstellungen vom menschlichen Wesen ab. 1 Fest steht, dass alle heutigen Menschen einen einheitlichen biologischen Ursprung haben, wenn es auch verschiedene Menschenrassen gibt. 2 Der interessanten Frage nach der menschlichen Natur soll hier nicht nachgegangen werden, sie soll nur dazu dienen, Überlegungen zu der Universalität von Humor und Lachen anzuregen. Humor verstehe ich hier als eine intellektuelle und emotionale Leistung, während Lachen der Ausdruck der humorvollen Empfindung sein kann, aber so wie jede andere Verhaltensweise auch zweckentfremdet für bestimmte Absichten instrumentalisiert werden kann (z.B. boshaftes Auslachen zum Zwecke der Verspottung). Doch lachen Menschen in verschiedenen Kulturen über das Gleiche? Wie stark ist der kulturelle Einfluss, wie stark die genetische Vererbung? Wenn andere Völker über andere Dinge lachen, können wir das Lachen überhaupt verstehen (und sogar mitlachen)? Um diesen Fragen nachzugehen, wenden wir uns im Folgenden drei ethnologischen Fallbeispielen zu. Zunächst beginne ich mit der Darstellung der Ik in Uganda. Collin M. Turnbull hat dieses Volk in Afrika als grausame Menschen dargestellt, die egoistisch Andere verlachen und Mitmenschen Böses wollen. Die Tiv in Afrika, die Laura Bohannen erforscht hat, sind Bodenbauen, die nach einer schlimmen Pockenepidemie das Grauen mit Lachen verarbeiten. Schließlich wenden wir uns den Slumvierteln in Brasilien zu und sehen eine Form von „laughter out of place“ (Donna Goldstein). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lachen in Afrika
- Das „grausame“ Verlachen der Ik
- Katastrophenlachen bei den Tiv
- Humor in einem Slumviertel in Südamerika
- Abschluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das kulturelle Phänomen des Lachens mithilfe eines kulturvergleichenden Ansatzes. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern kulturelle Einflüsse das Lachen prägen und ob Lachen in verschiedenen Kulturen über die gleichen Dinge stattfindet.
- Die Universalität von Humor und Lachen
- Der Einfluss kultureller Faktoren auf die Art und Weise des Lachens
- Die Interpretation von Lachen in verschiedenen kulturellen Kontexten
- Das Verständnis von fremdkulturellem Lachen
- Die Rolle des Lachens im sozialen Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die kulturvergleichende Untersuchung des Lachens als menschliche Verhaltensweise. Sie stellt die Frage nach der Universalität von Humor und Lachen und untersucht den Einfluss kultureller Faktoren auf das Lachen.
- Lachen in Afrika: Dieses Kapitel befasst sich mit zwei Fallbeispielen aus Afrika: Die Ik, die durch ihre vermeintliche Grausamkeit und ihren egoistischen Charakter gekennzeichnet sind, und die Tiv, bei denen Lachen als Mittel zur Verarbeitung von Katastrophen und Leid dient.
- Humor in einem Slumviertel in Südamerika: Das Kapitel analysiert die Form des Lachens „laughter out of place“, die in den Slumvierteln Brasiliens beobachtet wird. Dabei wird die Rolle des Lachens im Kontext von Armut, Gewalt und sozialer Ungleichheit betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Humor, Lachen, Kulturvergleich, Ethnologie, Afrika, Südamerika, Ik, Tiv, Slum, laughter out of place, soziale Verhaltensweisen, kulturelle Einflüsse.
- Quote paper
- Christian Albrecht (Author), 2005, Fremdkulturelles Lachen verstehen - Am Beispiel Afrika und Südamerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65237