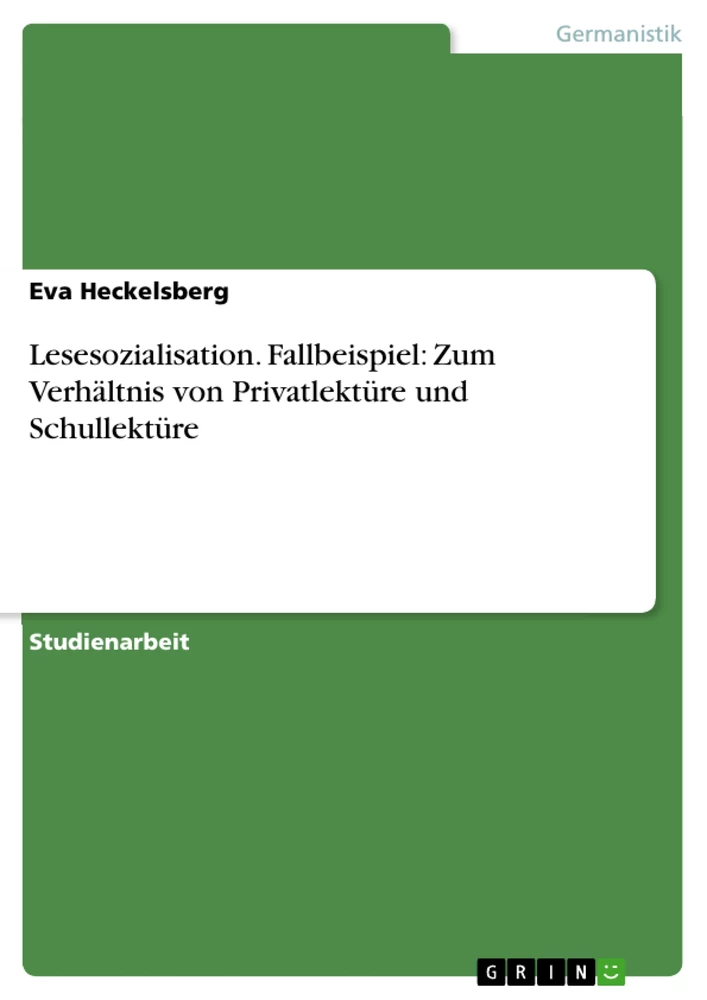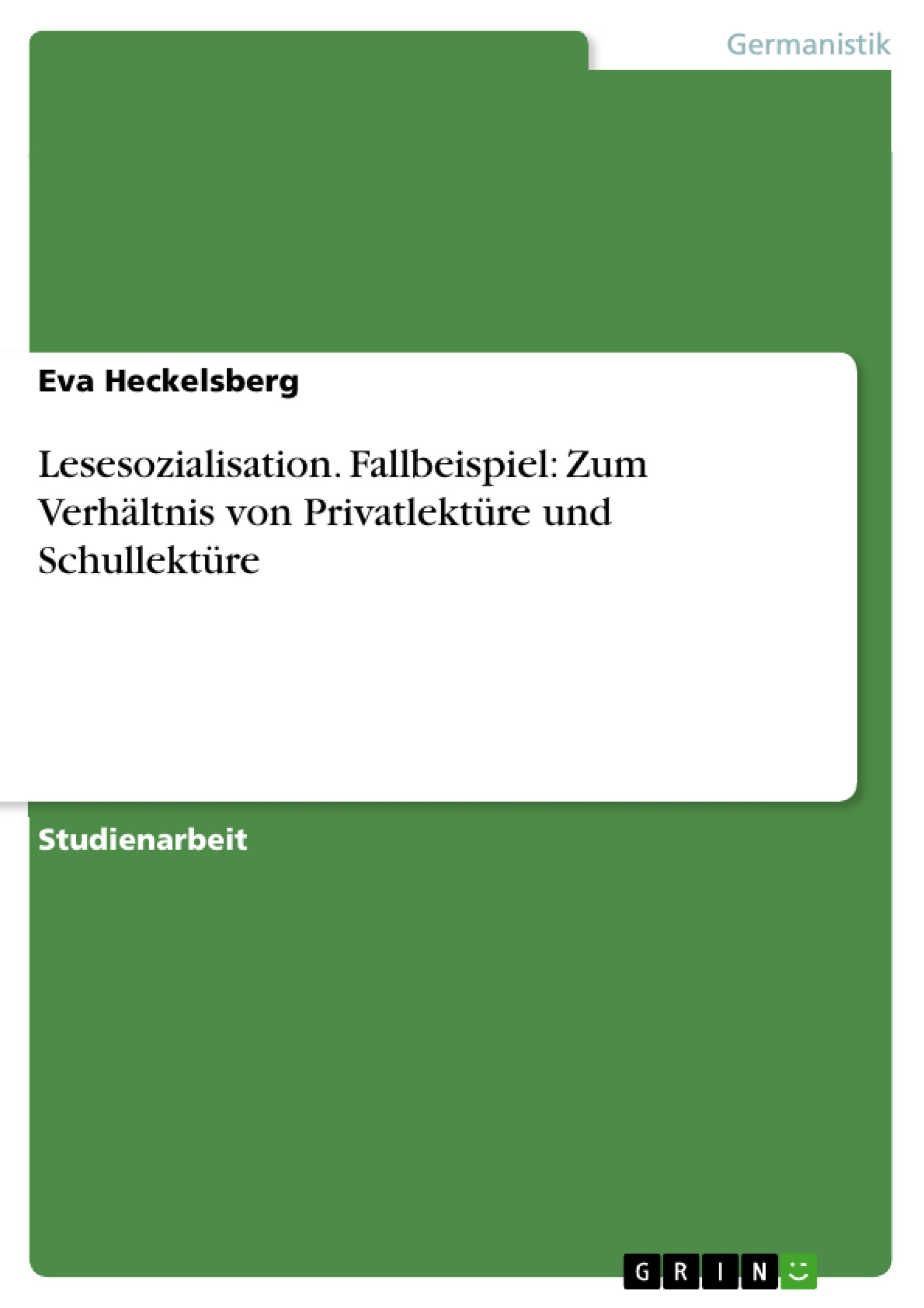Der Titel des Seminars diesen Semesters lautete „Instanzen und Prozesse der Lesesozialisation“. Was bedeutet überhaupt Lesesozialisation und welche Rolle spielt sie für die Entwicklung einer Lesefreude und für eine grundsätzliche Leseaktivität und was kann man daraus für die Leseförderung ableiten? Böck und Wallner-Paschon beantworten dies 2002 in ihren „Bedingungen der Lesesozialisation“ wie folgt: „Die grundlegende Bedeutung der Lesesozialisation für die Konzeption von Leseförderung leitet sich daraus ab, dass sich der individuelle Stellenwert des Lesens sowie der Lesemedien aus dem Hineinwachsen in unterschiedliche soziale und räumliche `Leseumwelten` und den damit im Zusammenhang stehenden eigenen Erfahrungen mit lesebezogenen Aktivitäten entwickelt. Wie auch PISA 2000 bestätigt, korrelieren sowohl die Freude am Lesen als auch das Interesse an vielfältigem Lesestoff signifikant mit der Lesekompetenz. Mit einer lesefreundlichen Sozialisation wird offensichtlich ein wichtiger Grundstein für die Entwicklung einer positiven Einstellung zum Lesen und zu den Lesemedien gelegt, die wiederum, [...], die Lese-Kompetenz positiv beeinflusst.“ Nach diesen Erkenntnissen würde der Schule und der Person des Lehrers in der Heranführung an das Lesen und dem Interessen-Wecken für Lesemedien eine nahezu unbedeutende Rolle zuteil werden. Die wichtigste Lesesozialisationsinstanz wäre die Familie, das Elternhaus. Mit Hilfe einer `kleinen Empirie´, d.h. eines eigenständig durchgeführten und ausgewerteten Interviews mit einem 9-jährigen Mädchen und ihrer Mutter, wollte ich herausfinden, was ein Kind, in diesem Fall Meike, zu einer Leserin gemacht hat bzw. macht, welche Einstellung sie zum Lesen hat, welchen Stellenwert das Lesen und die Lesemedien für sie einnehmen, welche Arten von Büchern, Texten sie bevorzugt und wie das soziale Umfeld aussieht, das sie prägte und immer noch Einfluss auf sie nimmt. Außerdem wollte ich wissen, was Eltern unternehmen, um ihre Kinder zum Lesen zu motivieren. Ist es ihnen überhaupt wichtig, dass ihre Kinder lesen? Leben sie ihnen ihre Leseaktivität vor? Was passiert eigentlich in der Schule? Was wird dort gelesen? Werden überhaupt Ganztexte gelesen? Und wie wird dort gelesen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verstärkte und gezielte Leseförderung in der Schule?
- Das Fallbeispiel
- Alltag, soziales Umfeld und die Einbettung des Lesens in den Alltag
- Medienausstattung und Mediennutzung
- Entwicklung der Leseaktivität von Meike bis heute und die Frage nach Förderung seitens der Eltern
- Lesen und Schule
- Konsequenzen für den Deutschunterricht
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der Arbeit ist es, die Rolle der Schule und des Lehrers in der Entwicklung von Leseaktivität, Lesekompetenz und Lesefreude von Kindern zu untersuchen. Dabei soll untersucht werden, inwiefern das Elternhaus und das soziale Umfeld des Kindes einen Einfluss auf die Lesesozialisation haben und wie die Schule diese Prozesse unterstützen kann.
- Lesesozialisation und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Lesefreude und Leseaktivität
- Der Einfluss des familiären Umfelds auf die Lesesozialisation
- Die Rolle der Schule in der Leseförderung
- Die Bedeutung von Ganztexten im Deutschunterricht
- Die Herausforderungen des Lesens im Vergleich zu audiovisuellen Medien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel führt in das Thema Lesesozialisation ein und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Schule in der Entwicklung von Leseaktivität und Lesefreude.
- Verstärkte und gezielte Leseförderung in der Schule?: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Leseförderung in der Schule und untersucht die Vorteile des Lesens für die kognitive Entwicklung, die Individualität, die soziale Kompetenz und die Wissensvermittlung.
- Das Fallbeispiel: Dieses Kapitel stellt das Fallbeispiel von Meike und ihrer Mutter vor. Es beschreibt den Alltag des Kindes, die Mediennutzung, die Entwicklung der Leseaktivität und die Frage nach der Rolle der Eltern in der Leseförderung.
- Konsequenzen für den Deutschunterricht: Dieses Kapitel diskutiert die Konsequenzen der gewonnenen Erkenntnisse für den Deutschunterricht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lesesozialisation, Leseförderung, Deutschunterricht, Familieninfluence, Leseaktivität, Lesekompetenz, Lesefreude, Ganztexte, audiovisuelle Medien.
- Quote paper
- Eva Heckelsberg (Author), 2005, Lesesozialisation. Fallbeispiel: Zum Verhältnis von Privatlektüre und Schullektüre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65049