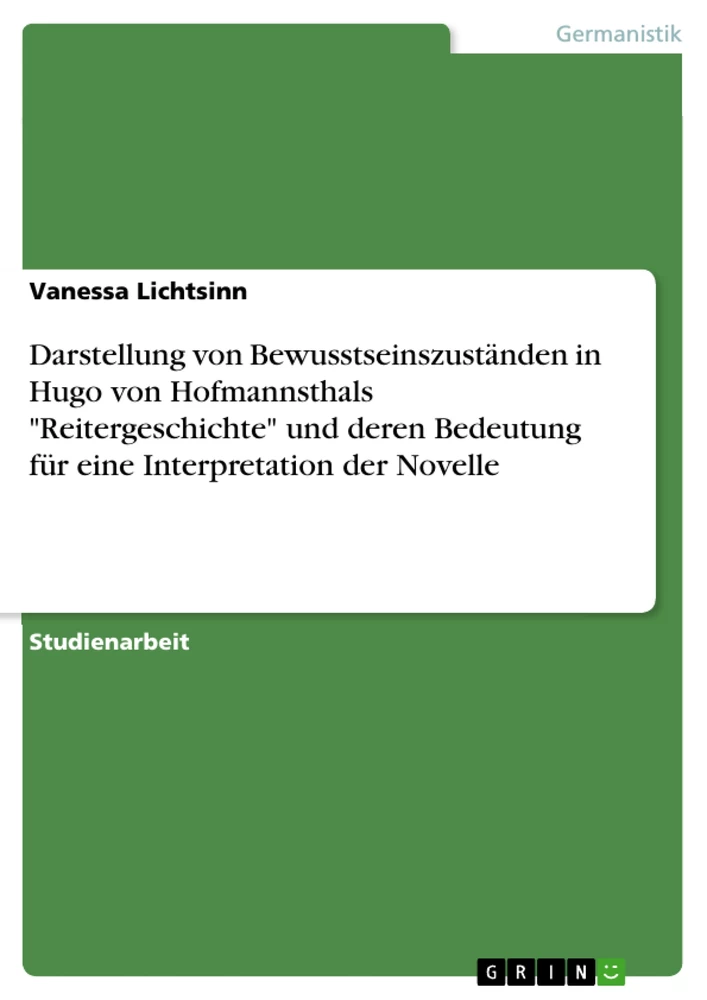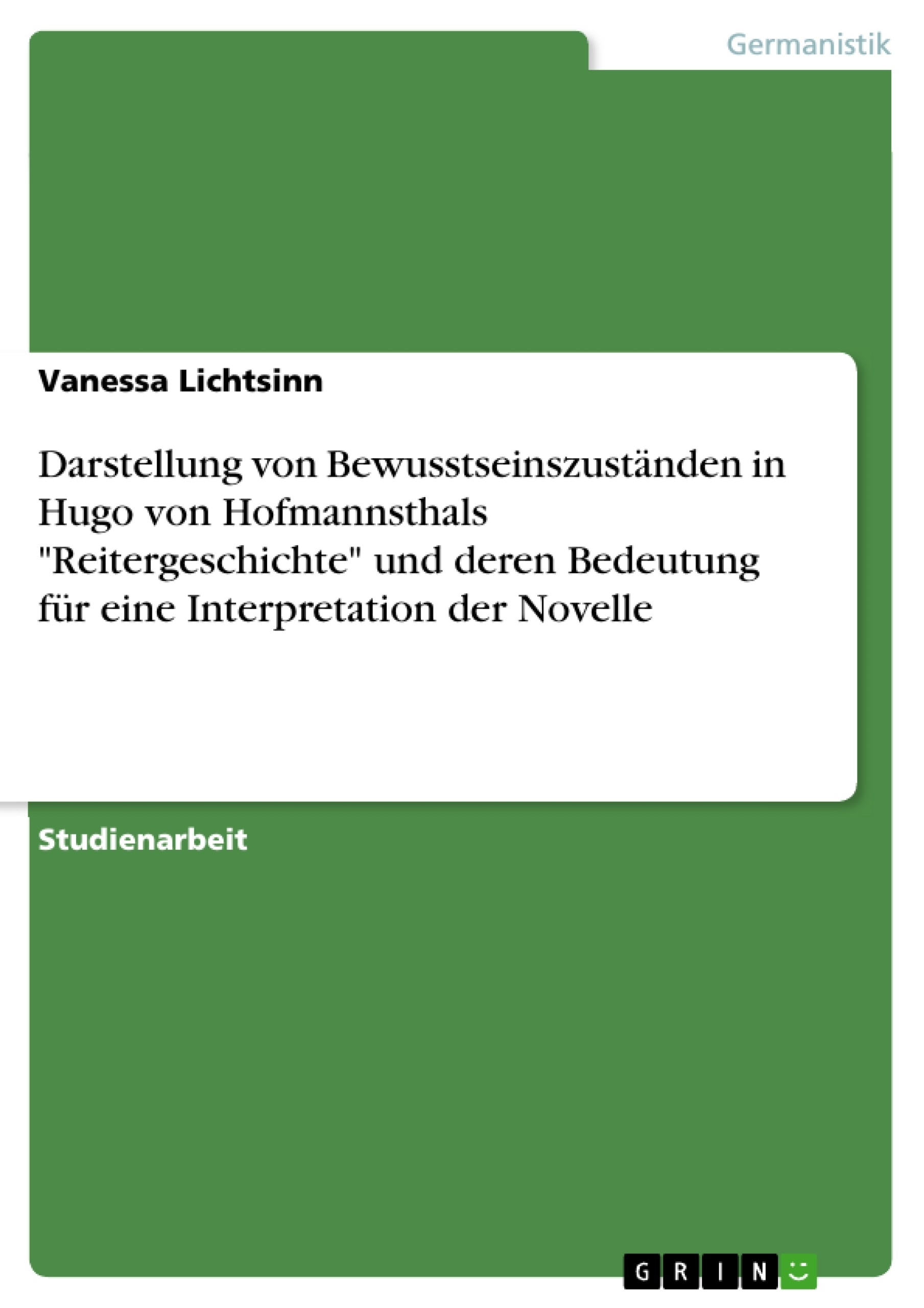Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung der Bewusstseinzustände des Protagonisten Anton Lerch in der „Reitergeschichte“ von Hugo von Hofmannsthal. Es soll untersucht werden, welche Bedeutung die dargestellten Bewusstseinszustände für eine Interpretation der Novelle haben. Hierbei soll insbesondere herausgearbeitet werden, inwieweit die Bewusstseinsveränderungen Lerchs im Laufe der Geschichte, ausgelöst durch bestimmte Ereignisse und Begegnungen, die Befehlsverweigerung am Ende des Textes erklären können. Zu diesem Zweck werden auch einige Arbeiten zur Interpretation der Reitergeschichte, soweit sie in Zusammenhang mit der gewählten Betrachtungsweise stehen, im Rahmen der Untersuchung unterstützend bzw. kontrastierend aufgegriffen.
Eine zu einseitige Interpretation der geschilderten Bewusstseinsphänomene (im Sinne einer bestimmten psychologischen Theorie) soll vermieden werden, die Unbestimmtheit und Irrationalität der geschilderten bewussten und unbewussten psychologischen Motive soll auch im Rahmen einer Interpretation nicht auf eindeutige, rational vollkommen verstehbare Beweggründe im Sinne eines bestimmten Interpretationsschemas reduziert werden.
Es wird die These aufgestellt, dass die komplexe Gesamtheit der im Laufe der Geschichte bei Lerch geweckten Empfindungen, Gefühle, Wünsche und Triebe zu der Befehlsverweigerung führt, die ihm am Ende den Tod bringt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung von Bewusstseinszuständen und deren Bedeutung für eine Interpretation der Novelle
- Triumphale Stimmung beim Ritt durch Mailand
- Begegnung mit der Vuic und Durst nach unerwartetem Erwerb
- Aufgeregte Einbildung beim Ritt durchs Dorf
- Die Erbeutung des Eisenschimmels und die symbolische Befriedigung
- Zorn, Befehlsverweigerung und das Ende
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Bewusstseinszuständen des Protagonisten Anton Lerch in Hugo von Hofmannsthals "Reitergeschichte" und deren Bedeutung für die Interpretation der Novelle. Der Fokus liegt darauf, wie Lerchs Bewusstseinsveränderungen, ausgelöst durch Ereignisse und Begegnungen, seine letztendliche Befehlsverweigerung erklären können. Dabei wird eine einseitige psychologische Interpretation vermieden, stattdessen wird die Unbestimmtheit und Irrationalität der dargestellten Motive berücksichtigt.
- Darstellung von Bewusstseinszuständen bei Anton Lerch
- Einfluss von Ereignissen und Begegnungen auf Lerchs Psyche
- Interpretation der Befehlsverweigerung am Ende der Novelle
- Ambivalenz und Irrationalität der psychologischen Motive
- Zusammenhang zwischen Lerchs Empfindungen und seinem Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit: die Analyse der Bewusstseinszustände von Anton Lerch in Hofmannsthals "Reitergeschichte" und deren Rolle für die Interpretation der Novelle. Es wird betont, dass die Arbeit die Bewusstseinsveränderungen Lerchs im Kontext bestimmter Ereignisse untersucht und dabei versucht, seine Befehlsverweigerung am Ende zu erklären. Die Autorin kündigt an, verschiedene Interpretationen der "Reitergeschichte" unterstützend oder kontrastierend zu berücksichtigen, ohne jedoch eine zu einseitige psychologische Interpretation anzustreben. Stattdessen soll die Unbestimmtheit und Irrationalität der psychologischen Motive berücksichtigt werden. Die These wird aufgestellt, dass die Gesamtheit der bei Lerch geweckten Empfindungen, Gefühle und Triebe zur Befehlsverweigerung und seinem Tod führt.
Darstellung von Bewusstseinszuständen und deren Bedeutung für eine Interpretation der Novelle: Dieses Kapitel analysiert die Bewusstseinszustände Lerchs im Verlauf der Geschichte. Es beginnt mit der Beschreibung der triumphalen Stimmung der Kavallerie nach siegreichen Gefechten in Mailand. Der Fokus verschiebt sich dann auf Lerchs individuelle Erfahrung, seine Begegnung mit einem bekannten Gesicht und die damit verbundene Ablösung von der Gruppe. Der Text legt nahe, dass Lerchs Bewusstseinszustände nicht nur durch kollektive Ereignisse, sondern auch durch persönliche Erlebnisse geprägt werden, und dass diese Entwicklung zu seiner Befehlsverweigerung führt. Die Beschreibung der verschiedenen Phasen seines Bewusstseins dient als Grundlage für die Interpretation der gesamten Novelle.
Schlüsselwörter
Hugo von Hofmannsthal, Reitergeschichte, Bewusstseinszustände, Interpretation, Novelle, Anton Lerch, Befehlsverweigerung, Psychologie, Ambivalenz, Irrationalität.
Häufig gestellte Fragen zur Reitergeschichte von Hugo von Hofmannsthal
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Bewusstseinszuständen des Protagonisten Anton Lerch in Hugo von Hofmannsthals Novelle "Reitergeschichte" und deren Bedeutung für die Interpretation des Werks. Der Fokus liegt auf der Erklärung von Lerchs Befehlsverweigerung am Ende der Novelle durch seine Bewusstseinsveränderungen, ausgelöst durch verschiedene Ereignisse und Begegnungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Bewusstseinszuständen bei Anton Lerch, den Einfluss von Ereignissen und Begegnungen auf seine Psyche, die Interpretation seiner Befehlsverweigerung, die Ambivalenz und Irrationalität der psychologischen Motive sowie den Zusammenhang zwischen Lerchs Empfindungen und seinem Handeln. Es wird eine einseitige psychologische Interpretation vermieden und stattdessen die Unbestimmtheit und Irrationalität der dargestellten Motive berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Analyse der Bewusstseinszustände und deren Bedeutung für die Interpretation, und eine Schlussbemerkung. Das Hauptkapitel untersucht verschiedene Phasen von Lerchs Bewusstseinszustand, beginnend mit dem triumphalen Ritt durch Mailand bis hin zur finalen Befehlsverweigerung. Die Arbeit enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche konkreten Bewusstseinszustände von Anton Lerch werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Bewusstseinszustände Lerchs, darunter die triumphale Stimmung beim Ritt durch Mailand, die Begegnung mit der Vuic und den damit verbundenen Durst nach unerwartetem Erwerb, die aufgeregte Einbildung beim Ritt durchs Dorf, die Erbeutung des Eisenschimmels und die damit verbundene symbolische Befriedigung, sowie schließlich Zorn und Befehlsverweigerung am Ende der Novelle.
Wie wird die Befehlsverweigerung Lerchs interpretiert?
Die Befehlsverweigerung wird nicht als isolierter Akt interpretiert, sondern als Ergebnis einer Entwicklung von Lerchs Bewusstseinszuständen, die durch verschiedene Ereignisse und Begegnungen geprägt sind. Die Arbeit betont die Bedeutung der Gesamtheit der bei Lerch geweckten Empfindungen, Gefühle und Triebe für seine finale Entscheidung.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen interpretativen Ansatz, der die Bewusstseinsveränderungen Lerchs im Kontext der Ereignisse der Novelle untersucht. Sie vermeidet eine einseitige psychologische Interpretation und berücksichtigt die Unbestimmtheit und Irrationalität der dargestellten Motive. Verschiedene Interpretationen der "Reitergeschichte" werden unterstützend oder kontrastierend berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Hugo von Hofmannsthal, Reitergeschichte, Bewusstseinszustände, Interpretation, Novelle, Anton Lerch, Befehlsverweigerung, Psychologie, Ambivalenz, Irrationalität.
- Quote paper
- Vanessa Lichtsinn (Author), 2003, Darstellung von Bewusstseinszuständen in Hugo von Hofmannsthals "Reitergeschichte" und deren Bedeutung für eine Interpretation der Novelle , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64978