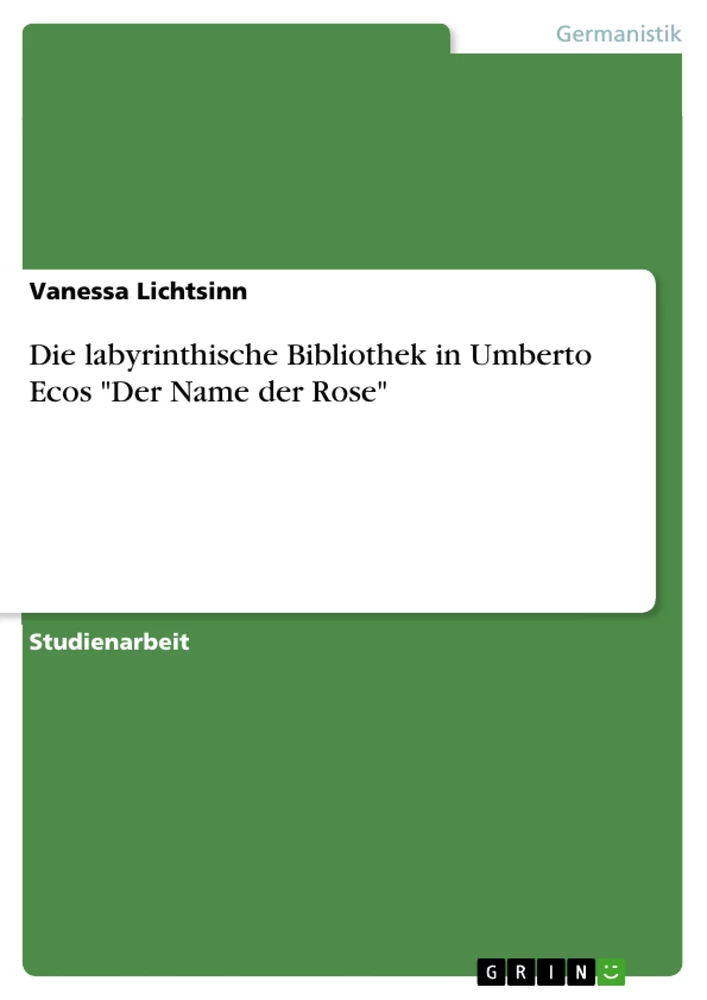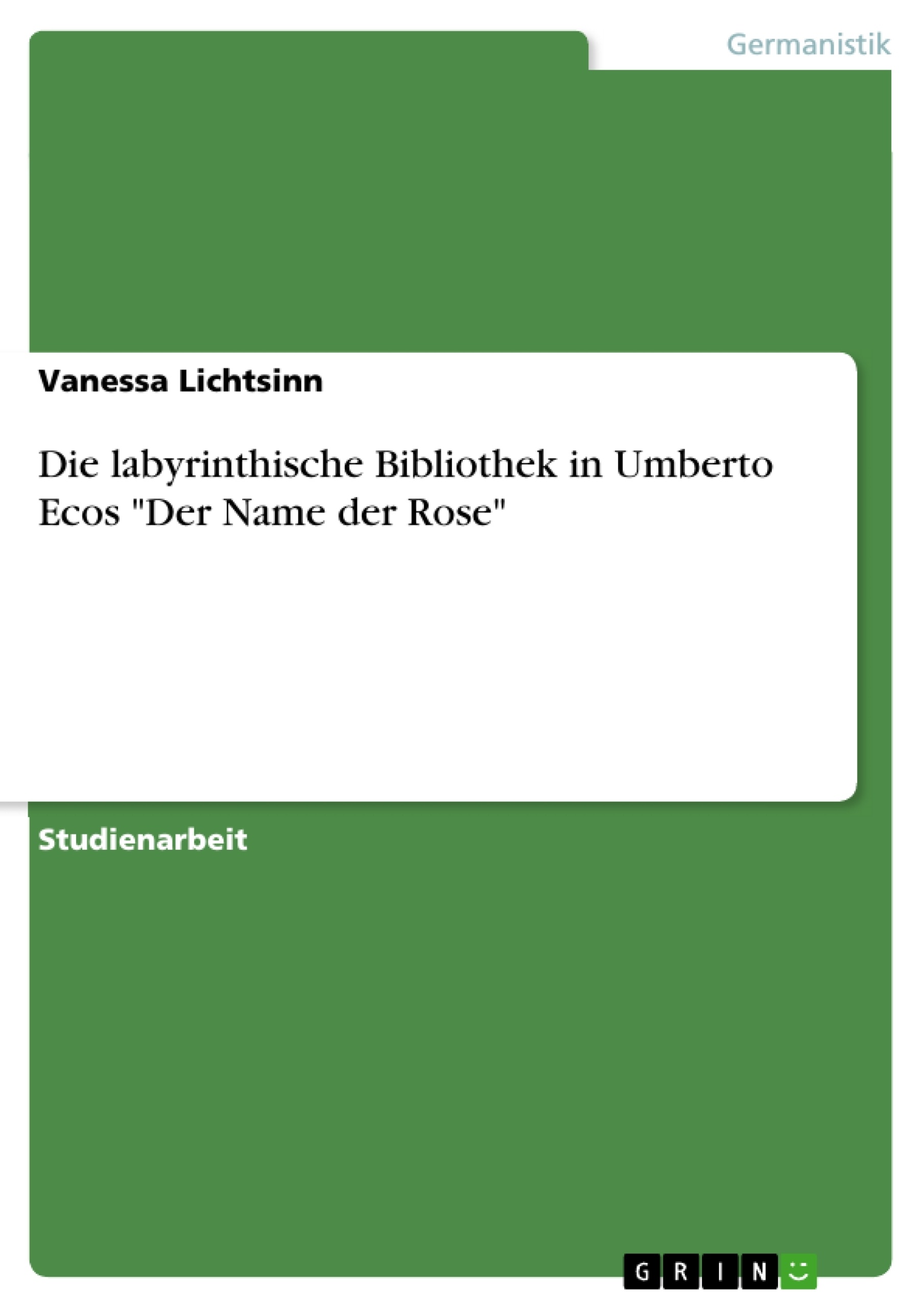Es ist unübersehbar, dass der Bibliothek der Benediktinerabtei im nördlichen Apennin in diesem Roman, der eine Mischung aus Krimi und historischem Roman darstellt und im Jahre 1327 spielt, eine ganz zentrale Rolle zukommt:
William von Baskerville und sein Novize Adson von Melk werden darum gebeten einen seltsamen Todesfall aufzuklären. Die beiden beginnen mit ihren Recherchen, können jedoch auch weitere mysteriöse Todesfälle in der Abtei nicht verhindern. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie immer wieder auf die reich ausgestattete aber verbotene und labyrinthische Klosterbibliothek, die offensichtlich etwas beherbergt, das im Verborgenen bleiben soll und für das jemand Morde begeht.
Wie und warum Umberto Eco diese Bibliothek so geheimnisumwoben, verwirrend, verboten und geradezu so negativ darstellt, soll im Folgenden näher dargelegt werden.
Zu diesem Zweck wird der Schwerpunkt im ersten Teil dieser Arbeit, der den Titel „Die Bibliothek im Namen der Rose“ trägt, vor allem deskriptiv auf die besondere Architektonik („Die Bibliothek als Labyrinth“), das geheimnisvolle Inventar sowie den Bibliothekar als Machthaber der Bibliothek gelegt.
Für den zweiten Teil der Hausarbeit wird auch Ecos autobiographisch gefärbter Essay Die Bibliothek herangezogen, um die Beweggründe des Autors – eine so benutzerunfreundliche Bibliothek zu erschaffen – ansatzweise interpretieren zu können. Ebenso wird untersucht, inwieweit sich Eco für seinen Roman von Jorge Luis Borges und dessen Erzählung Die Bibliothek von Babel inspirieren ließ. Demnach ist dieser Teil der vorliegenden Hausarbeit mit „Die Motive des Autors“ überschrieben
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Bibliothek im Namen der Rose
- 2.1 Die Bibliothek als Labyrinth
- 2.1.1 Gefährliche Literatur
- 2.1.2 Verschleierung des Wissens
- 2.1.3 Der eigentliche Bibliothekar und Machthaber über das Wissen
- 2.1 Die Bibliothek als Labyrinth
- 3. Die Motive des Autors
- 3.1 Ecos Negativmodell der Bibliothek
- 3.2 Vergleiche zu Jorge Luis Borges sowie zu seiner Erzählung Die Bibliothek von Babel
- 4. Resümee
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Bibliothek in Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“. Ziel ist es, die besondere Architektonik, das geheimnisvolle Inventar und die Rolle des Bibliothekars als Machthaber zu analysieren und die Motive des Autors hinter dieser negativen Darstellung zu interpretieren. Dabei werden Vergleiche zu Jorge Luis Borges und dessen „Bibliothek von Babel“ gezogen.
- Die Bibliothek als Labyrinth und Symbol der Wissenskontrolle
- Das verbotene Wissen und die Gefahren der Literatur
- Der Bibliothekar als Hüter und Machthaber des Wissens
- Ecos Kritik an der Institution Bibliothek
- Der Einfluss von Borges auf Ecos Roman
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die zentrale Rolle der Bibliothek im Roman „Der Name der Rose“. Sie skizziert die Forschungsfrage: Warum stellt Eco die Bibliothek so geheimnisumwoben und negativ dar? Die Arbeit gliedert sich in einen deskriptiven Teil, der die Bibliothek selbst beschreibt, und einen interpretativen Teil, der die Motive des Autors beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Architektonik der Bibliothek, ihrem Inventar, dem Bibliothekar und den Einflüssen von Borges.
2. Die Bibliothek im Namen der Rose: Dieses Kapitel beschreibt die Klosterbibliothek als ein imposantes, aber verbotenes Gebäude. Die Architektur wird als labyrinthisch dargestellt, was die Unzugänglichkeit des Wissens symbolisiert. Die enorme Buchsammlung wird als wertvoll und geheimnisvoll präsentiert, wobei das Verbot, die Bibliothek zu betreten, die Neugier des Lesers und der Protagonisten weckt und die zentrale Frage nach der Bedeutung dieser Verbote aufwirft. Der Bibliothekar erscheint als der einzige, der das Labyrinth der Bibliothek beherrscht und somit die Kontrolle über das Wissen besitzt. Das Verbot, die Bibliothek zu betreten, wird nicht nur durch den Abt, sondern auch durch die angebliche Selbstverteidigung der Bibliothek begründet, die als ein "geistiges und irdisches Labyrinth" beschrieben wird, das den Eintritt und den Ausgang erschwert.
3. Die Motive des Autors: Dieses Kapitel erforscht die Beweggründe Ecos, die Bibliothek so negativ darzustellen. Es wird Ecos Essay „Die Bibliothek“ herangezogen, um seine Ansichten über Bibliotheken zu verstehen. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit Borges' „Bibliothek von Babel“, um Parallelen und Unterschiede in der Darstellung von Bibliotheken und dem Umgang mit Wissen aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf Ecos Kritik an der Kontrolle und dem Missbrauch von Wissen durch Institutionen, wobei die labyrinthische Struktur der Bibliothek im Roman als Metapher für die Komplexität und die potenziellen Gefahren des Wissens interpretiert wird. Es werden die Widersprüche aufgezeigt: Eine riesige und wertvolle Bibliothek, die gleichzeitig unzugänglich und gefährlich ist, repräsentiert die Paradoxien der Wissensverwaltung und -kontrolle.
Schlüsselwörter
Der Name der Rose, Umberto Eco, Klosterbibliothek, Labyrinth, Wissen, Macht, Kontrolle, Verbotene Literatur, Jorge Luis Borges, Bibliothek von Babel, Negativmodell, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Name der Rose": Eine Analyse der Bibliotheksdarstellung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Bibliothek in Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose". Im Fokus stehen die Architektur der Bibliothek, ihr Inventar, die Rolle des Bibliothekars als Machthaber und die Motive des Autors hinter dieser negativen Darstellung. Vergleiche zu Jorge Luis Borges und seiner "Bibliothek von Babel" werden gezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Beschreibung der Bibliothek im Roman, ein Kapitel zur Interpretation der Autorenmotive und ein Resümee. Zusätzlich enthält sie ein Literaturverzeichnis.
Wie wird die Bibliothek in "Der Name der Rose" dargestellt?
Die Klosterbibliothek wird als imposantes, aber verbotenes Gebäude beschrieben. Ihre Architektur ist labyrinthisch, symbolisch für die Unzugänglichkeit des Wissens. Die umfangreiche Buchsammlung ist wertvoll und geheimnisvoll, das Betretungsverbot weckt Neugier und wirft Fragen nach der Bedeutung der Verbote auf. Der Bibliothekar kontrolliert das Labyrinth und damit das Wissen.
Welche Rolle spielt der Bibliothekar?
Der Bibliothekar wird als derjenige dargestellt, der die Bibliothek und damit das Wissen beherrscht. Er ist der Hüter und Machthaber des Wissens, kontrolliert den Zugang und bestimmt, was zugänglich ist und was nicht.
Welche Motive des Autors werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Ecos Beweggründe für die negative Darstellung der Bibliothek. Es wird sein Essay "Die Bibliothek" herangezogen und ein Vergleich mit Borges' "Bibliothek von Babel" angestellt. Im Fokus steht Ecos Kritik an der Kontrolle und dem Missbrauch von Wissen durch Institutionen. Die labyrinthische Struktur der Bibliothek wird als Metapher für die Komplexität und Gefahren des Wissens interpretiert.
Welche Bedeutung hat der Vergleich mit Borges' "Bibliothek von Babel"?
Der Vergleich mit Borges' "Bibliothek von Babel" dient dazu, Parallelen und Unterschiede in der Darstellung von Bibliotheken und dem Umgang mit Wissen aufzuzeigen. Er hilft, Ecos Kritik an der Wissenskontrolle besser zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Der Name der Rose, Umberto Eco, Klosterbibliothek, Labyrinth, Wissen, Macht, Kontrolle, Verbotene Literatur, Jorge Luis Borges, Bibliothek von Babel, Negativmodell, Mittelalter.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum stellt Eco die Bibliothek in "Der Name der Rose" so geheimnisumwoben und negativ dar?
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert deskriptive Elemente, die die Bibliothek beschreiben, mit interpretativen Elementen, die die Motive des Autors beleuchten. Der Fokus liegt auf der Architektonik der Bibliothek, ihrem Inventar, dem Bibliothekar und den Einflüssen von Borges.
- Quote paper
- Vanessa Lichtsinn (Author), 2006, Die labyrinthische Bibliothek in Umberto Ecos "Der Name der Rose", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64970