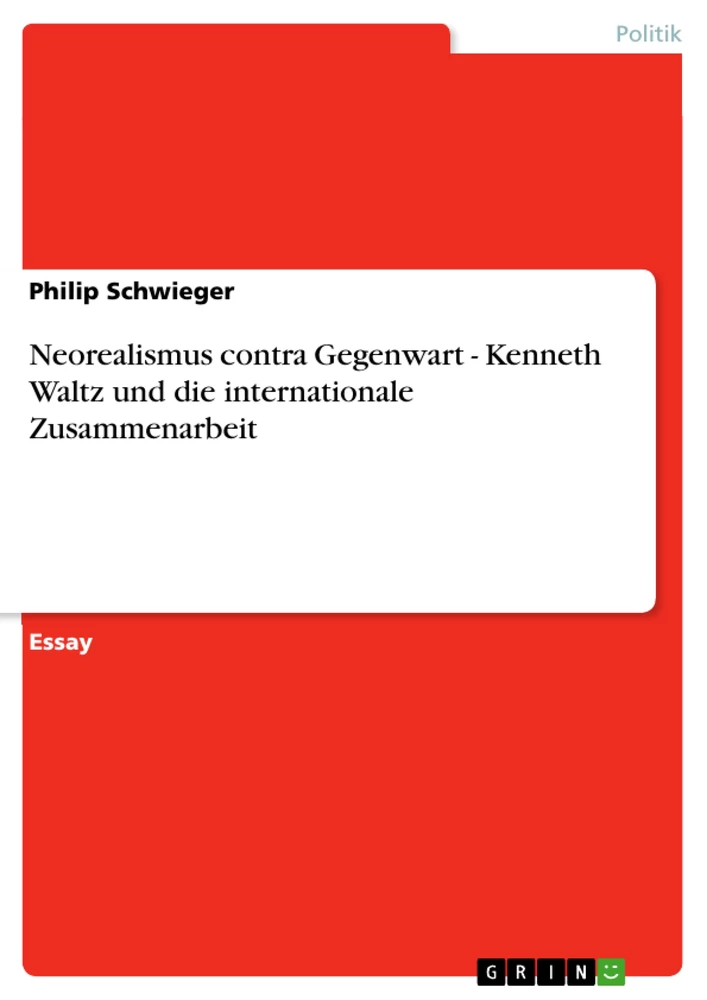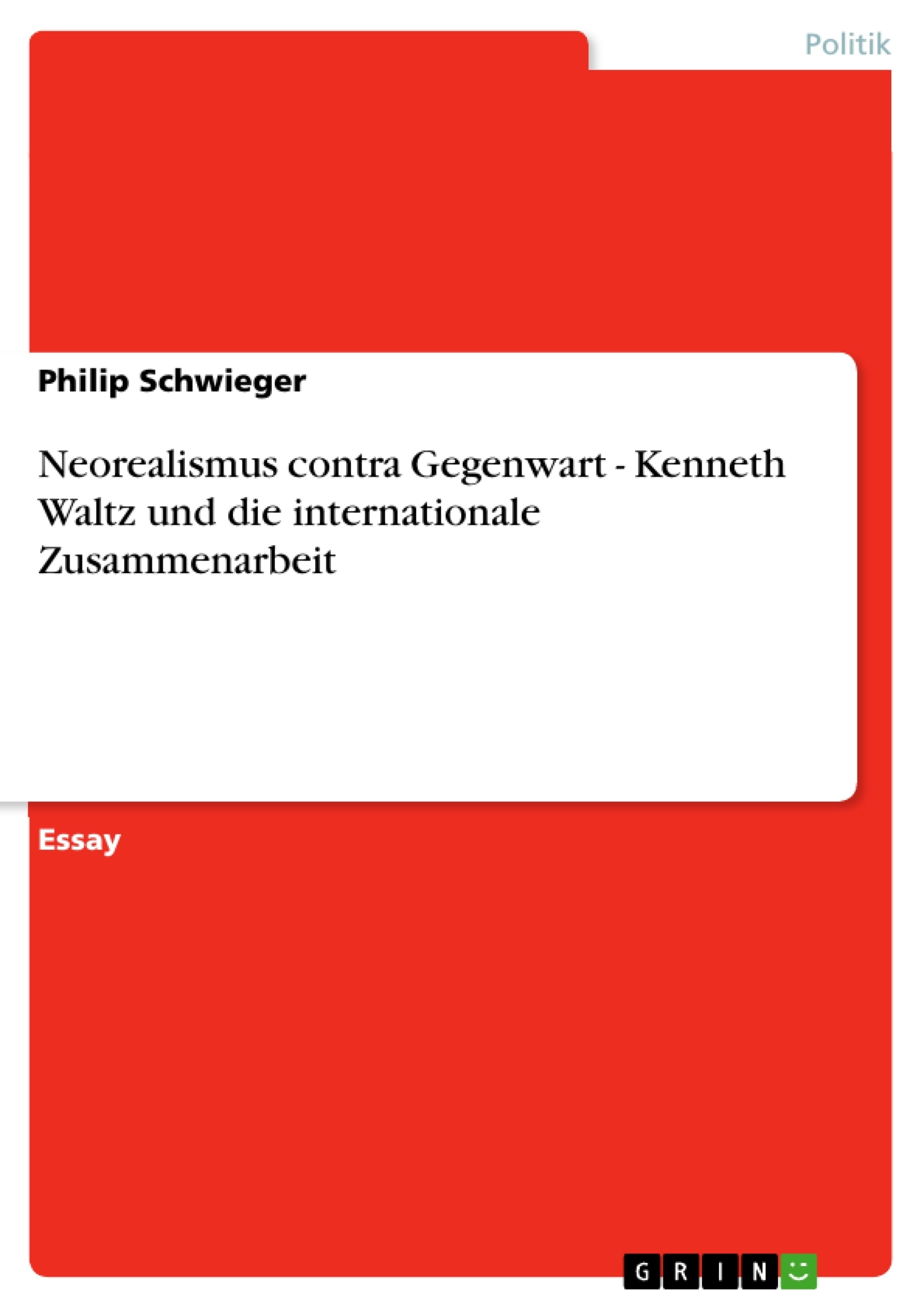Die von Kenneth N. Waltz entwickelte Theorie des strukturellen Realismus, häufig auch als Neorealismus bezeichnet, entstand zu Hochzeiten des Kalten Krieges Ende der 70er Jahre. Diese Systemtheorie der internationalen Beziehungen bezeichnet das Verhalten von Staaten als alleinigen Akteuren im internationalen System als von der Struktur des Systems abhängig und begründet jegliches staatliches Handeln als geleitet von der Absicht, Macht - und damit Sicherheit - zu akkumulieren. Nach dem Ende der von Waltz als wichtig für die Stabilität des internationalen Systems angesehenen Bipolarität des Kalten Krieges wurden etliche Stimmen, vor allem aus dem Lager der liberalen Institutionalisten, laut, die das Ende der realistischen Theorie verkündeten und auf die - angeblich - gewachsene weltpolitische Bedeutung multilateraler internationaler Institutionen wie den Vereinten Nationen, der NATO und der Welthandelsorganisation hinwiesen. Auch betonten die Liberalisten den Frieden fördernden Effekt der Demokratisierungswelle, die die Welt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks überzog. Hauptsächlich richtete sich die liberalistisch-institutionalistische Kritik am Realismus gegen die geringe Bedeutung, die dieser internationalen Organisationen als eigenständigen Akteuren im Weltsystem zumisst. Tatsächlich gibt es bislang noch kein neues Ordnungsprinzip des internationalen Systems, welches die Machtverhältnisse zwischen den Staaten so eindeutig regelt, wie es die Bipolarität des Kalten Krieges vermochte. Daraus resultiert die Frage, mit der sich dieser Text weiterhin befassen wird: Kann Waltz’ Theorie des strukturellen Realismus auch in einer Welt, die durch eine gestiegene Partizipation der Nationalstaaten in internationalen Institutionen geprägt ist, ihren Gültigkeitsanspruch bewahren? Zur Beantwortung dieser Frage wird im Folgenden ein Blick auf die unterschiedlichen Motivationen von Staaten zur Mitarbeit in multilateralen Institutionen sowie das realpolitische Verhalten von Staaten am Beispiel USA geworfen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Das Ende des Kalten Krieges
- 2. Streit der Theorien und die Realpolitik der USA
- 2.1 Demokratischer Frieden und demokratische Kriege
- 2.2 Die USA und die Vereinten Nationen – ein zwiespältiges Verhältnis
- 2.3 Die „Emanzipation“ der NATO
- 2.4 Motivation für Partizipation
- 3. Fazit - Die Rechtfertigung des Realismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Frage, ob Kenneth Waltz' Theorie des strukturellen Realismus auch in einer Welt mit erhöhter Beteiligung von Nationalstaaten in internationalen Institutionen Gültigkeit beanspruchen kann. Die Arbeit analysiert das realpolitische Verhalten der USA im Kontext des internationalen Systems, untersucht die unterschiedlichen Motivationen von Staaten zur Mitarbeit in multilateralen Institutionen und hinterfragt die Rolle, die internationale Organisationen im Kontext des Realismus spielen.
- Die Gültigkeit des strukturellen Realismus im post-kalten Krieg
- Die Rolle der USA im internationalen System
- Die Bedeutung internationaler Organisationen
- Die Motivationen von Staaten zur Partizipation in internationalen Institutionen
- Demokratischer Frieden vs. Demokratische Kriege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Theorie des strukturellen Realismus von Kenneth Waltz vor und erläutert die Debatte um den Einfluss des Kalten Krieges auf das internationale System.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Streit zwischen Neorealismus und Liberalismus im Kontext der realpolitischen Handlungsweisen der USA. Dabei werden Themen wie die Rolle der USA im Rahmen der Vereinten Nationen und der NATO sowie die Frage der Motivation für staatliche Partizipation in internationalen Organisationen diskutiert.
Schlüsselwörter
Struktureller Realismus, Neorealismus, Kenneth Waltz, Internationale Beziehungen, Internationale Organisationen, USA, Vereinte Nationen, NATO, Demokratischer Frieden, Demokratische Kriege, Macht, Sicherheit, Balancing, Partizipation.
- Quote paper
- Philip Schwieger (Author), 2006, Neorealismus contra Gegenwart - Kenneth Waltz und die internationale Zusammenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64956