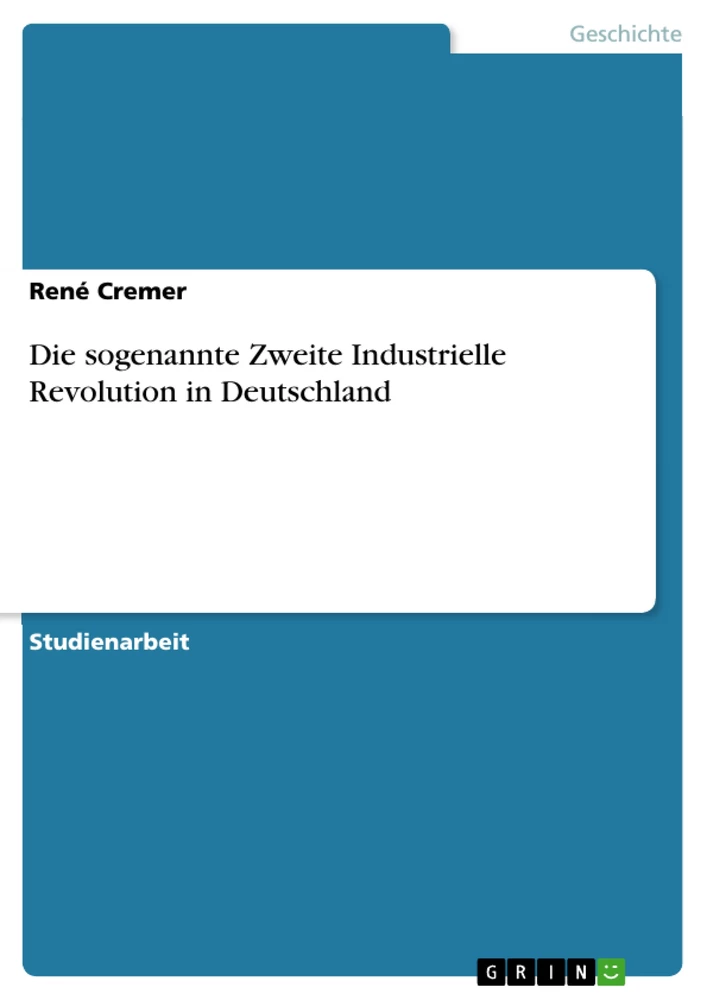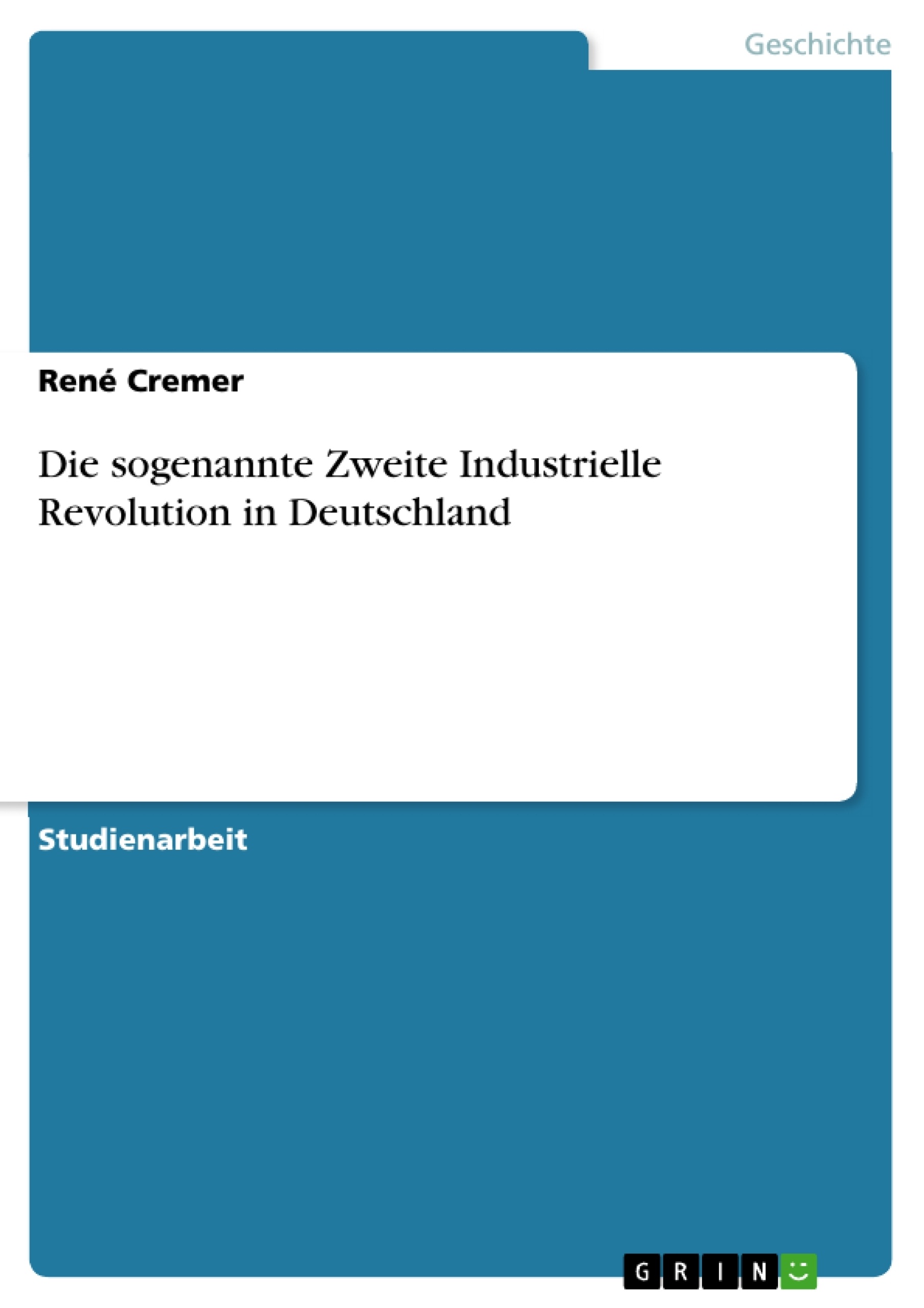Im Mittelpunkt dieser Seminararbeit steht jene Zeitspanne, die das Deutsche Kaiserreich zur Industrienation werden ließ - die 1880er bis 1910er Jahre.
In jenen Jahrzehnten gelang es den so genannten "neuen Industrien" sich nicht nur neben den klassischen schwer-industriellen Elementen einer prosperierenden Volkswirtschaft zu etablieren, sondern auch im globalem Maßstab zu agieren.
Im Kaiserreich erlangten die chemische und die elektrotechnische Industrie so große Dimensionen, dass Deutschland um 1900 in jenen Bereichen nahezu weltweit führend war. Es lohnt allein deshalb ein genauerer Blick auf diese "neuen Industrien" der deutschen Wirtschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Die „neuen Industrien“
- Die chemische Industrie
- Die Elektroindustrie
- Wirtschaftsstand von 1913/14
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sogenannte „Zweite Industrielle Revolution“ in Deutschland zwischen 1873 und 1914, mit Fokus auf die Entstehung und den Aufstieg neuer Industriezweige. Ziel ist es, den „Siegeszug“ der chemischen und elektrotechnischen Industrie im Kontext der damaligen gesamthistorischen Entwicklung zu erklären.
- Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands zwischen 1873 und 1914
- Der Aufstieg der chemischen und elektrotechnischen Industrie
- Der Einfluss der Gründerkrise und der „Großen Depression“
- Die Rolle des deutschen Kaiserreichs und seiner Außen- und Innenpolitik
- Die soziale Frage im Kontext der Industrialisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung legt den Fokus der Arbeit auf die Zeit zwischen 1873 und 1914, um die grundlegende Entwicklung der „zweiten industriellen Revolution“ im Deutschen Kaiserreich zu analysieren. Der Erste Weltkrieg wird explizit ausgeschlossen. Die Arbeit beschreibt den Wandel Deutschlands von einem Agrar- zu einem Industriezustand und hebt die Bedeutung neuer Industriezweige wie der chemischen und elektrotechnischen Industrie hervor. Der Text kündigt die Struktur der Arbeit an, mit einer Betrachtung des historischen Kontextes, einer detaillierten Analyse der neuen Industrien und einer abschließenden Darstellung des wirtschaftlichen Standes von 1913/14.
Historischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 und das anfängliche Misstrauen der europäischen Großmächte. Es wird Bismarcks Politik der "Sättigung" und die damit verbundene außenpolitische Konsolidierung hervorgehoben. Im Gegensatz dazu werden die innenpolitischen Herausforderungen thematisiert, insbesondere die „Soziale Frage“ und die Gründerkrise (1873-1890er Jahre). Das Kapitel widerlegt die Annahme eines wirtschaftlichen Stillstands während der „Großen Depression“ und betont die kontinuierliche, wenn auch verlangsamte, wirtschaftliche Entwicklung. Die Einführung von Schutzzöllen für Agrar- und schwerindustrielle Produkte wird als Reaktion auf den Wettbewerb durch billiges Überseegetreide dargestellt, sowie die zunehmende Bedeutung von Interessenverbänden wie dem Bund der Landwirte (BdL) und dem Bund der Industriellen (BDI).
Schlüsselwörter
Zweite Industrielle Revolution, Deutsches Kaiserreich, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Gründerkrise, Soziale Frage, Schutzzölle, Wirtschaftswachstum, Hochindustrialisierung, Industrieland, Agrarwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Text über die Zweite Industrielle Revolution in Deutschland
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert die „Zweite Industrielle Revolution“ im Deutschen Kaiserreich zwischen 1873 und 1914. Der Fokus liegt auf dem Aufstieg neuer Industriezweige, insbesondere der chemischen und elektrotechnischen Industrie, im Kontext der gesamthistorischen Entwicklung. Der Erste Weltkrieg wird explizit ausgeklammert.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands zwischen 1873 und 1914, den Aufstieg der chemischen und elektrotechnischen Industrie, den Einfluss der Gründerkrise und der „Großen Depression“, die Rolle des deutschen Kaiserreichs und seiner Politik, und die soziale Frage im Kontext der Industrialisierung. Es wird der Wandel Deutschlands von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft beleuchtet.
Welche Kapitel enthält der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Historischer Kontext, Die „neuen Industrien“ (mit Unterkapiteln zur chemischen und Elektroindustrie), Wirtschaftsstand von 1913/14 und Schlussbetrachtung (obwohl der Inhalt der Schlussbetrachtung nicht explizit beschrieben ist).
Wie wird der historische Kontext dargestellt?
Der historische Kontext beschreibt die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871, die anfängliche Zurückhaltung der europäischen Großmächte, Bismarcks Politik der „Sättigung“, die innenpolitischen Herausforderungen (Soziale Frage, Gründerkrise), und widerlegt die Annahme eines wirtschaftlichen Stillstands während der „Großen Depression“. Es wird die Bedeutung von Schutzzöllen und Interessenverbänden wie dem Bund der Landwirte (BdL) und dem Bund der Industriellen (BDI) hervorgehoben.
Was ist das Ziel des Textes?
Ziel des Textes ist es, den Aufstieg der chemischen und elektrotechnischen Industrie im Kontext der damaligen gesamthistorischen Entwicklung zu erklären und den wirtschaftlichen Wandel Deutschlands in diesem Zeitraum zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Zweite Industrielle Revolution, Deutsches Kaiserreich, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Gründerkrise, Soziale Frage, Schutzzölle, Wirtschaftswachstum, Hochindustrialisierung, Industrieland, Agrarwirtschaft.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Zeit zwischen 1873 und 1914, den Wandel von Agrar- zu Industriezustand und die Bedeutung neuer Industriezweige. Sie kündigt die Struktur der Arbeit an.
- Quote paper
- René Cremer (Author), 2005, Die sogenannte Zweite Industrielle Revolution in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64944