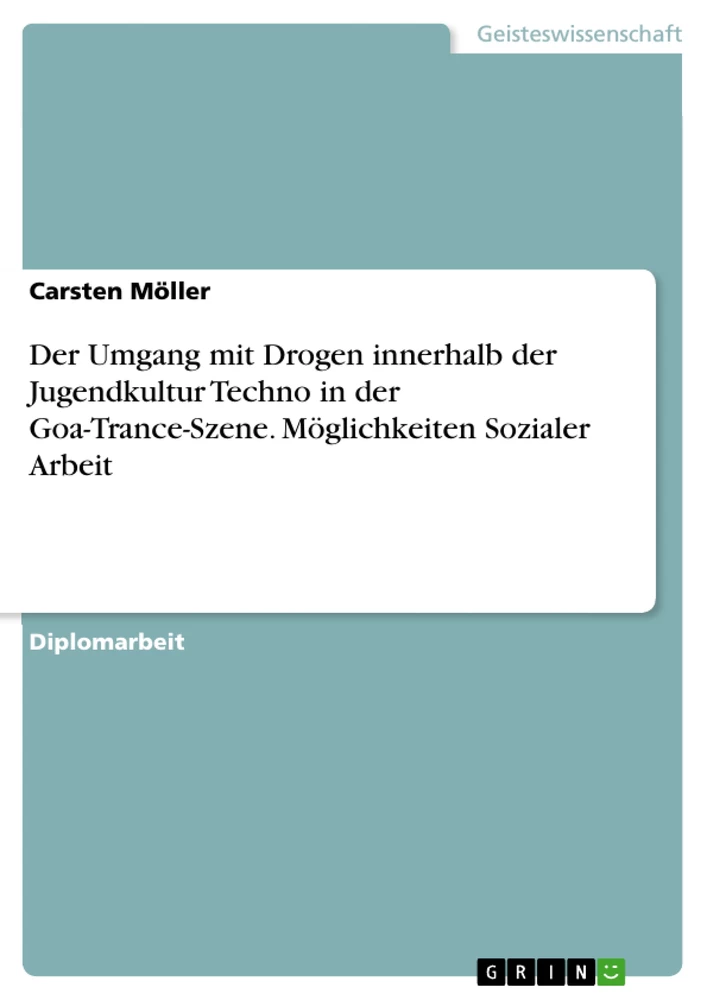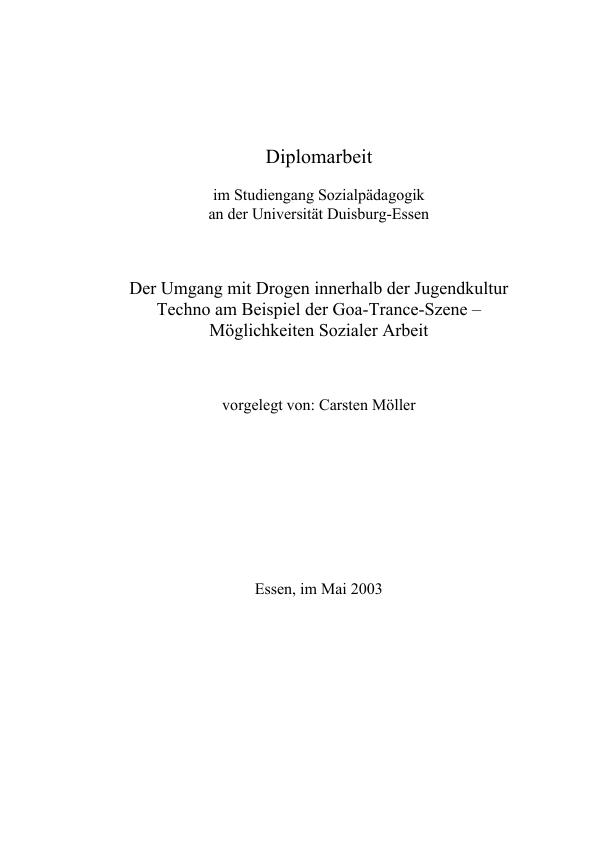Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit einem der größten jugendkulturellen Phänomene des ausgegangenen 20. Jahrhunderts. Europaweit besuchen schätzungsweise 20 Millionen Jugendliche mehr oder weniger regelmäßig Tanz-Veranstaltungen (Partys) auf denen Techno-Musik gespielt wird.
Nicht allein die Musik, die ausschweifenden Partys und der lustbetonte Lebensstil der Techno-Anhänger haben dafür gesorgt, Techno regelmäßig in die Schlagzeilen der Medien zu bringen, sondern in erster Linie die mit dieser Musik- und Tanz-Kultur offenbar eng verbundene Vorliebe der Party-Besucher für bestimmte illegale Drogen. Verharmlosende Berichte einerseits, sowie Schreckensmeldungen über die unterschätzten Gefahren des Konsums dieser Drogen andererseits, scheinen dabei gleichermaßen vorzukommen und machen es dem interessierten Leser unmöglich, sich ein einigermaßen realistisches Bild von der Problematik zu machen. Ein Anliegen dieser Arbeit ist es daher, den aktuellen Wissensstand der Techno- und Drogen-Forschung hinsichtlich der thematischen Vorgaben und unter Berücksichtigung eigener Erfahrungen mit der Techno-Kultur zu rekonstruieren.
Bei dem verwendeten Material handelt es sich zum Großteil um Ergebnisse von Forschungsarbeiten bzw. um Fachbücher, deren Autoren und Herausgeber sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit der Thematik auseinandergesetzt haben, sowie um einige wenige Internetquellen und szeneinterne Publikationen. Speziell der Bereich der so genannten „Goa-Trance-Szene“ war meines Wissens bisher noch kein Gegenstand von Forschungsarbeiten, sodass ich hier nur bedingt auf wissenschaftliches Material zurückgreifen kann. Stattdessen sollen an den entsprechenden Stellen dieser Arbeit meine eigenen Beobachtungen und Erlebnisse in Form von Erfahrungsberichten dargestellt werden.
Ziel dieser Untersuchung ist es, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aspekten von Techno als Jugend-, Tanz- und Ausgeh-Kultur zu finden, um ein Verständnis für die Ursachen und Folgen des Konsums von Drogen in diesem Bereich zu entwickeln. Dabei möchte ich die aus dem Partydrogenkonsum resultierenden Gefahren und Risiken, sowie Möglichkeiten zur Vermeidung bzw. Verminderung derselben, herausarbeiten und schließlich mögliche Handlungsfelder für die soziale Arbeit mit Technopartygängern aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung der Techno-Kultur und der Goa-Trance-Szene
- 2.1 Begriffsbestimmung Jugend, Jugendkultur und Szene
- 2.2 Techno-Musik
- 2.3 Techno-Partys
- 2.4 Techno-Tanz
- 2.5 Techno - eine Drogen-Kultur?
- 2.6 Besonderheiten der Goa-Trance-Szene
- 3. Techno-Party-Drogen
- 3.1 Begriffsbestimmungen
- 3.1.1 Party-Drogen
- 3.1.2 Designer-Drogen
- 3.2 Klassifikation der Substanzen
- 3.3 Charakteristik der gebräuchlichsten Party-Drogen
- 3.3.1 Ecstasy
- 3.3.2 Amphetamine
- 3.1 Begriffsbestimmungen
- 4. Drogenkonsum in der Techno-Party-Szene
- 4.1 Verbreitung und Häufigkeit
- 4.2 Begründungen für den Ecstasykonsum
- 4.3 Begründungen für den Mischkonsum
- 4.4 Risikowahrnehmung und Bewältigungsstrategien
- 4.5 Begründungen für das Einstellen des Drogenkonsums
- 5. Präventions- und Interventionsmöglichkeiten sozialer Arbeit
- 5.1 Begriffsbestimmung Prävention
- 5.2 Präventionsmöglichkeiten innerhalb der Techno-Party-Szene
- 5.2.1 Niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit
- 5.2.2 Sekundärpräventive Ansätze und Konzepte
- 5.2.3 Peer-Intervention
- 5.2.4 Mögliche sozialpädagogische Handlungsfelder
- 6. Schlussbetrachtung / Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Umgang mit Drogen in der Techno-Szene, insbesondere der Goa-Trance-Szene, und beleuchtet Möglichkeiten der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Ziel ist es, ein umfassendes Bild des Phänomens zu zeichnen und handlungsrelevante Erkenntnisse für präventive und interventive Maßnahmen zu gewinnen.
- Drogenkonsum in der Techno-Szene: Verbreitung, Häufigkeit und Gründe
- Charakteristika der Techno-Kultur und der Goa-Trance-Szene
- Wirkungen und Risiken verschiedener Partydrogen
- Präventions- und Interventionsstrategien der Sozialen Arbeit
- Integration der Techno-Szene in die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Drogenkonsums innerhalb der Techno-Jugendkultur ein und stellt die Relevanz der Arbeit heraus. Sie skizziert die weitverbreitete Popularität von Techno-Partys und deren mediale Präsenz, hebt die Verbindung von Techno-Kultur und Drogenkonsum hervor und benennt die Schwierigkeiten, ein objektives Bild aufgrund der Heterogenität und Dynamik des Phänomens zu zeichnen. Die Arbeit zielt darauf ab, den aktuellen Forschungsstand zu rekonstruieren und eigene Erfahrungen einzubeziehen.
2. Darstellung der Techno-Kultur und der Goa-Trance-Szene: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Jugend, Jugendkultur und Szene und beschreibt die Techno-Musik, -Partys und -Tanz als zentrale Elemente der Techno-Kultur. Es analysiert den Zusammenhang zwischen Techno und Drogenkonsum und beleuchtet die Besonderheiten der Goa-Trance-Szene, um den Kontext des Drogenkonsums zu verstehen. Die Kapitelteile untersuchen die kulturellen Ausdrucksformen und ihre gesellschaftliche Einbettung, von den Anfängen als Randerscheinung bis zur Integration in die Konsumgesellschaft.
3. Techno-Party-Drogen: Dieses Kapitel definiert Party-Drogen und Designer-Drogen und klassifiziert die in der Techno-Szene gebräuchlichen Substanzen. Es beschreibt ausführlich die Charakteristika von Ecstasy und Amphetaminen, einschließlich ihrer Wirkungen, Risiken und Konsummuster. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung der Substanzen, um das Verständnis für die damit verbundenen Gefahren und die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen zu fördern.
4. Drogenkonsum in der Techno-Party-Szene: Dieses Kapitel analysiert die Verbreitung und Häufigkeit des Drogenkonsums in der Techno-Szene. Es untersucht die Beweggründe für den Konsum von Ecstasy und Mischkonsum sowie die Risikowahrnehmung und Bewältigungsstrategien der Konsumenten. Weiterhin werden die Gründe für den Abbruch des Drogenkonsums beleuchtet. Der Kapitelteil bietet somit einen tiefen Einblick in die Motivationen und die subjektive Erfahrung der Konsumenten.
5. Präventions- und Interventionsmöglichkeiten sozialer Arbeit: Das Kapitel definiert Prävention und präsentiert verschiedene Präventionsmöglichkeiten innerhalb der Techno-Party-Szene. Es beschreibt niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, sekundärpräventive Ansätze und Peer-Intervention. Schließlich werden mögliche sozialpädagogische Handlungsfelder skizziert, um gezielte Unterstützung und Prävention zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Techno-Kultur, Goa-Trance-Szene, Drogenkonsum, Partydrogen, Ecstasy, Amphetamine, Jugendkultur, Soziale Arbeit, Prävention, Intervention, Risikowahrnehmung, Mischkonsum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Drogenkonsum in der Techno-Szene
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Drogenkonsum in der Techno-Szene, insbesondere der Goa-Trance-Szene, und beleuchtet Möglichkeiten der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild des Phänomens zu zeichnen und handlungsrelevante Erkenntnisse für präventive und interventive Maßnahmen zu gewinnen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Verbreitung und Häufigkeit des Drogenkonsums in der Techno-Szene, die Charakteristika der Techno-Kultur und der Goa-Trance-Szene, die Wirkungen und Risiken verschiedener Partydrogen (insbesondere Ecstasy und Amphetamine), Präventions- und Interventionsstrategien der Sozialen Arbeit und die Integration der Techno-Szene in die Gesellschaft. Die Arbeit beinhaltet eine Begriffsbestimmung von Jugend, Jugendkultur und Szene, sowie eine Klassifizierung der in der Szene gebräuchlichen Substanzen.
Welche Drogen stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Arbeit konzentriert sich auf Ecstasy und Amphetamine als besonders relevante Partydrogen in der Techno-Szene. Es wird jedoch auch der Mischkonsum verschiedener Substanzen thematisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Darstellung der Techno-Kultur und der Goa-Trance-Szene, Techno-Party-Drogen, Drogenkonsum in der Techno-Party-Szene, Präventions- und Interventionsmöglichkeiten sozialer Arbeit und Schlussbetrachtung/Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit rekonstruiert den aktuellen Forschungsstand und bezieht eigene Erfahrungen mit ein. Die genaue Methodik wird im Text detailliert beschrieben, jedoch wird die Arbeit primär auf der Analyse bestehender Literatur und Forschungsarbeiten basieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen werden im letzten Kapitel gezogen und bieten einen Ausblick auf zukünftige Forschungs- und Handlungsfelder. Die Arbeit zielt darauf ab, handlungsrelevante Erkenntnisse für die Soziale Arbeit zu liefern und Möglichkeiten der Prävention und Intervention aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in dieser Arbeit?
Die Soziale Arbeit spielt eine zentrale Rolle, indem sie mögliche Präventions- und Interventionsstrategien innerhalb der Techno-Party-Szene untersucht. Die Arbeit beschreibt niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenarbeit, sekundärpräventive Ansätze und Peer-Intervention als mögliche Handlungsfelder.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Sozialarbeiter, Präventionsspezialisten, sowie alle, die sich für Jugendkultur, Drogenprävention und die Techno-Szene interessieren.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Techno-Kultur, Goa-Trance-Szene, Drogenkonsum, Partydrogen, Ecstasy, Amphetamine, Jugendkultur, Soziale Arbeit, Prävention, Intervention, Risikowahrnehmung, Mischkonsum.
- Quote paper
- Diplom-Sozialpädagoge Carsten Möller (Author), 2003, Der Umgang mit Drogen innerhalb der Jugendkultur Techno in der Goa-Trance-Szene. Möglichkeiten Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64856