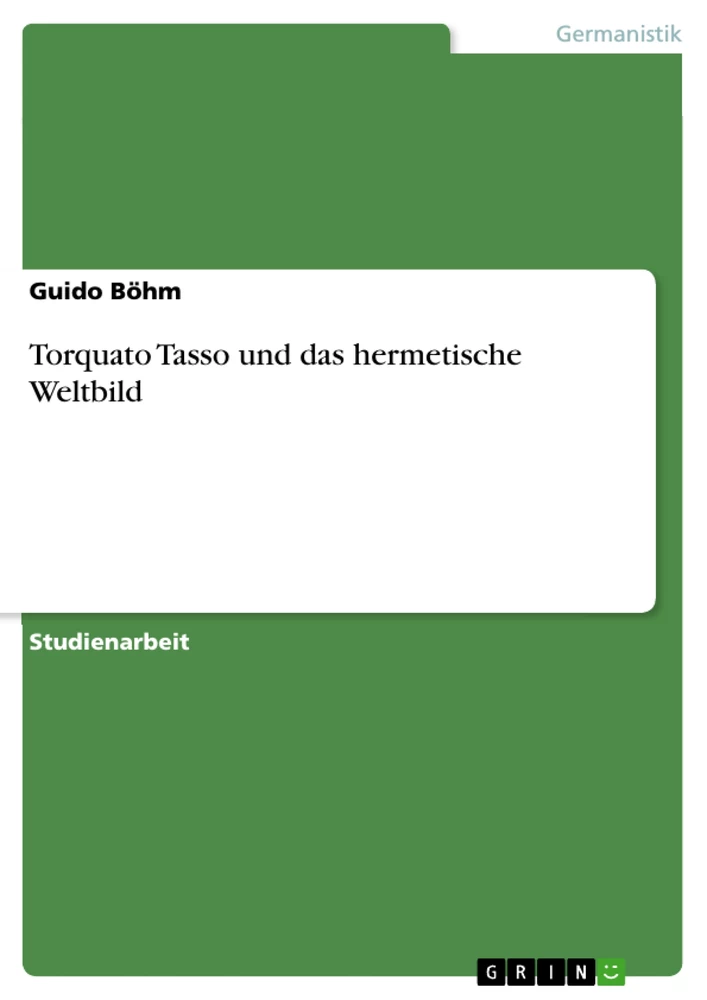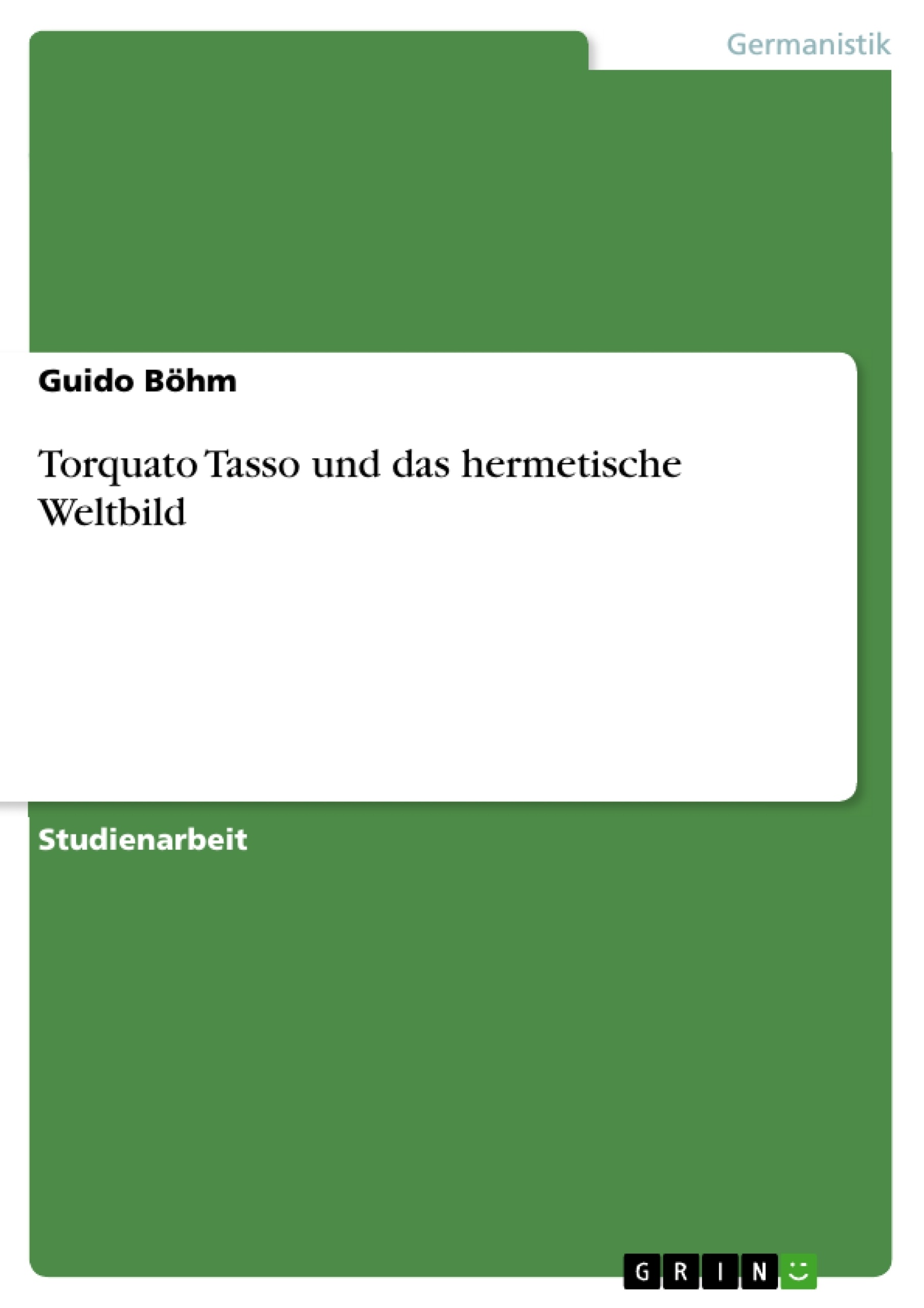Johann Wolfgang von Goethe wird gemeinhin als Klassiker der deutschen Literaturgeschichte verstanden. Sein Werk wurde und wird noch heute bis ins Unendliche rezipiert, verarbeitet und erforscht, man nennt ihn ehrerbietig den „Dichterfürst“ und betrachtet sein Werk geradezu als „deutsches Kulturerbe“ – jedes Kind wird spätestens im Deutschunterricht mit dem Vermächtnis des Ausnahmeautors konfrontiert. Der Klassiker Goethe ist allgegenwärtig. In der Germanistik beschreibt der Begriff Klassik (lat. classis – Vorbild) diejenige literarische Epoche, die eine spätere Generation von Autoren und Rezipienten eben als ein Vorbild empfindet. Der Gebrauch des Terminus Klassik in unserer Zeit impliziert also offenbar eine gewisse Vorbildlichkeit Goethes, die im alltäglichen Umgang mit dem Dichter nur all zu oft zur Phrase verkommt. Doch erst über die Jahrhunderte der Rezeptionsgeschichte ist Goethe heutzutage zum Klassiker avanciert, über Goethes Werk weiß das Etikett „Klassiker“ wenig zu erzählen; die Epochen- bzw. Stilbeschreibung „Weimarer Klassik“ hingegen, letztlich auch nur ein Konstrukt der Nachwelt, kann ebenfalls höchstens als bezeichnende Annäherung an Goethes Literaturproduktion verstanden werden; sachlich und begrifflich ist die Bezeichnung sogar falsch und irreführend – Goethes Stil, seine Motivation, sein Ausdruck, seine Essenz, was auch immer sein Werk ausmachen mag, beschreibt das Wort Klassik in keiner Weise. Zu Goethes Leb- und Wirkzeiten ist der Dichter keineswegs ein Klassiker, vielmehr empfindet er selbst Autoren, die vor seiner Zeit lebten und schrieben als klassisch. Zu seiner Zeit werden Homer, Vergil und deren Zeitgenossen als Vorbilder angesehen; man orientiert sich an der Antike. Auch Goethe wird von der Art von Literatur beeinflußt, die er als „klassisch“ und damit vorbildlich empfindet. Diese Tatsache läßt Goethe als klassizistischen Autor erscheinen, doch auch diese Formel vermag der Dichter schließlich zu durchbrechen, indem er das (Weimarer) Projekt Klassizismus kritisch hinterfragt, es dem Fortschrittsglauben der Moderne gegenüberstellt, beides verbindet und so Schöpfer einer eigenen Kultur wird. Er beruft sich auf antike Vorbilder, transformiert diese aber in einen modernen Kontext und wächst somit über jegliche Klassifizierung hinaus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Figurenanalyse
- 1.2 Konfliktkonzeption
- 2. Interpretationsmodelle
- a Hermetik
- b Genie-Konzept
- 3. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes „Torquato Tasso“ im Hinblick auf die darin enthaltenen Dualismen und Polaritäten, um Goethes Version eines bipolaren Schöpfungskonzeptes aufzuzeigen. Dabei dient Zimmermanns „Weltbild des jungen Goethe“ als Leitfaden. Die Analyse konzentriert sich auf die Hauptfiguren und ihre Beziehungen zueinander, um die zentralen Konfliktkonzeptionen des Stückes zu beleuchten. Zwei Interpretationsmodelle, insbesondere der Einfluss der Hermetik, werden vorgestellt.
- Analyse der Figuren und ihrer Beziehungen im Kontext des hermetischen Weltbildes
- Untersuchung der zentralen Konflikte in „Torquato Tasso“
- Interpretation der Antithetik im Drama als Ausdruck eines bipolaren Schöpfungskonzeptes
- Einordnung des Dramas in den Kontext des Weimarer Klassizismus
- Goethes Modifikation und Erweiterung hermetischer Prinzipien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt Goethes Werk als Gegenstand ständiger Rezeption und Interpretation. Sie stellt die Frage nach der Bedeutung des Begriffs „Klassik“ in Bezug auf Goethe und seine Werke und kontrastiert Goethes eigene Auffassung von Klassik mit der späteren Einordnung seines Werkes. Der Essay von Rolf Christian Zimmermann über das Weltbild des jungen Goethe wird als wichtiger Bezugspunkt für die Interpretation von Tasso vorgestellt, wobei der hermetische Einfluss auf Goethes Denken und Schreiben hervorgehoben wird. Die hermetische Lehre, die einen Mittelweg zwischen Glaube und Analyse sucht und die Welt als paradoxen Dualismus versteht, wird als Grundlage für die weitere Analyse von Goethes „Torquato Tasso“ präsentiert. Die Arbeit selbst verfolgt das Ziel, die im Drama enthaltenen Antithesen zu analysieren, um Goethes bipolares Schöpfungskonzept zu verdeutlichen.
1.1 Figurenanalyse: Diese Sektion analysiert die Hauptfiguren des Dramas – Alfons den Zweiten, Leonore von Este, Leonore Sanvitale und Antonio Montecationo – als Archetypen eines gesellschaftlichen Musters, dem der zwischen Dichtung und Wirklichkeit stehende Tasso gegenübergestellt wird. Die Analyse konzentriert sich auf die Charakterisierung der Figuren, ihre Funktionen im Gesellschaftssystem und ihre Beziehungen untereinander. Es wird angedeutet, dass die stereotypen Figuren im Zusammenhang mit der radikalen Handlungsreduktion des Werkes stehen.
1.2 Konfliktkonzeption: Dieser Abschnitt untersucht die zentralen Konflikte des Stückes, nicht im Detail, sondern im Hinblick auf ein sie verbindendes Element. Die bereits in der Figurenanalyse angedeutete Antithetik und die Bildung von Paaren/Allianzen wird hier weiterführend untersucht, um die zugrundeliegenden Konfliktstrukturen im Drama aufzuzeigen. Tasso's Position ausserhalb dieser Allianzen wird als zentraler Aspekt beleuchtet.
2. Interpretationsmodelle: Dieser Teil der Arbeit präsentiert zwei Interpretationsmodelle, die zur Deutung des Dramas beitragen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der hermetischen Philosophie auf Goethes Werk. Die Analyse erörtert, wie Goethes Modifikation und Erweiterung der hermetischen Lehren im Drama zum Ausdruck kommen.
Schlüsselwörter
Goethe, Torquato Tasso, Hermetik, Dualismus, Polarität, Weimarer Klassik, Figurenanalyse, Konfliktkonzeption, bipolares Schöpfungskonzept, Antithetik, Genie-Konzept, Klassizismus.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes „Torquato Tasso“-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes Drama „Torquato Tasso“, konzentriert sich auf die darin enthaltenen Dualismen und Polaritäten und zielt darauf ab, Goethes Version eines bipolaren Schöpfungskonzeptes aufzuzeigen. Dabei dient Zimmermanns „Weltbild des jungen Goethe“ als Leitfaden.
Welche Aspekte von „Torquato Tasso“ werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die Hauptfiguren und ihre Beziehungen, um die zentralen Konfliktkonzeptionen des Stücks zu beleuchten. Besondere Aufmerksamkeit wird den Interpretationsmodellen, insbesondere dem Einfluss der Hermetik, gewidmet. Die Arbeit untersucht die Antithetik im Drama als Ausdruck eines bipolaren Schöpfungskonzeptes und ordnet das Drama in den Kontext des Weimarer Klassizismus ein.
Welche Themen werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt Goethes Werk als Gegenstand ständiger Rezeption und Interpretation und stellt die Frage nach der Bedeutung des Begriffs „Klassik“ in Bezug auf Goethe. Der Essay von Rolf Christian Zimmermann über das Weltbild des jungen Goethe wird als wichtiger Bezugspunkt vorgestellt, wobei der hermetische Einfluss hervorgehoben wird. Die hermetische Lehre als Grundlage für die Analyse von „Torquato Tasso“ wird präsentiert. Das Ziel der Arbeit, die Antithesen im Drama zu analysieren, um Goethes bipolares Schöpfungskonzept zu verdeutlichen, wird formuliert.
Wie werden die Figuren in der Arbeit analysiert?
Die Figurenanalyse betrachtet die Hauptfiguren (Alfons den Zweiten, Leonore von Este, Leonore Sanvitale und Antonio Montecationo) als Archetypen eines gesellschaftlichen Musters, dem der zwischen Dichtung und Wirklichkeit stehende Tasso gegenübergestellt wird. Die Analyse konzentriert sich auf die Charakterisierung der Figuren, ihre Funktionen im Gesellschaftssystem und ihre Beziehungen untereinander. Die stereotypen Figuren werden im Zusammenhang mit der radikalen Handlungsreduktion des Werkes betrachtet.
Wie werden die Konflikte in „Torquato Tasso“ untersucht?
Die Analyse der Konfliktkonzeption untersucht die zentralen Konflikte des Stücks, nicht im Detail, sondern im Hinblick auf ein sie verbindendes Element. Die bereits in der Figurenanalyse angedeutete Antithetik und die Bildung von Paaren/Allianzen wird weiterführend untersucht, um die zugrundeliegenden Konfliktstrukturen aufzuzeigen. Tasso's Position ausserhalb dieser Allianzen wird als zentraler Aspekt beleuchtet.
Welche Interpretationsmodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert zwei Interpretationsmodelle, die zur Deutung des Dramas beitragen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der hermetischen Philosophie auf Goethes Werk. Die Analyse erörtert, wie Goethes Modifikation und Erweiterung der hermetischen Lehren im Drama zum Ausdruck kommen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Torquato Tasso, Hermetik, Dualismus, Polarität, Weimarer Klassik, Figurenanalyse, Konfliktkonzeption, bipolares Schöpfungskonzept, Antithetik, Genie-Konzept, Klassizismus.
- Quote paper
- Guido Böhm (Author), 1999, Torquato Tasso und das hermetische Weltbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64809