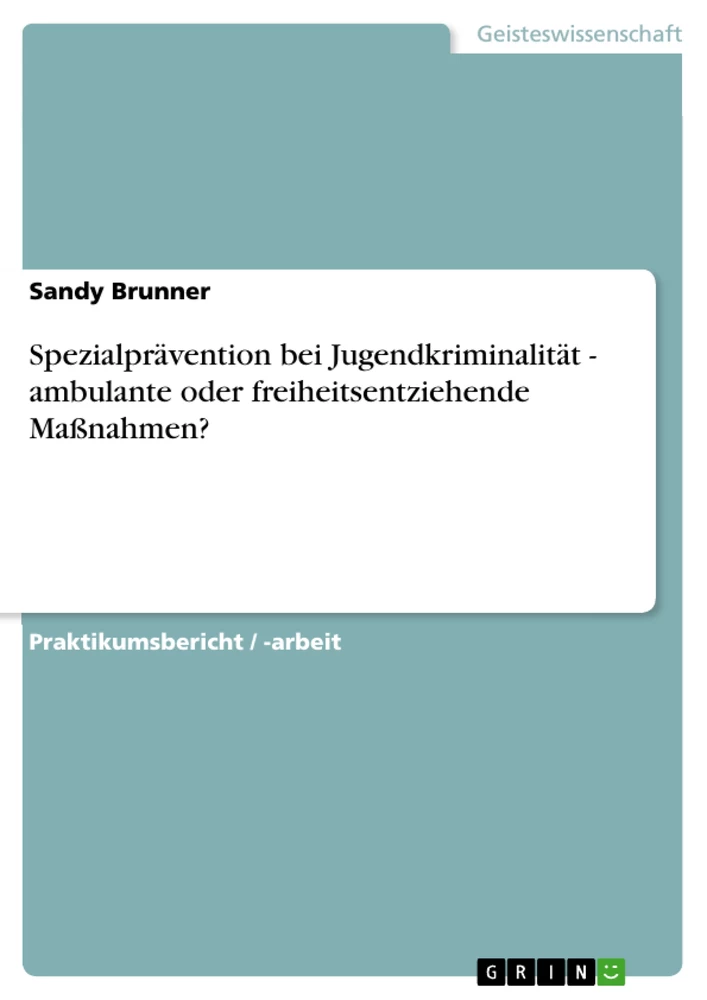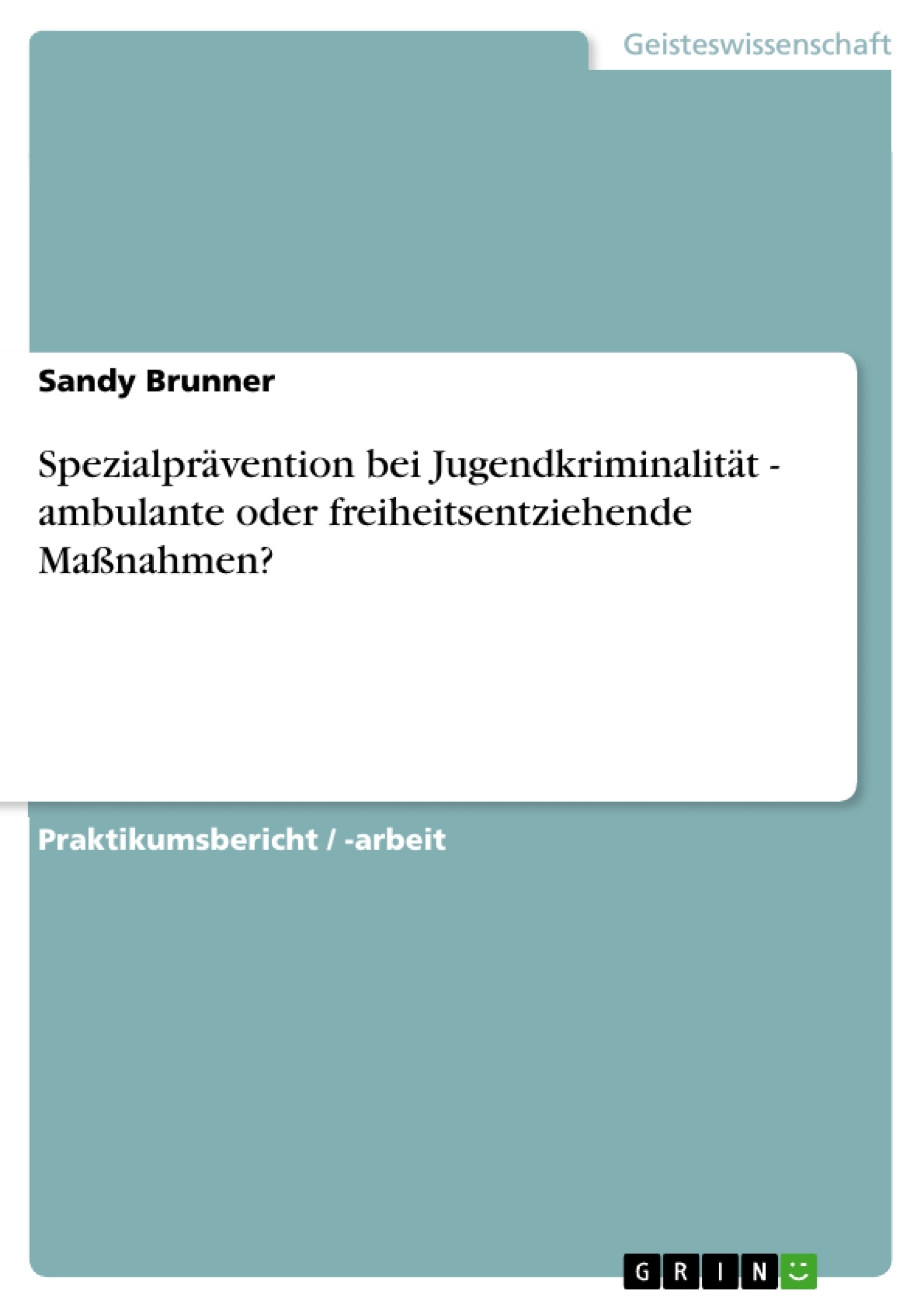In allen Zeiten und Kulturen wurde immer wieder über das Thema „ Jugend“ nachgedacht. Nicht nur heute steht die „Jugend“ insbesondere die „Jugendkriminalität“ zunehmend im Blick der Öffentlichkeit, sondern wahrscheinlich schon seit mindestens 5000 Jahren. Häufig sind es heute die in den Medien und Politik geführten Diskussionen, die dazu beitragen, dass vor der immer mehr ansteigenden Jugendkriminalität gewarnt wird. Es ist somit im Angesicht dieser Entwicklung nicht verwunderlich, dass die gesellschaftliche Punitivität immer mehr zunimmt. Schon die Debatte, um die Einführung der Sicherheitsverwahrung für Jugendliche, zeigt zugleich die Forderung nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts.
Es gibt aber hierzu auch eine gegensätzliche Auffassung.
Aus kriminalwissenschaftlichen, psychologischen, biologischen und soziologischen Erkenntnissen heraus weiß man heute, dass Jugendkriminalität mit dem entwicklungsbedingten jugendlichen Alter zusammenhängt und abhängig ist von der Beeinflussung anderer, d.h. Jugendliche begehen häufig Straftaten aus der Gruppe heraus (vgl. Otto/Thiersch, 2001, S. 852). In der Jugendzeit steigt die Delinquenz an. Sie ist aber zum großen Teil Gelegenheitsdelinquenz. Viele junge Menschen begehen in dieser Entwicklungsphase Straftaten. Jugendkriminalität ist ubiquitär und hat Normalitätscharakter. Die Straftaten werden von Jugendlichen in der Regel aus ihrer Protesthaltung gegen ihre Abhängigkeit von Erwachsenen und gegen deren Unreife - Bewertung der Jugend, verübt. Die jungen Menschen wollen sich aus ihrer Herkunftsfamilie und der Schule lösen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1. Begriff: Jugendkriminalität
- 2.2. Begriff: Spezialprävention
- 3. Die Sanktionsformen des JGG
- 3.1. Die Diversion
- 3.2. Die Erziehungsmaßregeln
- 3.3. Die Zuchtmittel
- 3.4. Die Jugendstrafe
- 3.5. Zusammenfassung und Resümee
- 4. Die ambulanten Maßnahmen
- 4.1. Der Täter-Opfer-Ausgleich
- 4.2. Die Soziale Gruppenarbeit (Sozialer Trainingskurs)
- 4.3. Die Betreuungsweisung
- 4.4. Die Arbeitsleistungen
- 4.5. Sonstige ambulanten Sanktionen
- 4.6. Zusammenfassung und Resümee
- 5. Die freiheitsentziehenden Maßnahmen
- 5.1. Der Jugendstrafvollzug
- 5.1.1. Resozialisierung durch Freiheitsentzug?
- 5.2. Zusammenfassung und Resümee
- 6. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Effektivität ambulanter versus freiheitsentziehender Maßnahmen in der Spezialprävention Jugendkriminalität. Die Autorin möchte den Leser davon überzeugen, dass ambulante Maßnahmen wirkungsvoller und weniger schädlich für die jugendliche Entwicklung sind als freiheitsentziehende Sanktionen. Die Arbeit basiert auf den Erfahrungen der Autorin während ihrer Praktika in einer Justizvollzugsanstalt und der Jugendgerichtshilfe.
- Ambulante und freiheitsentziehende Maßnahmen in der Jugendkriminalität
- Wirkungsweise verschiedener spezialpräventiver Maßnahmen
- Folgen freiheitsentziehender Maßnahmen auf die Entwicklung Jugendlicher
- Vergleich der Effektivität ambulanter und freiheitsentziehender Maßnahmen
- Resozialisierung im Jugendstrafrecht
Zusammenfassung der Kapitel
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel klärt die grundlegenden Begriffe Jugendkriminalität und Spezialprävention. Es legt die Definitionen fest, auf denen die weitere Argumentation der Arbeit aufbaut, und schafft so eine einheitliche Grundlage für den Vergleich der verschiedenen Maßnahmen.
3. Die Sanktionsformen des JGG: Hier werden die verschiedenen Sanktionsformen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) dargestellt, welche die rechtliche Basis für sowohl ambulante als auch freiheitsentziehende Maßnahmen bilden. Der Überblick über Diversion, Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe schafft ein umfassendes Verständnis des rechtlichen Rahmens. Die Zusammenfassung und das Resümee dieses Kapitels betonen die Vielfalt der Möglichkeiten und die Notwendigkeit einer individuellen Betrachtungsweise.
4. Die ambulanten Maßnahmen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene ambulante Maßnahmen wie Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Gruppenarbeit, Betreuungsweisung und Arbeitsleistungen. Es beschreibt deren Anwendung und Zielsetzung im Kontext der Resozialisierung und Prävention weiterer Straftaten. Die Zusammenfassung betont den Vorteil ambulanter Maßnahmen, die die Integration des Jugendlichen in die Gesellschaft fördern und negative Auswirkungen des Freiheitsentzugs vermeiden.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Spezialprävention, ambulante Maßnahmen, freiheitsentziehende Maßnahmen, Resozialisierung, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Gruppenarbeit, Betreuungsweisung, Jugendstrafvollzug, Delinquenz, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse ambulanter vs. freiheitsentziehender Maßnahmen in der Jugendkriminalität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Effektivität ambulanter im Vergleich zu freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Spezialprävention von Jugendkriminalität. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Wirksamkeit und den Auswirkungen auf die jugendliche Entwicklung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt ambulante und freiheitsentziehende Maßnahmen im Jugendstrafrecht, die Wirkungsweise verschiedener spezialpräventiver Maßnahmen, die Folgen von Freiheitsentzug auf die Entwicklung Jugendlicher, einen Vergleich der Effektivität beider Maßnahmenarten und den Aspekt der Resozialisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmungen (Jugendkriminalität und Spezialprävention), Sanktionsformen des JGG (Diversion, Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Jugendstrafe), Ambulante Maßnahmen (Täter-Opfer-Ausgleich, Soziale Gruppenarbeit, Betreuungsweisung, Arbeitsleistungen, etc.), Freiheitsentziehende Maßnahmen (Jugendstrafvollzug), Zusammenfassung und Fazit.
Wie werden die Begriffe "Jugendkriminalität" und "Spezialprävention" definiert?
Die Arbeit definiert "Jugendkriminalität" und "Spezialprävention" im Kapitel "Begriffsbestimmungen". Diese Definitionen bilden die Grundlage für den Vergleich der verschiedenen Maßnahmen.
Welche ambulanten Maßnahmen werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene ambulante Maßnahmen wie Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Gruppenarbeit (z.B. soziale Trainingskurse), Betreuungsweisung und Arbeitsleistungen. Es werden deren Anwendung und Zielsetzung im Kontext der Resozialisierung erläutert.
Welche freiheitsentziehenden Maßnahmen werden behandelt?
Der Schwerpunkt bei den freiheitsentziehenden Maßnahmen liegt auf dem Jugendstrafvollzug und der Frage nach der Wirksamkeit der Resozialisierung durch Freiheitsentzug.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass ambulante Maßnahmen im Vergleich zu freiheitsentziehenden Maßnahmen wirkungsvoller und weniger schädlich für die jugendliche Entwicklung sind. Diese Schlussfolgerung basiert auf den Erfahrungen der Autorin in der Justizvollzugsanstalt und der Jugendgerichtshilfe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendkriminalität, Spezialprävention, ambulante Maßnahmen, freiheitsentziehende Maßnahmen, Resozialisierung, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Gruppenarbeit, Betreuungsweisung, Jugendstrafvollzug, Delinquenz, Prävention.
Auf welcher Grundlage basiert die Argumentation der Arbeit?
Die Argumentation basiert auf den Erfahrungen der Autorin während ihrer Praktika in einer Justizvollzugsanstalt und der Jugendgerichtshilfe, sowie auf der Analyse der verschiedenen Sanktionsformen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG).
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen?
Detailliertere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen (sowohl ambulant als auch freiheitsentziehend) finden sich in den jeweiligen Kapiteln der Arbeit.
- Quote paper
- Sandy Brunner (Author), 2006, Spezialprävention bei Jugendkriminalität - ambulante oder freiheitsentziehende Maßnahmen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64710