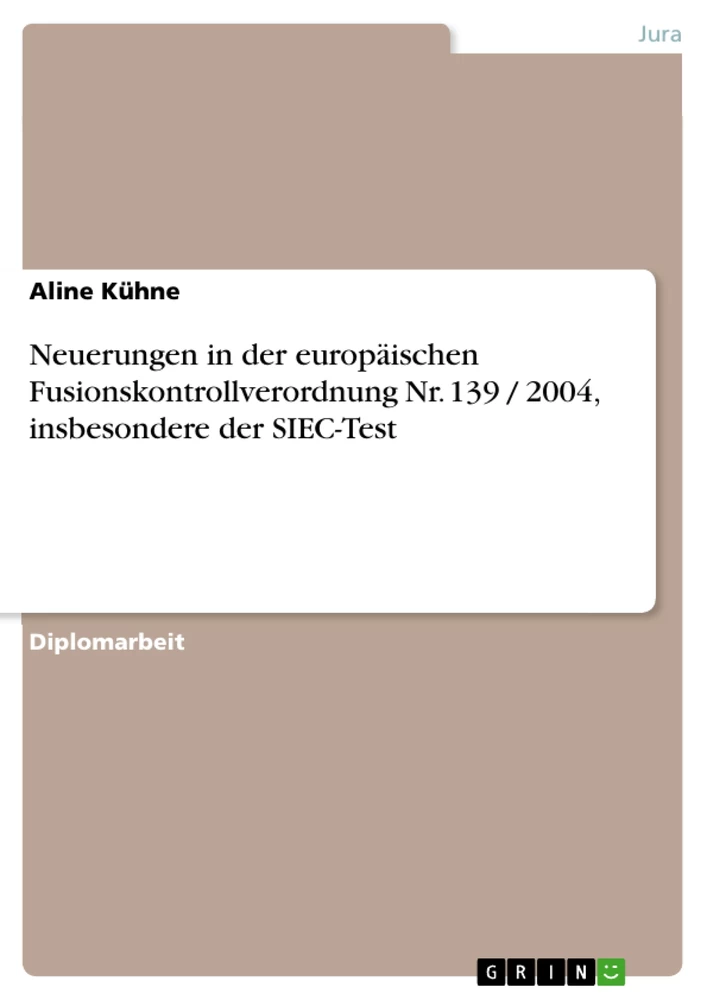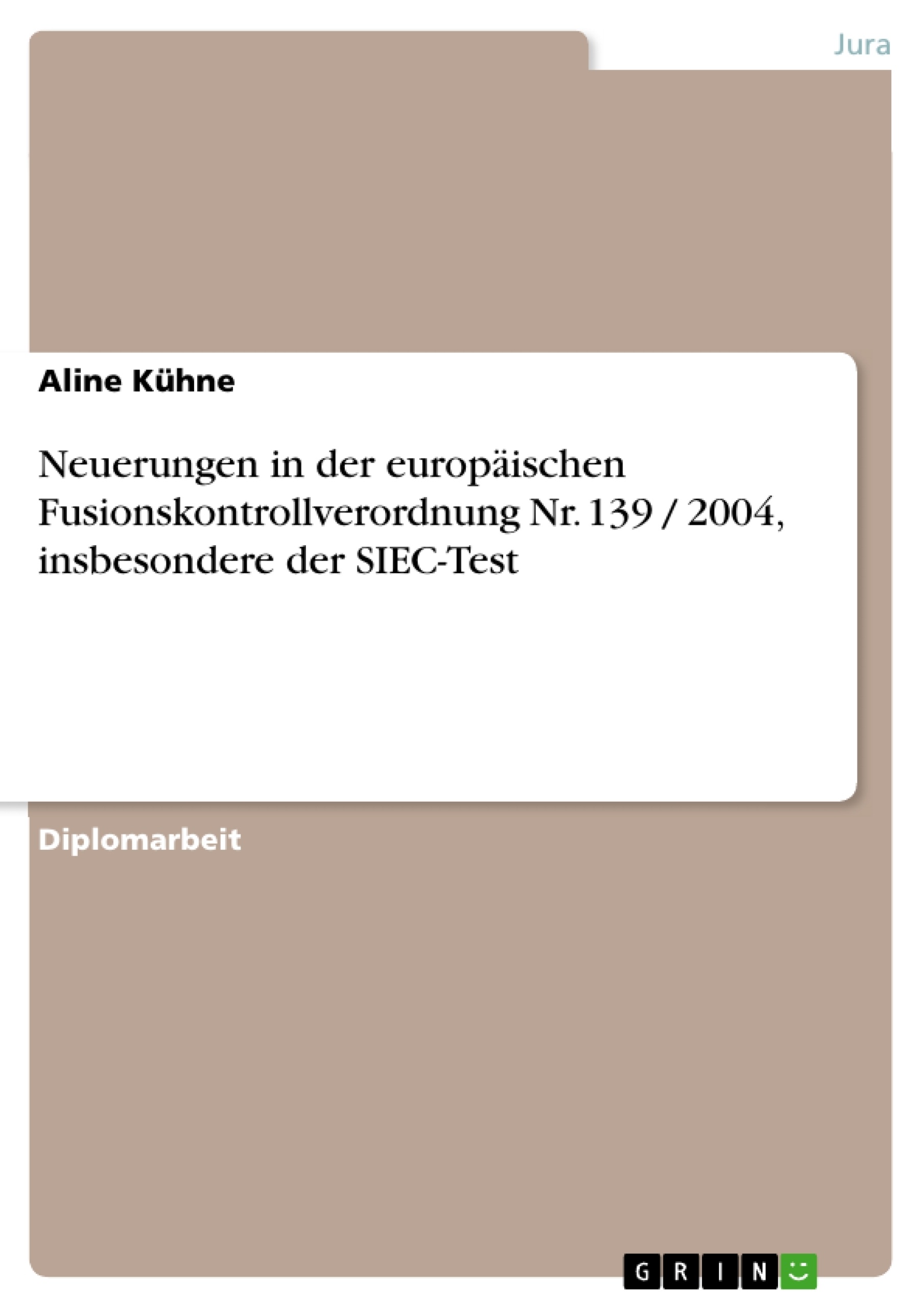Der Binnenmarkt der europäischen Union ist der größte dieser Art auf der Welt; nach der EU-Osterweiterung leben in ihm nun fast 500 Millionen Menschen. Der gemeinsame Markt hat die wirtschaftliche wie die politische Integration vorangebracht und den EU-Bürgern beträchtliche Vorteile verschafft: Er hat Schranken beseitigt und Türen geöffnet und dadurch mehr Wachstum, Beschäftigung und somit auch mehr Wohlstand in weite Teile Europas gebracht. Um dies zu erreichen war auf rechtlicher Ebene ein Mindestmaß an Harmonisierung und Regulierung nötig. Besonders im Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Marktschutz wurden einheitliche Regelungen geschaffen. Einen sprichwörtlichen „Drahtseilakt“ zwischen Freiheit und Kontrolle muss hierbei die europäische Fusionskontrolle immer wieder aufs Neue bewältigen: Auf der einen Seite kann externes Wachstum durch eine Fusion die Rentabilität des Unternehmens und mittelbar auch die Wohlfahrt der Gesellschaft steigern. Auf der anderen Seite bürgen Zusammenschlüsse die Gefahr, dass die Konzentration der ökonomischen Macht ein Übermaß annimmt und gerade in Konflikt mit gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Zielen gerät. Um diese Balance zwischen Effizienzsteigerung und Aufrechterhaltung kompetitiver Marktstrukturen auch künftig zu erhalten, wurde die Fusionskontrolle im Jahre 2004 grundlegend reformiert. Eine Schüsselrolle in diesem Zusammenhang bildet das Bestreben eines „more economic approach“3und die Schaffung erhöhter Rechtssicherheit und Entscheidungsqualität . Im Folgenden soll nicht nur eine allgemeine Übersicht zur Fusionskontrolle im Hinblick auf ihre Entwicklung, ihr Wesen und ihre Bedeutung für europäische Unternehmen gegeben werden, sondern insbesondere soll das neue materielle Prüfungskriterium „significant impediment to effective competition“ und dessen Auswirkungen auf die Entscheidungspraxis beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung der europäischen Fusionskontrolle
- Vorgänger: Verordnung Nr. 4064/89
- Aufkommen des Bedürfnis für die europäische Fusionskontrolle
- Grundzüge der früheren FKVO
- Gründe für das Änderungsbedürfnis
- Erlass der neuen Verordnung Nr. 139/2004 (EG-FKVO)
- Rechtsgrundlagen
- Einordnung in die europäische Wettbewerbspolitik
- Abgrenzung zu Artikeln 81 und 82 EG
- Legitimation der Fusionskontrolle im EG-Vertrag
- Flankierende Rechtssätze
- Mitteilungen der Kommission
- Durchführungsverordnung 802/2004
- Materielles Prüfungskriterium des Artikels 2 II, III EG-FKVO
- Ordnungspolitischer Hintergrund und wettbewerbstheoretische Konzeption
- Wettbewerbs- vs. Industriepolitik
- Relevante wettbewerbstheoretische Konzepte
- Wettbewerbstheoretische Ausgestaltung der FKVO
- Aufbau und Regelungsstruktur des Artikel 2 FKVO
- Marktabgrenzung
- Begriffsdefinition und Notwendigkeit der Abgrenzung
- Bestimmung des relevanten Marktes
- sachlich
- räumlich
- zeitlich
- Erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs - sog. SIEC-Test
- Allgemeines
- Heranführender Überblick
- Analyse der einzelnen Tatbestandsmerkmale
- Tatbestandsmerkmal des „,wirksamen Wettbewerbs“
- Tatbestandsmerkmal der „Behinderung“
- Tatbestandsmerkmal der „Erheblichkeit“
- Fallgruppen
- Einzelmarktbeherrschung
- Allgemeines
- Analyse der „marktbeherrschenden Stellung“
- Bemessung der „Begründung oder Verstärkung“
- Kriterien der Kommission
- Marktstellung der neuen Unternehmenseinheit
- Stärke der aktuellen Wettbewerber
- Stärke der Nachfrager
- Stärke des potentiellen Wettbewerbs
- Begründung oder Verstärkung
- Horizontale Zusammenschlüsse
- Vertikale Zusammenschlüsse
- Konglomerate Zusammenschlüsse
- Kollektive Marktbeherrschung
- Allgemeines und Voraussetzungen
- Kriterien der Rechtspraxis
- Entwicklung der Entscheidungsgrundsätze bis zum Gencor-Fall
- Airtours - Rechtssprechung
- Übertragung auf die neue Verordnung
- Begründung oder Verstärkung
- Unilaterale Effekte
- Allgemeines
- Oligopolistische Marktstruktur und einseitige Effekte
- Preiswettbewerb mit homogenen Gütern
- Mengenwettbewerb mit homogenen Gütern
- Preiswettbewerb mit differenzierten Gütern
- Mengenwettbewerb mit differenzierten Gütern
- Methoden zur Feststellung unilateraler Effekte
- Hypothetische Beispielsfälle
- US-amerikanischer Streitfall „Heinz-Beechnut“
- Beurteilung unilateraler Effekte in den Leitlinien
- Erfassung unilateraler Effekte in der Rechtspraxis
- Behandlung unter der alten FKVO
- Erfassung unter der neuen FKVO
- Homogene Produktmärkte
- Heterogene Produktmärkte
- Beweismaßstab
- Rechtfertigungsgründe
- Effizienzeinrede
- Allgemeines
- Wesen von Effizienzen und Standard ihrer Berücksichtigung
- Arten von Effizienzen
- Behandlung von Effizienzen unter der alten FKVO
- Entscheidungen der Kommission
- Meinungsstand in der Literatur
- Behandlung von Effizienzen unter der neuen FKVO
- Zielkompatibilität vs. Trade-off-Modell
- Relevanz innerhalb der einzelnen Fallgruppen
- Beweisbarkeit von Effizienzvorteilen
- Sanierungsfusion (sog. „Failing Firm Defence“)
- Allgemeines und Hintergrund
- Kriterien der Rechtspraxis
- Behandlung unter der alten FKVO
- Voraussetzungen gemäß der Rechtssache Kali und Salz
- Folgende Entwicklung der Entscheidungspraxis
- Erfassung unter der neuen FKVO
- Voraussetzungen gemäß der Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse
- Implikationen für Prüfung und Beweislast
- Kohäsionseinwand und Abwägungsklausel
- Weitere wesentliche ausgewählte Neuerungen in der FKVO
- Überblick über Änderungen
- Abgrenzung der Befugnisse zwischen Kommission und Mitgliedsstaaten
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Neuerungen in der europäischen Fusionskontrollverordnung Nr. 139/2004, insbesondere mit dem SIEC-Test. Die Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und die Anwendung des SIEC-Tests in der Praxis, analysiert die Relevanz des Tests für die Beurteilung von Fusionsvorhaben und beleuchtet die Auswirkungen der Neuerungen auf die europäische Wettbewerbspolitik.
- Die Entwicklung und die Rechtsgrundlagen der europäischen Fusionskontrolle
- Die Anwendung des SIEC-Tests zur Beurteilung der Wettbewerbsbeeinträchtigung
- Die Rolle von Effizienzvorteilen und der „Failing Firm Defence“ im Rahmen der Fusionskontrolle
- Die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Kommission und Mitgliedsstaaten
- Die Auswirkungen der Neuerungen auf die europäische Wettbewerbspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der europäischen Fusionskontrolle beleuchtet. Sie erläutert die Gründe für das Änderungsbedürfnis der alten Verordnung und stellt die neue Verordnung Nr. 139/2004 (EG-FKVO) vor. Anschließend werden die Rechtsgrundlagen der EG-FKVO, insbesondere ihre Einordnung in die europäische Wettbewerbspolitik, die Abgrenzung zu anderen Wettbewerbsregeln und die Legitimation der Fusionskontrolle im EG-Vertrag, erörtert. Kapitel 4 widmet sich dem materiellen Prüfungskriterium des Artikels 2 II, III EG-FKVO, dem sog. SIEC-Test. Es wird der ordnungspolitische Hintergrund und die wettbewerbstheoretische Konzeption des Tests beleuchtet, die Notwendigkeit der Marktabgrenzung und die verschiedenen Fallgruppen des SIEC-Tests, wie Einzelmarktbeherrschung, kollektive Marktbeherrschung und unilaterale Effekte, ausführlich analysiert. Kapitel 5 befasst sich mit den Rechtfertigungsgründen für Fusionsvorhaben, insbesondere der Effizienzeinrede und der sog. „Failing Firm Defence“. Die Arbeit beleuchtet die Behandlung dieser Rechtfertigungsgründe unter der alten und der neuen FKVO, die Kriterien ihrer Anwendung in der Rechtspraxis und die Beweislastverteilung. Kapitel 6 gibt einen Überblick über weitere wesentliche Neuerungen in der FKVO, insbesondere über die Abgrenzung der Befugnisse zwischen Kommission und Mitgliedsstaaten. Schließlich werden im Fazit und Ausblick die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und Zukunftsperspektiven für die europäische Fusionskontrolle erörtert.
Schlüsselwörter
Europäische Fusionskontrolle, EG-FKVO, SIEC-Test, Wettbewerbsbeeinträchtigung, Marktabgrenzung, Einzelmarktbeherrschung, Kollektive Marktbeherrschung, Unilaterale Effekte, Effizienzvorteile, Failing Firm Defence, Kohäsionseinwand, Abwägungsklausel, Europäische Wettbewerbspolitik.
- Quote paper
- Dipl. jur. oec. Aline Kühne (Author), 2006, Neuerungen in der europäischen Fusionskontrollverordnung Nr. 139 / 2004, insbesondere der SIEC-Test, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64687