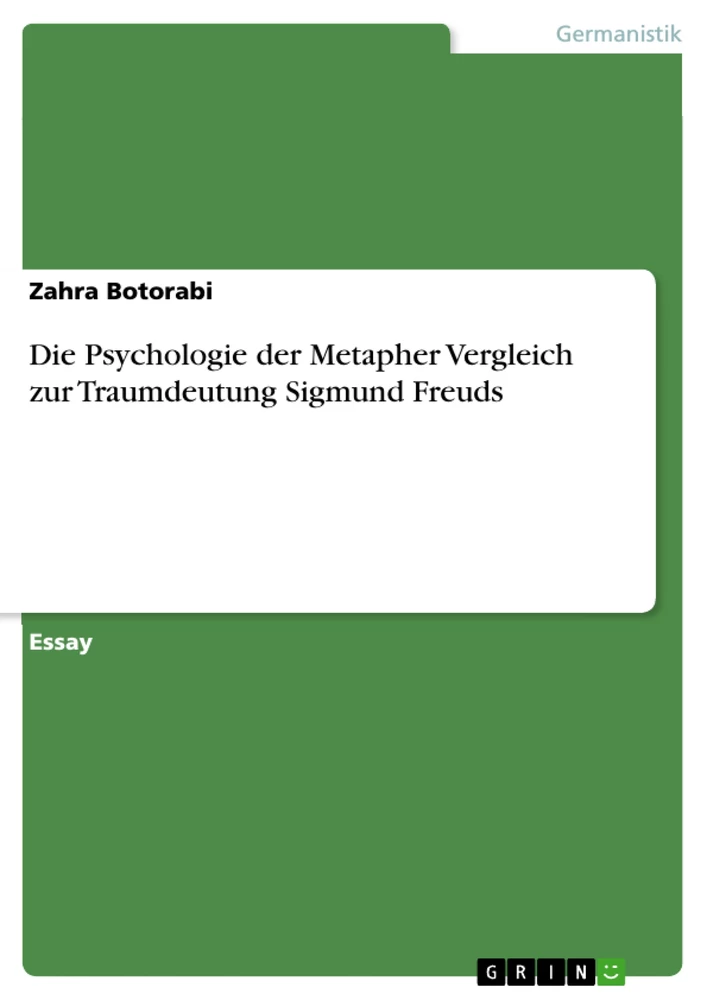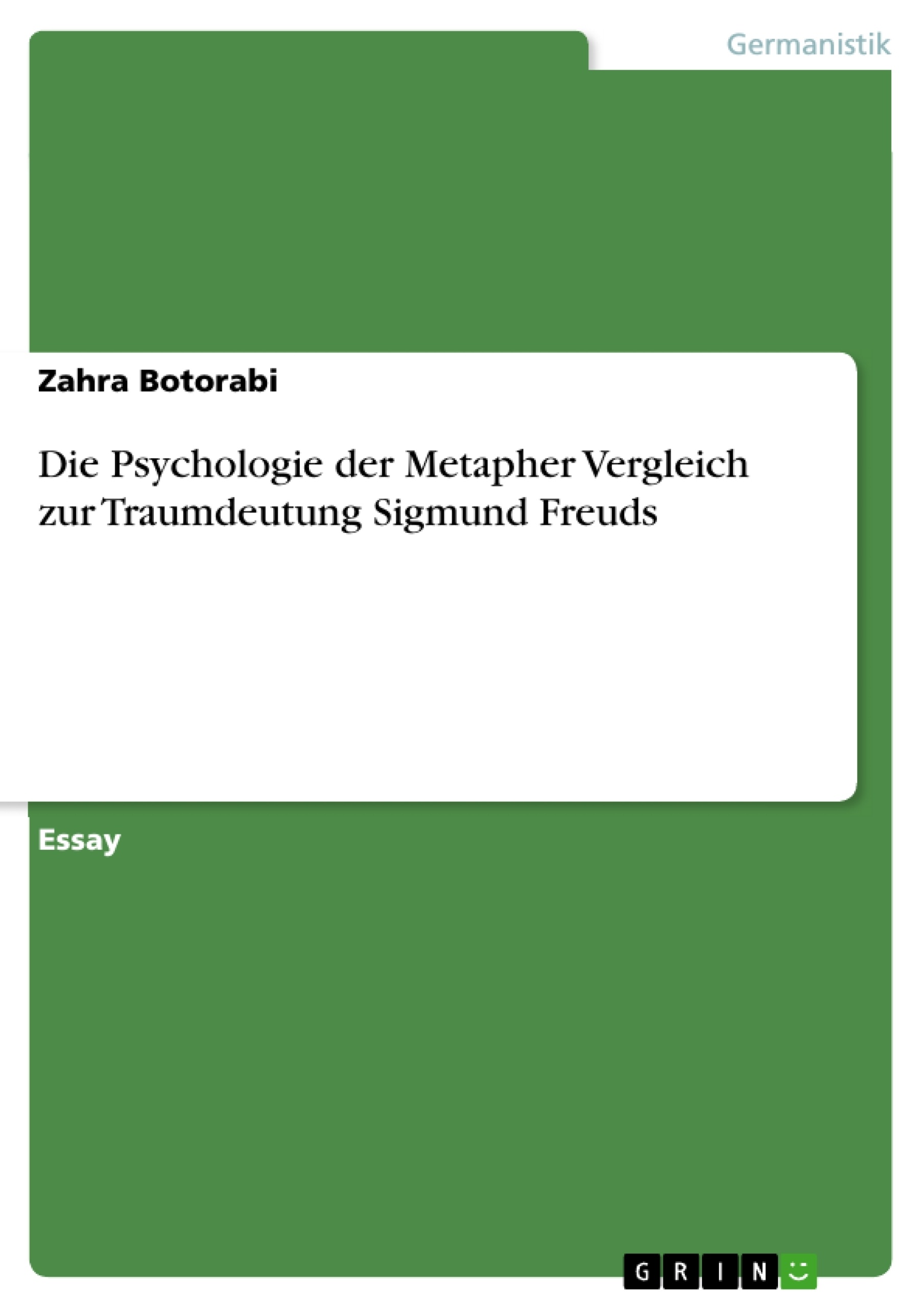Sigmund Freud teilt die Entwicklung des Menschen in verschiedene Phasen ein. Diese psychischen Entwicklungsphasen treten bereits nach der Geburt ein. Die Erfahrungen in den ersten sechs Lebensjahren sind die prägnantesten, sie formen den Charakter des Menschen. In diesen Jahren wird das Urvertrauen zu sich selbst und zur Umgebung festgelegt. Das Kind entwickelt ein Selbstwertgefühl und einen Willen, abhängig von der Resonanz auf das Äußern von seinen Entscheidungen und Wünschen.
Erfährt das Kind in diesen Phasen ein Fehlverhalten der Eltern, so kann sich seine Entwicklung nicht entfalten. Um die nächste Phase zu erreichen, muss die vorherige mit Erfolg verarbeitet sein. Die prägenden Handlungen der Eltern werden in der Psychologie mit dem Oberbegriff Gewalt betitelt. Ein wichtiger Aspekt ist die Aufmerksamkeit, welche die Kinder in ihren ersten Lebensjahren erfahren. Die Grenze zwischen Vernachlässigung und zu starker Fixierung der Eltern ist nur schwer fassbar. Selbst kleine Abweichungen in dem Verhältnis Eltern-Kind führen zu Traumatisierungen des Kindes.
Die daraus entstehenden Folgen entscheiden das Verhalten des Menschen im erwachsenen Alter. Traumata werden aus Selbstschutz verdrängt und im Unterbewusstsein gespeichert. Ohne sich bewusst darüber zu sein, ist jeder Mensch geprägt durch seine früh-kindlichen Entwicklungsphasen. Selbstverständlich spielen die Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens macht auch eine wichtige Rolle in der Entwicklung, die früh-kindlichen Erfahrungen entscheiden jedoch über den Umgang mit diesen. Das heißt, die äußeren Reize der Umgebung werden entweder zensiert und ins Unterbewusstsein verdrängt oder sie werden im Bewusstsein gespeichert. Es kann zunächst vorkommen, dass eine Affekt- oder Gefühlsregung wahrgenommen, aber verkannt wird. Sie ist durch die Verdrängung ihrer eigentlichen Repräsentanz zur Verknüpfung mit einer anderen Vorstellung genötigt worden und wird nun vom Bewusstsein für die Äußerung dieser letzteren gehalten. So entstehen individuelle Handlungsmuster.1 Jetzt wird deutlich, dass das Unbewusste nicht ein separater Teil in jedem von uns ist, es hat einen Einfluss auf unsere Handlungen, Gedanken und Gefühle, ohne dass uns das bewusst ist. Der Traum führt genau in die Sphäre des Unterbewussten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Sigmund Freuds Phasenmodell der menschlichen Entwicklung
- Das Unbewusste und der Traum
- Traumarbeit und Wunschbildung
- Metapher als Ausdruck der Verschiebung
- Reizaufnahme und Zensur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Parallelen zwischen Sigmund Freuds Traumdeutung und dem Konzept der Metapher. Ziel ist es, die Mechanismen der unbewussten Verarbeitung von Erfahrungen und Reizen aufzuzeigen und deren Ausdruck in der Metaphorik zu beleuchten.
- Freuds Phasenmodell der psychischen Entwicklung
- Die Rolle des Unbewussten im menschlichen Verhalten
- Der Traum als Manifestation unbewusster Wünsche
- Die Traumarbeit als Prozess der Umwandlung
- Die Metapher als Ausdruck unbewusster Verschiebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Sigmund Freuds Phasenmodell der menschlichen Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt Freuds Theorie der psychischen Entwicklungsphasen, die bereits nach der Geburt einsetzen. Die frühen Kindheitserfahrungen, insbesondere die ersten sechs Lebensjahre, prägen den Charakter nachhaltig und beeinflussen das Urvertrauen, das Selbstwertgefühl und den Willen des Menschen. Fehlverhalten der Eltern kann die Entwicklung stören, und Traumatisierungen können durch kleine Abweichungen im Eltern-Kind-Verhältnis entstehen. Diese frühen Erfahrungen wirken sich auf das Verhalten im Erwachsenenalter aus, indem verdrängte Traumata unbewusst das Handeln und Fühlen beeinflussen. Die späteren Erfahrungen werden durch die frühkindlichen Prägungen gefiltert und verarbeitet.
Das Unbewusste und der Traum: Das Kapitel verdeutlicht Freuds Konzept des Unbewussten als nicht-separaten, aber einflussreichen Teil der menschlichen Psyche, der Handlungen, Gedanken und Gefühle unbewusst beeinflusst. Der Traum wird als Zugang zum Unbewussten beschrieben. Freud unterscheidet zwischen dem manifesten Trauminhalt (Erinnerung an den Traum) und den latenten Traumgedanken (die verborgene Bedeutung). Die Traumarbeit wandelt die latenten Traumgedanken in den manifesten Trauminhalt um, um den Schlaf nicht zu stören. Der Traum ist nach Freud häufig die Verarbeitung von "Tagesresten", also nicht verarbeiteten Gedanken und Emotionen des Tages.
Traumarbeit und Wunschbildung: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Traumarbeit und die Rolle der Wunschbildung. Der traumschaffende Wunsch ist oft ein verdrängter, unbewusster Wunsch, der durch die Traumarbeit verarbeitet wird. Die Traumarbeit umgeht die Zensur des Bewusstseins durch Verschiebung psychischer Energie. Freud argumentiert, dass alle Interaktionen (verbal und nonverbal) einer solchen Verschiebung unterliegen, wobei Versprecher als Beispiele für unbewusste Wunschvorstellungen dienen.
Metapher als Ausdruck der Verschiebung: In diesem Kapitel wird die These aufgestellt, dass die beschriebene Verschiebung durch Metaphern ausgedrückt wird. Die Metapher wird nicht als reine rhetorische Figur verstanden, sondern als allgemeines Prinzip, welches jede Handlung, Interaktionsform und jeden Gedanken als Ergebnis unbewusster Verschiebungen darstellt. Jede Person hat somit ihre eigene Metaphorik, deren Deutung Gegenstand der Psychoanalyse sein kann.
Reizaufnahme und Zensur: Der letzte Abschnitt des Textes beschreibt die Reizaufnahme und -verarbeitung. Äußere Reize werden einer Zensur unterzogen, wobei nicht benötigte Informationen scheinbar eliminiert werden (Verdrängung ins Unterbewusstsein). Zugelassene Informationen gelangen ins Bewusstsein. Dieser Prozess ist unbewusst und führt zu zwei verschiedenen Vorstellungen: bewusste und unbewusste. Die Vorstellung bildet die subjektive Bedeutung des Reizes für den Einzelnen.
Schlüsselwörter
Sigmund Freud, Traumdeutung, Unbewusstes, Traumarbeit, Wunschbildung, Metapher, Verschiebung, Zensur, psychische Entwicklung, Verdrängung, bewusste und unbewusste Vorstellungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs): Sigmund Freuds Traumdeutung und die Metapher
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Parallelen zwischen Sigmund Freuds Traumdeutung und dem Konzept der Metapher. Sie beleuchtet die Mechanismen der unbewussten Verarbeitung von Erfahrungen und Reizen und deren Ausdruck in der Metaphorik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Freuds Phasenmodell der psychischen Entwicklung, die Rolle des Unbewussten, den Traum als Manifestation unbewusster Wünsche, die Traumarbeit als Prozess der Umwandlung und die Metapher als Ausdruck unbewusster Verschiebungen. Zusätzlich werden Reizaufnahme, Zensur und Verdrängung im Kontext der unbewussten Verarbeitung diskutiert.
Was ist Freuds Phasenmodell der menschlichen Entwicklung?
Dieses Modell beschreibt Freuds Theorie der psychischen Entwicklungsphasen, die bereits nach der Geburt beginnen. Frühkindliche Erfahrungen prägen nachhaltig den Charakter und beeinflussen Urvertrauen, Selbstwertgefühl und Willen. Fehlverhalten der Eltern kann die Entwicklung stören, und Traumatisierungen können durch kleine Abweichungen im Eltern-Kind-Verhältnis entstehen. Diese frühen Erfahrungen beeinflussen das Verhalten im Erwachsenenalter, indem verdrängte Traumata unbewusst das Handeln und Fühlen beeinflussen.
Wie definiert Freud das Unbewusste und seine Rolle im Traum?
Freud sieht das Unbewusste als einflussreichen Teil der menschlichen Psyche, der Handlungen, Gedanken und Gefühle unbewusst beeinflusst. Der Traum dient als Zugang zum Unbewussten. Er unterscheidet zwischen manifestem Trauminhalt (Erinnerung) und latenten Traumgedanken (verborgene Bedeutung). Die Traumarbeit wandelt latente Gedanken in den manifesten Trauminhalt um, um den Schlaf nicht zu stören. Der Traum verarbeitet oft "Tagesreste".
Was ist die Traumarbeit und die Wunschbildung?
Die Traumarbeit verarbeitet verdrängte, unbewusste Wünsche. Sie umgeht die Zensur des Bewusstseins durch Verschiebung psychischer Energie. Freud argumentiert, dass alle Interaktionen dieser Verschiebung unterliegen, wobei Versprecher als Beispiele für unbewusste Wunschvorstellungen dienen.
Wie wird die Metapher in diesem Kontext verstanden?
Die Metapher wird nicht nur als rhetorische Figur, sondern als allgemeines Prinzip verstanden, welches jede Handlung, Interaktionsform und jeden Gedanken als Ergebnis unbewusster Verschiebungen darstellt. Jede Person hat ihre eigene Metaphorik, deren Deutung Gegenstand der Psychoanalyse sein kann.
Wie funktionieren Reizaufnahme und Zensur nach Freud?
Äußere Reize werden einer Zensur unterzogen, wobei nicht benötigte Informationen verdrängt werden (ins Unterbewusstsein). Zugelassene Informationen gelangen ins Bewusstsein. Dieser Prozess ist unbewusst und führt zu bewussten und unbewussten Vorstellungen, die die subjektive Bedeutung des Reizes für den Einzelnen bilden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Sigmund Freud, Traumdeutung, Unbewusstes, Traumarbeit, Wunschbildung, Metapher, Verschiebung, Zensur, psychische Entwicklung, Verdrängung, bewusste und unbewusste Vorstellungen.
- Citation du texte
- Zahra Botorabi (Auteur), 2004, Die Psychologie der Metapher Vergleich zur Traumdeutung Sigmund Freuds, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64476