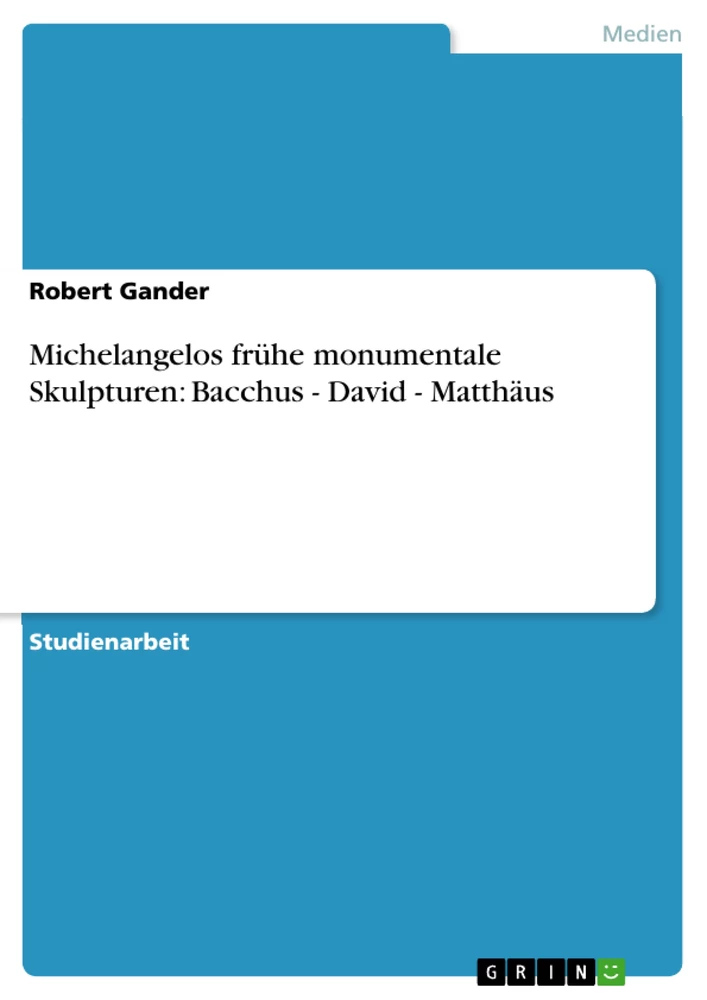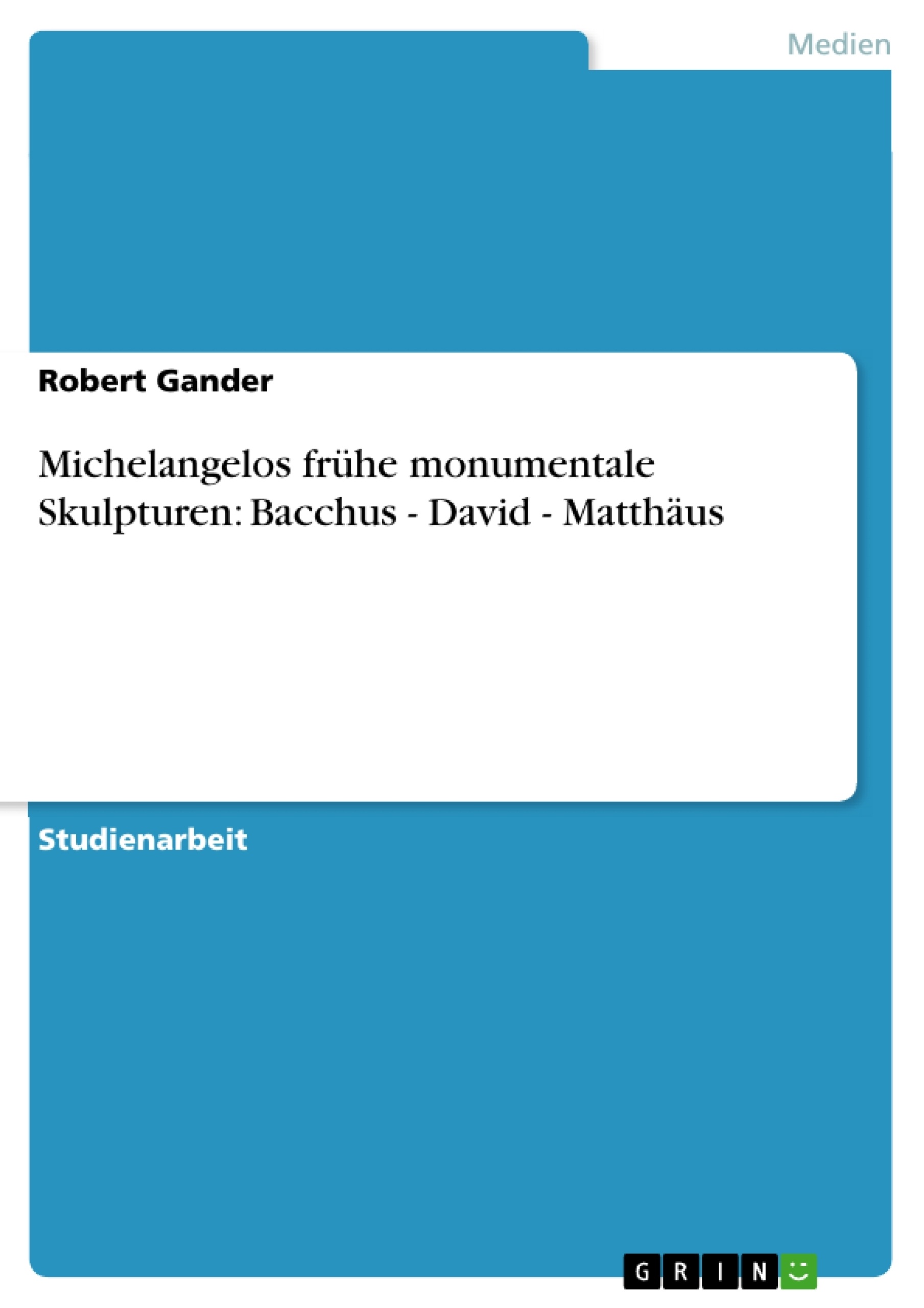Michelangelo Buonarotti schuf nur sehr wenige freiplastische Werke. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dreien davon, die allesamt aus der frühen Schaffensphase des Künstlers stammen. Jede Skulptur dient als Anlass, um auf einen Aspekt genauer Einzugehen.
Die 1496/97 geschaffene Figur des Bacchus wird in ihrer Formgebung vor allem hinsichtlich neoplatonistischer Einflüsse beleuchtet, mit deren Gedankengut Michelangelo genauestens vertraut war.
Der David (1501-04) und seine bewegte Geschichte werden eingehend hinsichtlich der politischen Rolle, welche sie im Florenz des frühen 16. Jahrhunderts spielten, analysiert.
Schließlich dient die unvollendet gebliebene Figur des Matthäus von 1505/06 dazu, die Vorgehensweise des Künstlers zu studieren. Wie bei Bacchus und David findet sich auch beim Matthäus ein Zwiespalt, allerdings erstmals als inneres Thema und losgelöst vom äußeren Motiv. Michelangelos Gestalten befinden sich meist nicht in natürlicher Freiheit, sie bäumen sich gegen die Gefangenschaft oder ergeben sich in ihr Schicksal. Durch den spürbaren Block bleibt immer ein eigener Raum um die Figuren erhalten, in dem sie leben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Bacchus
- 1. Rom und der Auftrag
- 2. Der Weg und die Rezipienten
- 3. Bildfindung und Neoplatonismus
- 4. Allansichtigkeit und Ikonologie
- 5. Selbstformation und Selbstdarstellung
- II. DAVID
- 1. Der Marmorblock
- 2. Die Aufstellung
- 3. Die Vorläufer
- 4. Die politische Bedeutung
- III. MATTHÄUS
- 1. Auftrag und Scheitern
- 2. Vorläufer und Neuerungen
- 3. Technik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Michelangelos frühe monumentale Skulpturen – Bacchus, David und Matthäus – und analysiert deren Entstehungskontext, Rezeption und künstlerische Bedeutung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Michelangelos Stil und seiner Auseinandersetzung mit der antiken Tradition.
- Michelangelos künstlerische Entwicklung in seiner frühen Schaffensperiode
- Die Rolle des Auftraggebers und die Rezeption der Skulpturen
- Michelangelos Umgang mit der antiken Tradition und dessen Abkehr von klassischen Idealen
- Die Bedeutung von Allansichtigkeit in Michelangelos Werk
- Der Einfluss des Neoplatonismus auf Michelangelos Bildfindung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Bacchus: Der Bacchus, Michelangelos früheste erhaltene monumentale Freiskulptur, entstand 1496-97 in Rom im Auftrag von Kardinal Raffaele Riario. Die Skulptur, die heute im Museo Nazionale del Bargello in Florenz steht, zeichnet sich durch ihre Allansichtigkeit und die ungewöhnlich starke Betonung der Trunkenheit des Bacchus aus, welche von klassischen Vorbildern abweicht. Die inhaltliche Konzeption und Tragweite der Skulptur wird durch diese Allansichtigkeit gewährleistet. Nach Fertigstellung gelangte die Skulptur in den Besitz des Bankiers Jacopo Galli, bevor sie schließlich in die Medici-Sammlung und später ins Bargello-Museum kam. Die Rezeption des Werkes zeigt eine Entwicklung von höchster Bewunderung hin zu kritischer Auseinandersetzung mit dem "unangemessenen Naturalismus".
Schlüsselwörter
Michelangelo, Bacchus, David, Matthäus, Renaissance-Skulptur, Neoplatonismus, Allansichtigkeit, Antike, Rezeption, Künstlerische Entwicklung, Marmor, Florenz, Rom.
Häufig gestellte Fragen zu: Michelangelo - Frühe Monumentalskulpturen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert Michelangelos frühe monumentale Skulpturen – Bacchus, David und Matthäus – unter Berücksichtigung ihres Entstehungskontextes, ihrer Rezeption und künstlerischen Bedeutung. Der Fokus liegt auf Michelangelos stilistischer Entwicklung und seinem Umgang mit der antiken Tradition.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Michelangelos künstlerische Entwicklung, die Rolle des Auftraggebers und die Rezeption der Skulpturen, Michelangelos Umgang mit der antiken Tradition und dessen Abkehr von klassischen Idealen, die Bedeutung von Allansichtigkeit in Michelangelos Werk und den Einfluss des Neoplatonismus auf seine Bildfindung.
Welche Skulpturen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei Skulpturen: den Bacchus, den David und den Matthäus. Für jede Skulptur werden Entstehung, Kontext, Rezeption und künstlerische Bedeutung ausführlich behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptteile (Bacchus, David, Matthäus) gegliedert, wobei jeder Teil in mehrere Unterkapitel unterteilt ist. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Was wird im Kapitel über den Bacchus beschrieben?
Das Kapitel über den Bacchus beschreibt die Entstehung der Skulptur (1496-97 in Rom im Auftrag von Kardinal Raffaele Riario), ihre ungewöhnliche Betonung der Trunkenheit des Bacchus, die Allansichtigkeit und den Abweichen von klassischen Vorbildern. Es wird auch die Rezeption des Werkes von höchster Bewunderung bis hin zu kritischer Auseinandersetzung mit dem "unangemessenen Naturalismus" beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Michelangelo, Bacchus, David, Matthäus, Renaissance-Skulptur, Neoplatonismus, Allansichtigkeit, Antike, Rezeption, Künstlerische Entwicklung, Marmor, Florenz, Rom.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Wissenschaftler und Studenten, die sich mit Renaissance-Skulptur, Michelangelo und den kunstgeschichtlichen Aspekten seiner Werke auseinandersetzen.
- Quote paper
- Robert Gander (Author), 2006, Michelangelos frühe monumentale Skulpturen: Bacchus - David - Matthäus , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64468