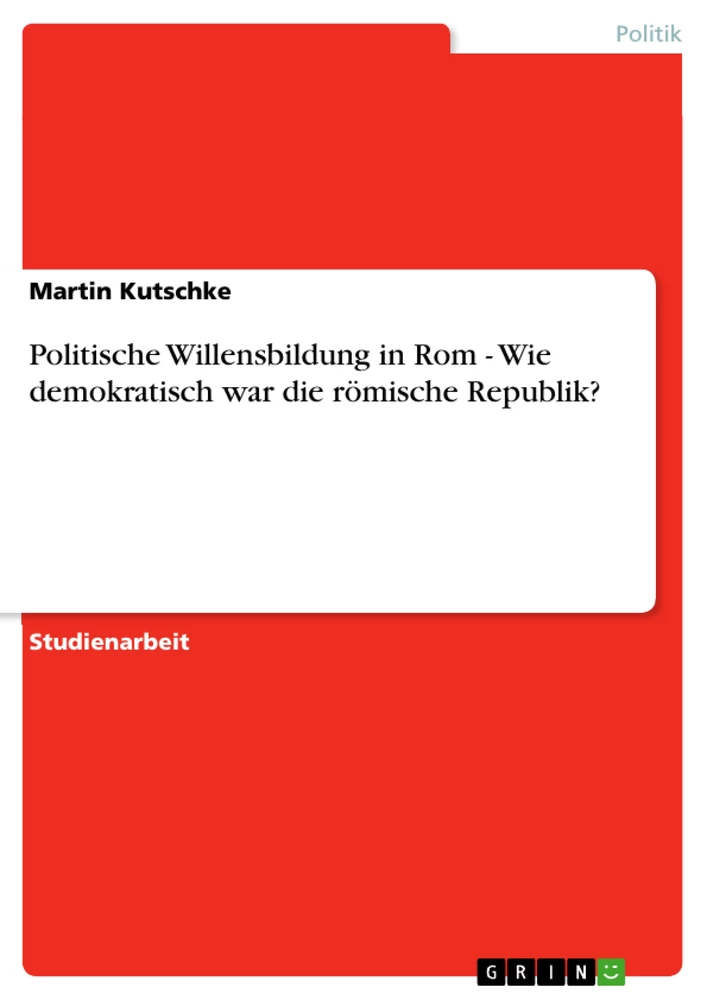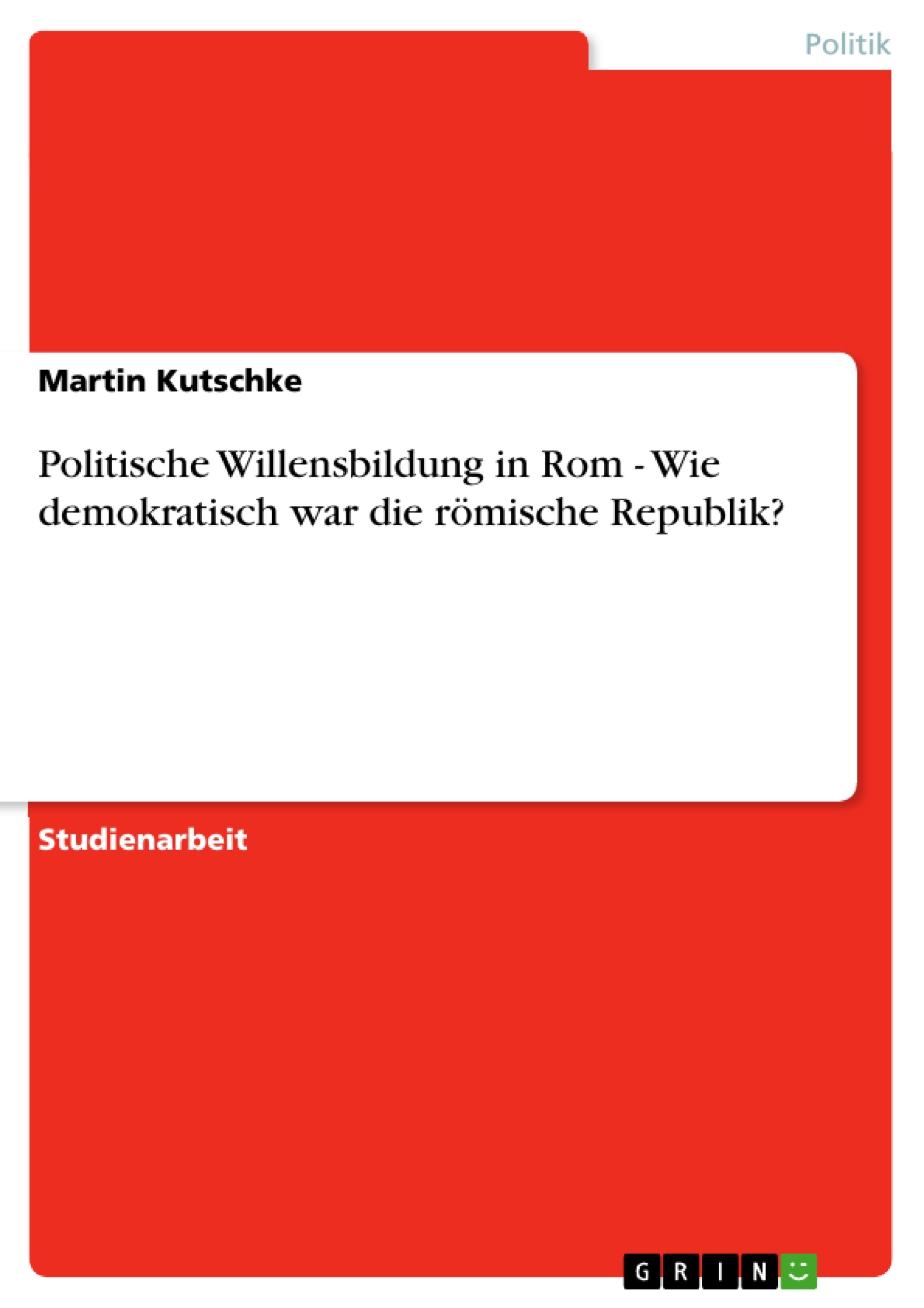Einleitung: Demokratie oder Aristokratie?
In der Debatte um den Charakter der Verfassung der römischen Republik lassen sich zwei Positionen ausmachen, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite wird mit Verweis auf die Entscheidungen in den Volksversammlungen der demokratische Charakter hervorgehoben. Auf der anderen Seite wird die römische Republik als eine Aristokratie dargestellt und auf die Abhängigkeit der Volksversammlungen von der herrschenden Schicht hingewiesen. Wägt man zwischen diesen beiden Haltungen ab, so stellt sich die Frage, wie demokratisch die Republik in Rom tatsächlich war. In der vorliegenden Arbeit soll dieses Problem erörtert werden. In dieser Hinsicht wird vor allem der Zeitraum der klassischen Republik bis 133 v. Chr. betrachtet, wobei allerdings weniger auf die historische Entwicklung als vielmehr auf grundlegenden Strukturen der politischen Ordnung eingegangen wird.
Zu diesem Zweck wird im ersten Teil die herrschende Schicht Roms dargestellt. Die Punkte, die behandelt werden, sind zu erst die Grundlagen der sozialen Ordnung in Rom, die Clientelbindungen. Als nächstes wird die Legitimität der Herrschaft durch die Nobilität behandelt sowie die Rekrutierung ihrer Mitglieder. Schließlich wird noch die Willensbildung innerhalb dieser gesellschaftlichen Gruppe näher betrachtet. Im zweiten Teil werden dann die Herrschaftsinstrumente, nämlich die Magistrate und der Senat, und ihre Beziehung zueinander diskutiert. In einem dritten Teil wird dann auf die Willensbildung innerhalb des Volkes eingegangen, beginnend mit der Rolle der Volksversammlungen und der sogenannten contiones. Weitere Punkte sind noch das Phänomen der Wahlbestechung ebenso wie die Bedeutung der Formel „Brot und Spiele“.
Der Umfang der für diese Thematik zu Verfügung stehende Literatur ist durchaus befriedigend, wobei allerdings anzumerken ist, dass die meisten Darstellungen sich auf die geschichtliche Entwicklung Roms konzentrieren.
Eine Ausnahme bildet hier die in überarbeiteter Auflage erschienene „Verfassung der römischen Republik“ von Jochen Bleicken, in der die strukturellen Aspekte des politischen Systems in Rom hervorragend dargestellt sind. Auch die von Martin Jehne herausgegebene Aufsatzsammlung mit dem Titel „Demokratie in Rom?“ bietet eine Reihe wichtiger Informationen zu einzelnen Punkten der hier bearbeiteten Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Demokratie oder Aristokratie?
- 2. Die Herrschaftsausübung durch die Nobilität
- 2.1. Grundlage der sozialen Ordnung: die Clientel-Verhältnisse
- 2.2. Die Legitimität des Herrschaftsanspruches der Nobilität
- 2.3. Die Rekrutierung ihrer Mitglieder
- 2.4. Die Willensbildung innerhalb der Nobilität
- 3. Die Herrschaftsinstrumente der Nobilität
- 3.1. Die Magistratur als „Exekutive“ der römischen Republik
- 3.2. Die Abhängigkeit der Magistratur vom Senat
- 4. Die politische Willensbildung des Volkes
- 4.1. „Contio“ und „Comitia“
- 4.2. „Ambitus\" - Willensbildung durch Bestechung?
- 4.3. Die Rolle von „Brot und Spielen“
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie demokratisch die römische Republik tatsächlich war. Der Fokus liegt dabei auf der klassischen Republik bis 133 v. Chr. und untersucht die strukturellen Aspekte der politischen Ordnung. Die Arbeit beleuchtet die herrschende Schicht in Rom, ihre Herrschaftsinstrumente und die politische Willensbildung des Volkes.
- Die Rolle der Clientel-Verhältnisse als Grundlage der sozialen Ordnung in Rom
- Die Legitimität und die Rekrutierung der herrschenden Schicht
- Die Machtstrukturen der Magistratur und des Senats
- Die politische Willensbildung durch Volksversammlungen, „Contiones“ und „Ambitus“
- Die Bedeutung von „Brot und Spielen“ in der römischen Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zwei gegensätzlichen Positionen in der Debatte um den Charakter der römischen Republik dar: Demokratie vs. Aristokratie. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Frage im Kontext der klassischen Republik zu untersuchen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der herrschenden Schicht Roms, der Nobilität. Es werden die Clientel-Verhältnisse als Grundlage der sozialen Ordnung, die Legitimität des Herrschaftsanspruches der Nobilität, die Rekrutierung ihrer Mitglieder und die Willensbildung innerhalb der Nobilität analysiert.
Kapitel 3 beleuchtet die Herrschaftsinstrumente der Nobilität, die Magistratur und den Senat. Hierbei wird die Beziehung zwischen diesen beiden Organen und die Abhängigkeit der Magistratur vom Senat untersucht.
Kapitel 4 geht auf die politische Willensbildung des Volkes ein. Es werden die Volksversammlungen, die sogenannten „Contiones“ und das Phänomen der Wahlbestechung („Ambitus“) analysiert. Außerdem wird die Bedeutung von „Brot und Spielen“ im Kontext der römischen Politik untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die politische Ordnung der römischen Republik, insbesondere die Strukturen der Herrschaft, die Rolle der Nobilität, die politischen Institutionen und die Willensbildung des Volkes. Zentrale Konzepte sind Clientel-Verhältnisse, Magistratur, Senat, Volksversammlungen, „Contiones“, „Ambitus“ und „Brot und Spiele“.
- Quote paper
- Martin Kutschke (Author), 2002, Politische Willensbildung in Rom - Wie demokratisch war die römische Republik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64427