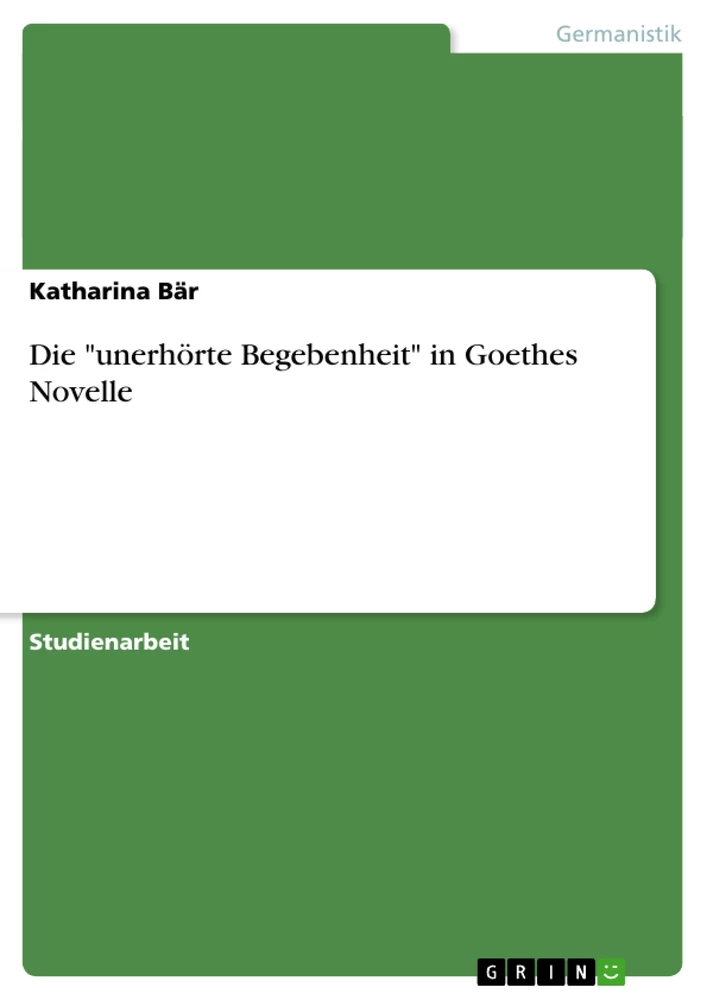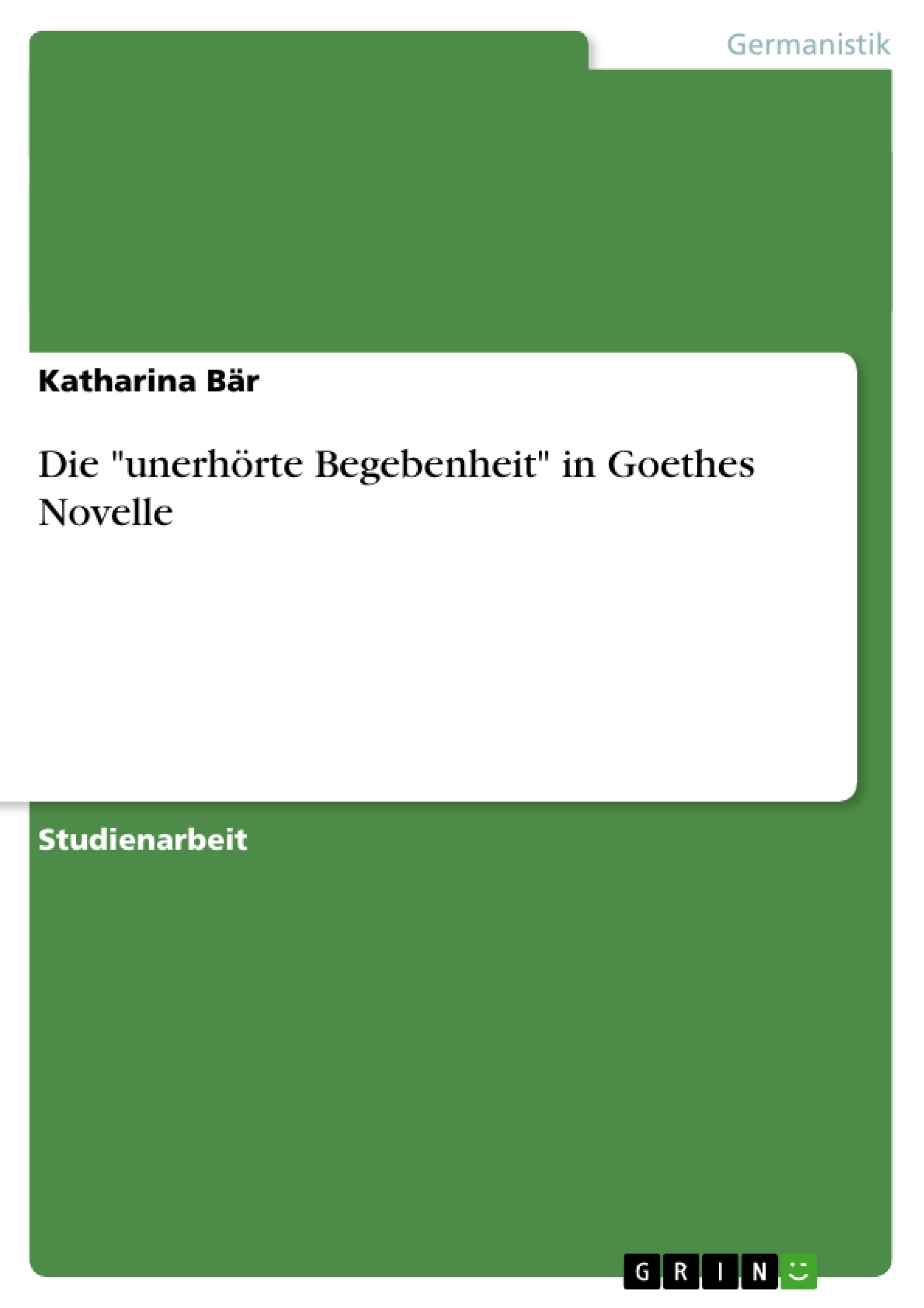Im Jahre 1828 erschien Goethes Novelle erstmals im 15. Band der Ausgabe letzter Hand zusammen mit weiteren Werken, wie Märchen, Die Aufgeregten und Die guten Weiber. Die Grundidee für die Erzählung hatte Goethe jedoch etwa 30 Jahre zuvor. Zunächst als Versepos im Stil von Hermann und Dorothea gedacht, stellte er es unter dem Titel Die Jagd im Jahre 1797 in seinem Freundeskreis, unter anderem Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt vor. Dem Briefwechsel ist zu entnehmen, dass der Stoff bei seinen Freunden großen Zuspruch erhielt, über die Form war man sich jedoch uneinig: Goethe stellte sich ein episches Gedicht in Hexametern vor, Schiller äusserte darauf seine Bedenken, ob sich der Stoff überhaupt für dieses klassisch-antike Muster eigne. Die Einwände seiner Freunde und die fehlenden retardierenden Momente, die nach seiner damaligen Ansicht das Epische ausmachten, veranlassten Goethe schließlich dazu, sein Anliegen vorerst aufzugeben.1 Knapp 30 Jahre später, im Oktober 1826, griff er den Stoff wieder neu auf. Die Diskussion mit Schiller und Humboldt schien ihm jedoch eine Lehre gewesen zu sein, da er sich, in dem anschließenden, zwei Jahre andauernden, Schaffensprozess nicht wieder auf einen solchen, „hinderlichen Diskurs“2 einließ.
Dieser kurze Einblick in die Entstehungsgeschichte lässt deutlich werden, dass die Grundidee der Novelle nicht aus der Zeit ihres Druckes stammt, sondern bis in das Jahr 1797 zurückreicht. Das Verwerfen und Wiederaufnehmen des Stoffs trug sicherlich auch zu den inhaltlichen und formalen Besonderheiten und Gegensätzen der Erzählung bei, auf die im folgenden Kapitel, unter dem Gesichtspunkt der „unerhörten Begenbenheit“ näher eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehungsgeschichte der Novelle
- Die „unerhörte Begebenheit“
- Goethes Definition
- Die „unerhörte Begebenheit“ im Text
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes Novelle und konzentriert sich auf den Begriff der „unerhörten Begebenheit“. Die Zielsetzung ist es, Goethes Definition dieser zentralen Idee zu analysieren und deren Umsetzung in der Erzählung zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet die Entstehungsgeschichte der Novelle und untersucht verschiedene Interpretationen der „unerhörten Begebenheit“ im Kontext des Werkes.
- Goethes Definition der Novelle als „unerhörte Begebenheit“
- Die Entstehungsgeschichte und ihre Auswirkungen auf die Novelle
- Der Kontrast zwischen kultivierter Gesellschaft und Natur in der Erzählung
- Die verschiedenen Interpretationen der „unerhörten Begebenheit“ im Text
- Die Bedeutung der Gegensätze in der formalen und inhaltlichen Gestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der „unerhörten Begebenheit“ in Goethes Novelle ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie gibt einen kurzen Überblick über die Herangehensweise und die zu behandelnden Aspekte, wobei der Fokus auf der Analyse der „unerhörten Begebenheit“ im Kontext verschiedener wissenschaftlicher Interpretationen liegt. Der Leser wird auf die folgende Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte und der detaillierten Interpretation des zentralen Themas vorbereitet.
Die Entstehungsgeschichte der Novelle: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung von Goethes Novelle, von der ersten Idee als Versepos im Jahr 1797 bis zur Veröffentlichung im Jahr 1828. Es beschreibt die anfängliche Ablehnung des Stoffes durch Schiller und Humboldt aufgrund von Bedenken bezüglich der Eignung für ein episches Gedicht. Die Diskussionen über die Form und der letztendliche Verzicht auf das Versepos werden dargestellt. Die Wiederaufnahme des Projekts 30 Jahre später und der daraus resultierende, unabhängige Schreibprozess werden analysiert und ihre Auswirkungen auf die inhaltlichen und formalen Besonderheiten der Novelle hervorgehoben. Der kontrastierende Schaffensprozess beeinflusste die endgültige Gestalt der Erzählung entscheidend.
Die „unerhörte Begebenheit“: Dieses Kapitel analysiert den zentralen Begriff der „unerhörten Begebenheit“ in Goethes Novelle. Es beginnt mit Eckermanns Aufzeichnung von Goethes Definition der Novelle als „sich ereignete, unerhörte Begebenheit“. Anschließend wird die Umsetzung dieses Begriffs im Text untersucht, wobei die gegensätzlichen Welten der kultivierten Gesellschaft und der unberechenbaren Natur hervorgehoben werden. Der Text analysiert die drei Stellen, an denen Goethe von einer „unerhörten Begebenheit“ spricht: den Brand, den Tod des Tigers und die Besänftigung des Löwen durch den Jungen. Das Kapitel analysiert diese als Wendepunkte und Höhepunkte der Handlung. Die Besänftigung des Löwen durch den Jungen wird als die eigentliche „unerhörte Begebenheit“ interpretiert, welche den Kontrast zwischen Chaos und Harmonie auflöst.
Schlüsselwörter
Novelle, Goethe, unerhörte Begebenheit, Entstehungsgeschichte, Gattungspoetik, Interpretation, Gegensatz, Natur, Gesellschaft, Eckermann.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes Novelle und der „unerhörten Begebenheit“
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über Goethes Novelle. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Begriffs der „unerhörten Begebenheit“ in Goethes Novelle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel „Einleitung“, „Die Entstehungsgeschichte der Novelle“, „Die „unerhörte Begebenheit“ (mit Unterkapiteln zu Goethes Definition und deren Umsetzung im Text) und „Fazit“ (welches in der Vorschau nicht explizit detailliert ist).
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Goethes Definition der „unerhörten Begebenheit“ und untersucht deren Umsetzung in seiner Novelle. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Novelle und verschiedene Interpretationen des zentralen Begriffs im Kontext des Werkes.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Goethes Definition der Novelle als „unerhörte Begebenheit“, die Entstehungsgeschichte und ihre Auswirkungen auf die Novelle, den Kontrast zwischen kultivierter Gesellschaft und Natur, verschiedene Interpretationen der „unerhörten Begebenheit“ im Text und die Bedeutung von Gegensätzen in der formalen und inhaltlichen Gestaltung.
Was wird in der Kapitelzusammenfassung zu „Die Entstehungsgeschichte der Novelle“ beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von Goethes Novelle, von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung. Es thematisiert die anfängliche Ablehnung des Stoffes durch Schiller und Humboldt, die Diskussionen über die Form, den Verzicht auf das Versepos und die Wiederaufnahme des Projekts 30 Jahre später. Der Einfluss des Schreibprozesses auf die inhaltlichen und formalen Besonderheiten der Novelle wird analysiert.
Wie wird die „unerhörte Begebenheit“ im Text analysiert?
Das Kapitel „Die „unerhörte Begebenheit“ analysiert den Begriff anhand von Goethes Definition und untersucht dessen Umsetzung im Text. Es werden die gegensätzlichen Welten der kultivierten Gesellschaft und der Natur hervorgehoben. Drei Ereignisse (Brand, Tod des Tigers, Besänftigung des Löwen) werden als Wendepunkte und Höhepunkte der Handlung und als mögliche „unerhörte Begebenheiten“ interpretiert. Die Besänftigung des Löwen wird als die eigentliche „unerhörte Begebenheit“ interpretiert, die den Kontrast zwischen Chaos und Harmonie auflöst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Novelle, Goethe, unerhörte Begebenheit, Entstehungsgeschichte, Gattungspoetik, Interpretation, Gegensatz, Natur, Gesellschaft, Eckermann.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Leser, die sich mit Goethes Novelle und der literaturwissenschaftlichen Interpretation von Erzähltexten auseinandersetzen möchten.
- Citar trabajo
- Katharina Bär (Autor), 2006, Die "unerhörte Begebenheit" in Goethes Novelle, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64302