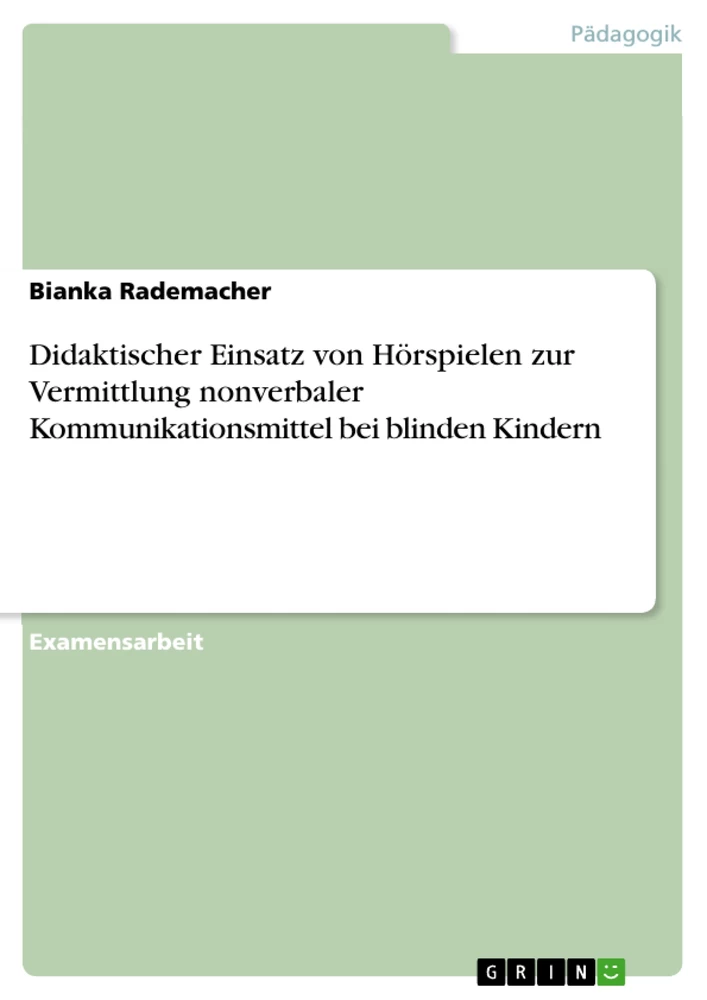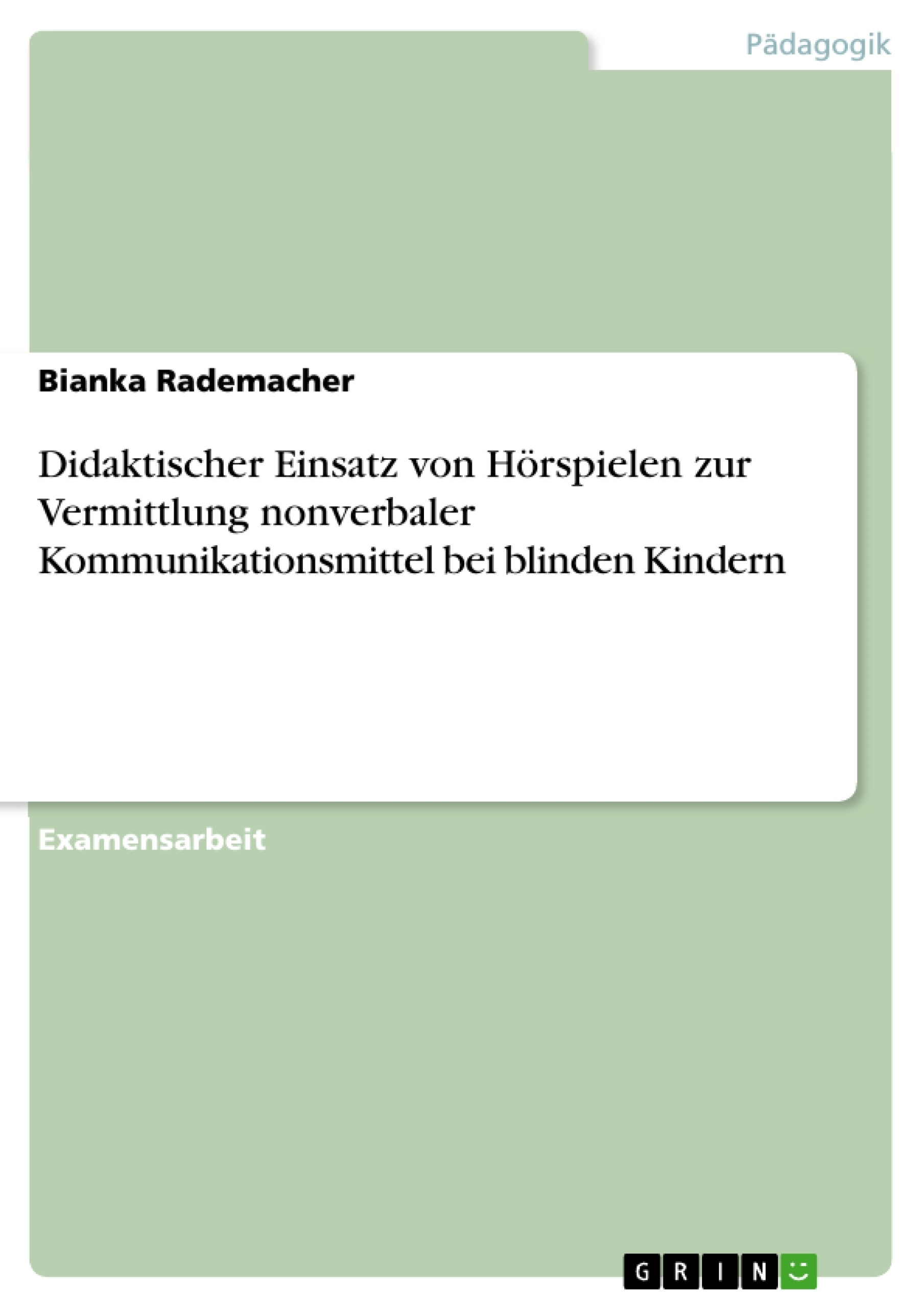Aus dem Wissen heraus, dass Mimik und Haltung des Körpers als erster Eindruck bei einer Kontaktaufnahme im Leben des Menschen eine bedeutende Rolle spielen, entstand die Idee zu dieser Arbeit.
Mimik und Körperhaltung dienen den sehenden Menschen als nonverbale Kommunikationsmittel und haben hierin eine ältere Tradition als das Werkzeug Sprache. Durch Mimik und Körperhaltung, aber auch durch die Stimme lassen sich Emotionen wie zum Beispiel Ärger und Ungeduld ausdrücken.
Für blinde Menschen, die diese Emotionen nicht visuell vom Gesicht ablesen, sich nicht in den Augen eines anderen sehen können, werden Stimme und Sprache zum wichtigen Kommunikationsmittel. Da der blinde Mensch in einer Welt der Sehenden lebt, ist es für ihn unabdingbar, sich mit den nonverbalen Ausdrucksformen Sehender und der Wirkung seiner eigenen nonverbalen Kommunikationsmittel auseinanderzusetzen.
In diesem speziellen Themengebiet der nonverbalen Verhaltensmuster, insbesondere der Mimik und Körperhaltung blinder Kinder sowie deren Wirkung auf Sehende herrscht ein erstaunlicher Mangel an Literatur.
Ich werde in meiner Arbeit den didaktischen Einsatz von Hörspielen zur Unterstützung des nonverbalen Ausdrucksprogramms bei blinden Kindern darstellen. Ich beziehe mich auf die eingegrenzte Gruppe der blinden Kinder, die von Geburt oder kurz danach erblindet sind, ohne zusätzliche kognitive oder andere Behinderungen. Diese starke Eingrenzung wurde vorgenommen, um klar davon ausgehen zu können, dass in der frühen Kindheit weder die Möglichkeit bestand, nonverbales Verhalten visuell zu erlernen, noch über noch so geringe visuelle Wahrnehmung Vorstellungen über nonverbales kommunikatives Verhalten zu erlangen.
Ziel der Aneignung und Erweiterung nonverbaler Kommunikationsmittel für blinde Kinder sollte die Erhöhung sozialer Kompetenz sein.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorgehensweise
- 2. Was die Arbeit nicht beinhaltet
- 3. Geschichte und Grundzüge des traditionellen und neuen deutschen Hörspiels
- 3.1. Das deutsche Hörspiel von 1923 bis heute
- 3.2. Das traditionelle Hörspiel als Wortkunstwerk
- 3.3. Das Hörspiel in der Schule für Blinde
- 3.4. Hörbeispiel „Ben liebt Anna“ von Peter Härtling
- 4. Die Wahrnehmung Blinder
- 4.1. Das Hören im Verhältnis zum Sehen
- 4.2. Die Hörerziehung bei blinden Kindern
- 4.3. Der Charakter: die Stimme
- 5. Kommunikation
- 5.1. Nonverbale Kommunikation
- 6. Mimik und Haltung als emotionale Informationsträger
- 6.1. Die Mimik
- 6.2. Das Gesicht
- 6.2.1. Gesichtsausdrücke Blinder
- 6.2.2. Die Bedeutung unterschiedlicher Gesichtsausdrücke
- 6.2.3. Die Fähigkeit blinder Kinder, Gesichtsausdrücke auf Verlangen zu reproduzieren
- 6.3. Das Lächeln
- 6.3.1. Das Lächeln in der Interaktion
- 6.4. Das coverbale Verhalten Blinder als Feedbackverhalten in sozialen Interaktionen
- 6.5. Die Körperhaltung Blinder
- 6.5.1. Die Bedeutung der Haltung in der Interaktion
- 6.5.2. Übungsprogramme zur Verbesserung der Haltung blinder Kinder
- 7. Die Psychomotorik in ihrer Bedeutung für den Menschen
- 8. Ausdruck und Darstellung
- 8.1. Die Symbolisierungsfähigkeit als Sprache des Ausdrucks
- 8.2. Trainingsprogramme zur Differenzierung der emotionalen Ausdrucksfähigkeit bei blinden Kindern
- 9. Darstellendes Spiel an der Schule für Blinde
- 10. Stereotypien
- 11. Der Katalog erwünschter Verhaltensweisen
- 12. Soziale Kompetenz
- 13. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit untersucht den didaktischen Einsatz von Hörspielen zur Vermittlung nonverbaler Kommunikationsmittel bei blinden Kindern. Die Arbeit fokussiert auf die Gruppe blinder Kinder, die von Geburt an oder in der frühen Kindheit erblindet sind und keine weiteren kognitiven oder körperlichen Einschränkungen haben. Ziel ist es, die soziale Kompetenz dieser Kinder durch die Aneignung und Erweiterung nonverbaler Kommunikationsmittel zu steigern.
- Die Rolle des Hörspiels in der Vermittlung nonverbaler Kommunikation bei blinden Kindern.
- Die Bedeutung von Mimik und Körperhaltung als nonverbale Kommunikationsmittel.
- Der Einfluss nonverbaler Ausdrucksformen auf die Interaktion mit sehenden Menschen.
- Die Entwicklung von didaktischen Konzepten zur Integration des Hörspiels in den Unterricht für blinde Kinder.
- Die Förderung der sozialen Kompetenz blinder Kinder durch die Vermittlung nonverbaler Kommunikationsmittel.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit vor. Es wird auf die Bedeutung nonverbaler Kommunikationsmittel, insbesondere Mimik und Körperhaltung, im sozialen Miteinander hingewiesen und der Fokus auf blinde Kinder gerichtet. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des Hörspiels als didaktisches Instrument zur Vermittlung nonverbaler Kommunikationsmittel und untersucht dessen Potential für blinde Kinder.
Im zweiten Kapitel wird die Geschichte und der gegenwärtige Stand des deutschen Hörspiels beleuchtet. Es werden die verschiedenen Entwicklungsstufen des Hörspiels, von seinen Anfängen bis zur heutigen Zeit, sowie die Besonderheiten des Hörspiels als Wortkunstwerk dargestellt. Zudem wird der Einsatz des Hörspiels in der Schule für Blinde untersucht und ein Hörbeispiel analysiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Wahrnehmung Blinder, insbesondere dem Hören im Verhältnis zum Sehen. Es werden die Prozesse der Hörerziehung bei blinden Kindern und die Rolle der Stimme als Kommunikationsmittel erläutert.
Das vierte Kapitel behandelt die Kommunikation und die Bedeutung nonverbaler Kommunikationsmittel. Es wird auf die Funktion von Mimik und Körperhaltung als emotionale Informationsträger eingegangen und die Bedeutung der Mimik als nonverbale Kommunikationsform für blinde Kinder analysiert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Körperhaltung und deren Bedeutung in der Interaktion. Es werden Übungsprogramme zur Verbesserung der Haltung blinder Kinder vorgestellt.
Im sechsten Kapitel wird die Psychomotorik und ihre Bedeutung für den Menschen behandelt.
Das siebte Kapitel widmet sich dem Thema Ausdruck und Darstellung und stellt die Symbolisierungsfähigkeit als Sprache des Ausdrucks dar. Es werden Trainingsprogramme zur Differenzierung der emotionalen Ausdrucksfähigkeit bei blinden Kindern vorgestellt.
Das achte Kapitel befasst sich mit dem darstellenden Spiel an der Schule für Blinde und untersucht die Bedeutung dieser Form der Auseinandersetzung mit der eigenen Ausdrucksfähigkeit für blinde Kinder.
Das neunte Kapitel behandelt die Themen Stereotypien und der Katalog erwünschter Verhaltensweisen. Es wird der Einfluss gesellschaftlicher Erwartungen auf das Verhalten blinder Kinder und die Bedeutung von sozialer Kompetenz für die Integration in die Gesellschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Hörspiel, nonverbale Kommunikation, Mimik, Körperhaltung, blinde Kinder, soziale Kompetenz, Integration, Didaktik, Hörerziehung, Stimme, emotionale Ausdrucksfähigkeit.
- Citar trabajo
- Bianka Rademacher (Autor), 2000, Didaktischer Einsatz von Hörspielen zur Vermittlung nonverbaler Kommunikationsmittel bei blinden Kindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6422