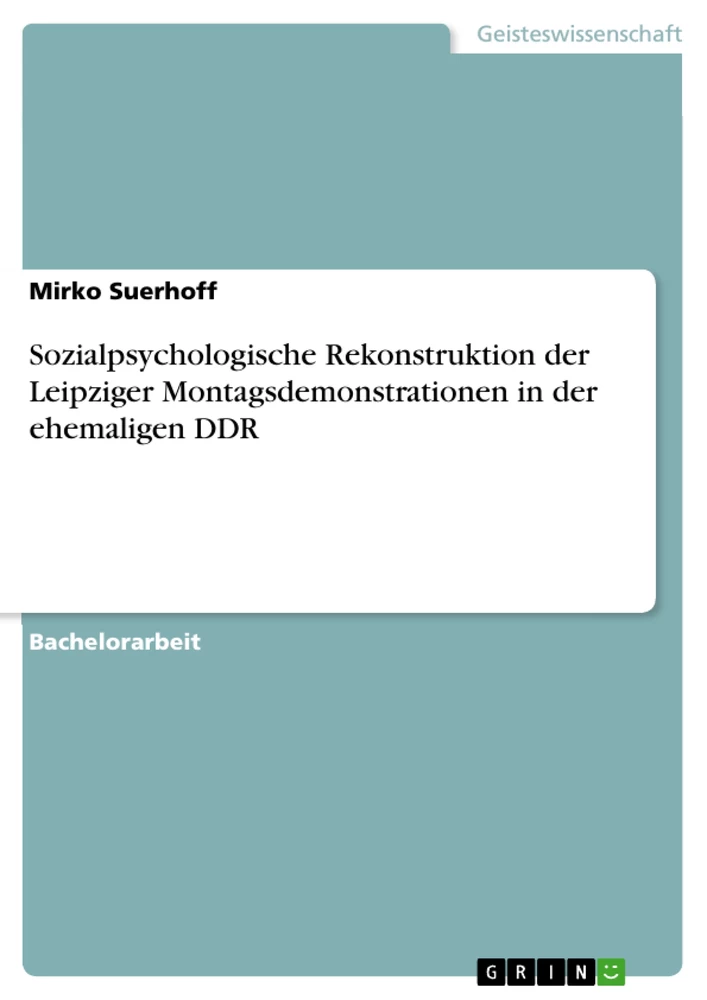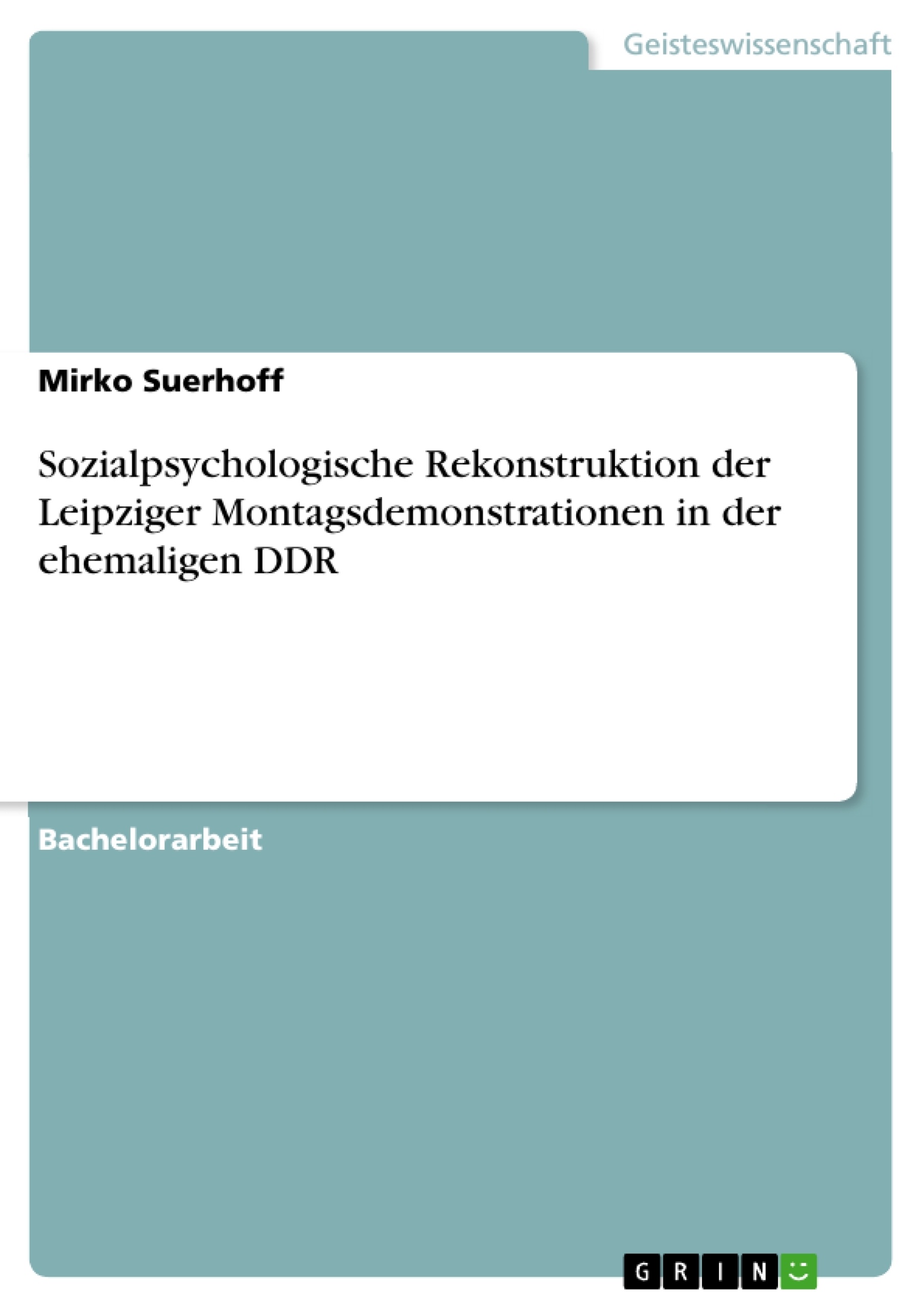Diese Arbeit beschäftigt sich grundlegend mit dem Verlauf der Oktoberrevolution in der nunmehr ehemaligen DDR. Mit welcher Logik lassen sich der spontane Ausbruch, sowie der lawinenartige Verlauf der Demonstrationen im Oktober erklären? Es wird darauf eingegangen, unter welchen Umständen vereinzelter Widerstand in kurzer Zeit zu massenhaften Demonstrationen führte. Dazu soll insbesondere der steile Anstieg der Protestierenden während der Leipziger Demonstrationen rückblickend erläutert werden. Um die Entscheidungssituation der Akteure darzustellen, wird das Modell von Bernhard Prosch und Martin Abraham verwendet.
Da eine Erklärung nach einem Makro-Mikro-Makro Schema erfolgt, werden ein Abriss der wichtigsten Ereignisse vor dem Umbruch und deren kausale Wirkunken dargelegt. Die Arbeit beinhaltet eine Zusammenführung verschiedener Erklärungsmodelle für den Verlauf des steilen Anstiegs der Teilnehmerzahlen. Kritische Betrachtungen mit Hinblick auf die Interpretationen von Schwellenmodellen bezüglich der Schwellenwertverteilung und Schwellenwertgrenzen von Modellen werden ebenfalls integriert. Dabei werden die Ereignisse in Leipzig herangezogen, um exemplarisch analysiert zu werden. Der Verlauf der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR im Jahr 1989 erreichte ein Resultat, dessen Folgen auch umfassende Veränderungen für die BRD bedeuteten. Ebenso änderte sich auch die weltpolitische Lage auf gravierende Weise, vor allem zwischen den Großmächten USA und Sowjetunion. Die Vereinigung Deutschlands durch eine friedliche Revolution ausgelöst, bewirkte also Zäsuren auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. In dieser Arbeit werden die Ausdrücke Umbruch, Wende, oder Revolution trotz unterschiedlicher Konnotationen synonym verwendet. Die Ausdrücke SEU-Modell, Wert/Erwartungsmodell, sowie Kosten/Nutzenmodell werden ebenfalls gleichbedeutend gebraucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung eines Protestklimas
- Erste Stationen des kollektiven Protests in der ehemaligen DDR
- Erosion des ideologischen Überbaus
- Figurationen der Makroebene
- Ereignisse vor der friedlichen Revolution
- Massenhandlungen
- Ausdruck der politischen Deprivation
- Komponenten der kollektiven Mobilisierung
- Die zwei Formen der sozialen Bewegung
- Aspekte der friedlichen Revolution
- Gründe für die ausbleibende Eskalation der Gewalt
- Das Trittbrettfahrerphänomen
- Mobilisierung
- Erklärungsschema der Mobilisierung
- Das Mikroschema der Teilnahmeentscheidung
- Änderungen der Randbedingungen
- Akteursgruppen mit nicht instrumentell-eigennützigen Handlungsantrieben
- Der Emergenzeffekt
- Andere Koordinationsformen
- Erweiterung der Grenzen des Diffusionsmodells
- Zusammenfassung/ Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Leipziger Montagsdemonstrationen von 1989 und deren Entwicklung vom vereinzelten Widerstand zu massenhaften Protesten. Ziel ist es, die Logik hinter dem spontanen Ausbruch und dem lawinenartigen Verlauf der Demonstrationen zu erklären und die Entscheidungsprozesse der beteiligten Akteure zu analysieren. Hierfür wird das Modell von Prosch und Abraham verwendet.
- Entwicklung eines Protestklimas in der DDR
- Analyse der Massenhandlungen und kollektiven Mobilisierung
- Erklärung des steilen Anstiegs der Teilnehmerzahlen
- Bewertung verschiedener Erklärungsmodelle (z.B. Schwellenmodelle)
- Die Rolle individueller Entscheidungsprozesse im Kontext der Massenproteste
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage nach der Entstehung und dem Verlauf der Leipziger Montagsdemonstrationen. Sie beschreibt die Methode (Makro-Mikro-Makro Schema), die verwendeten Modelle (Prosch/Abraham) und den Fokus auf die Analyse des steilen Anstiegs der Protestteilnehmer. Die Arbeit integriert kritische Betrachtungen von Schwellenmodellen und stellt die Bedeutung der Ereignisse von 1989 für die nationale und internationale Politik heraus.
Entstehung eines Protestklimas: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte der Montagsdemonstrationen, beginnend mit dem Aufstand von 1953 und dem Mauerbau 1961. Es analysiert die zunehmende Erosion des ideologischen Überbaus der DDR, die wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten des Regimes, und die Rolle der Emigration. Die zunehmende Unterdrückung durch die Staatsmacht wird ebenfalls thematisiert, welche den Nährboden für zukünftigen Widerstand bildete.
Massenhandlungen: Dieses Kapitel analysiert die Massenproteste selbst, indem es die Ursachen, die Dynamik und die wichtigsten Charakteristika der Bewegung beschreibt. Es untersucht den Ausdruck politischer Deprivation, die Komponenten der kollektiven Mobilisierung und die zwei Formen der sozialen Bewegung. Die Friedliche Revolution und die Gründe für das Ausbleiben größerer Gewalttätigkeiten werden ebenfalls beleuchtet.
Mobilisierung: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Erklärung der Mobilisierung der Demonstranten. Es wird das Erklärungsschema der Mobilisierung detailliert dargestellt, unter Einbezug des Mikroschemas der individuellen Teilnahmeentscheidung. Die Arbeit analysiert die sich verändernden Randbedingungen und die Rolle von Akteuren mit nicht-instrumentell eigennützigen Handlungsantrieben. Konzepte wie der Emergenzeffekt und die Erweiterung der Grenzen des Diffusionsmodells werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Leipziger Montagsdemonstrationen, Friedliche Revolution, DDR, Protestbewegung, Massenmobilisierung, kollektives Handeln, Schwellenmodelle, individuelle Entscheidung, Prosch/Abraham-Modell, politische Deprivation, ideologische Erosion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Leipziger Montagsdemonstrationen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Leipziger Montagsdemonstrationen von 1989, ihren Verlauf vom vereinzelten Widerstand zu Massenprotesten und die Entscheidungsfindungsprozesse der beteiligten Akteure. Im Fokus steht die Erklärung des spontanen Ausbruchs und des lawinenartigen Anstiegs der Teilnehmerzahlen.
Welche Methoden und Modelle werden verwendet?
Die Arbeit nutzt ein Makro-Mikro-Makro-Schema und das Modell von Prosch und Abraham. Sie integriert kritische Betrachtungen von Schwellenmodellen und untersucht sowohl makro- als auch mikro-soziologische Aspekte der Mobilisierung.
Welche Themen werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage, beschreibt die verwendete Methode (Makro-Mikro-Makro Schema) und die Modelle (Prosch/Abraham). Sie betont die Analyse des steilen Anstiegs der Protestteilnehmer, kritische Betrachtungen von Schwellenmodellen und die Bedeutung der Ereignisse von 1989 für die nationale und internationale Politik.
Wie wird die Entstehung des Protestklimas beschrieben?
Das Kapitel "Entstehung eines Protestklimas" beleuchtet die Vorgeschichte, beginnend mit dem Aufstand von 1953 und dem Mauerbau 1961. Es analysiert die Erosion des ideologischen Überbaus der DDR, wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten des Regimes, die Rolle der Emigration und die zunehmende Unterdrückung durch die Staatsmacht als Nährboden für den Widerstand.
Was wird im Kapitel "Massenhandlungen" untersucht?
Dieses Kapitel analysiert die Massenproteste selbst: Ursachen, Dynamik und Charakteristika der Bewegung, den Ausdruck politischer Deprivation, Komponenten der kollektiven Mobilisierung, die zwei Formen der sozialen Bewegung, die Friedliche Revolution und die Gründe für das Ausbleiben größerer Gewalt.
Wie wird die Mobilisierung der Demonstranten erklärt?
Das Kapitel "Mobilisierung" erklärt die Mobilisierung anhand eines detaillierten Schemas, inklusive des Mikroschemas der individuellen Teilnahmeentscheidung. Es analysiert veränderte Randbedingungen, die Rolle von Akteuren mit nicht-instrumentell eigennützigen Handlungsantrieben, den Emergenzeffekt und die Erweiterung der Grenzen des Diffusionsmodells.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Leipziger Montagsdemonstrationen, Friedliche Revolution, DDR, Protestbewegung, Massenmobilisierung, kollektives Handeln, Schwellenmodelle, individuelle Entscheidung, Prosch/Abraham-Modell, politische Deprivation, ideologische Erosion.
Welche konkreten Fragen werden in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit beantwortet Fragen zur Entwicklung eines Protestklimas in der DDR, analysiert Massenhandlungen und kollektive Mobilisierung, erklärt den Anstieg der Teilnehmerzahlen, bewertet verschiedene Erklärungsmodelle (z.B. Schwellenmodelle) und untersucht die Rolle individueller Entscheidungsprozesse im Kontext der Massenproteste.
- Arbeit zitieren
- B.A. Mirko Suerhoff (Autor:in), 2005, Sozialpsychologische Rekonstruktion der Leipziger Montagsdemonstrationen in der ehemaligen DDR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64031