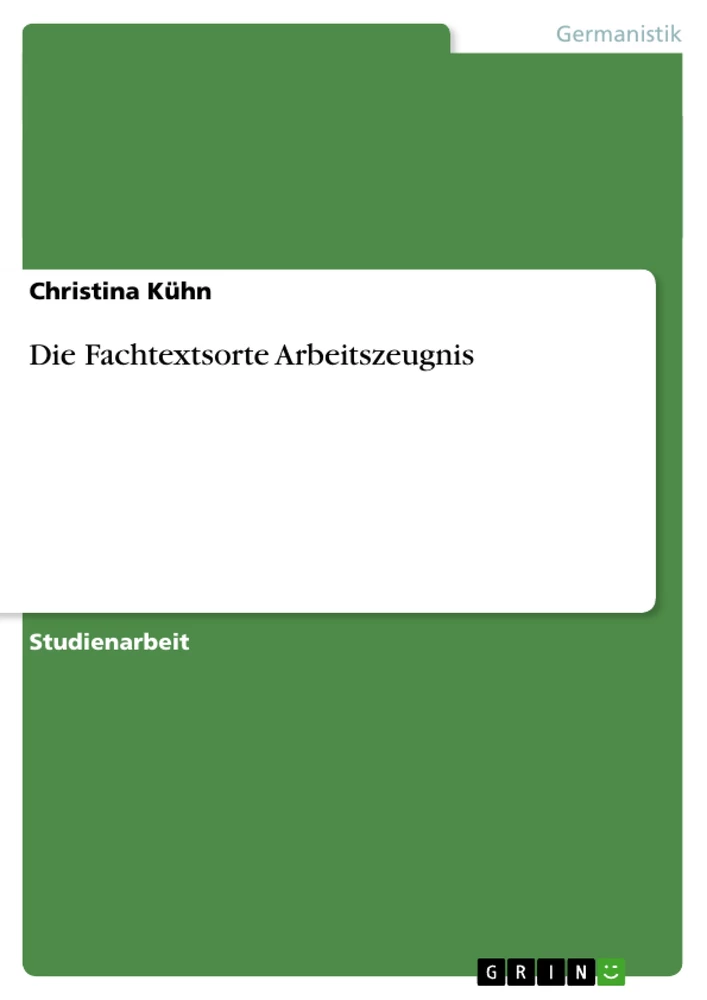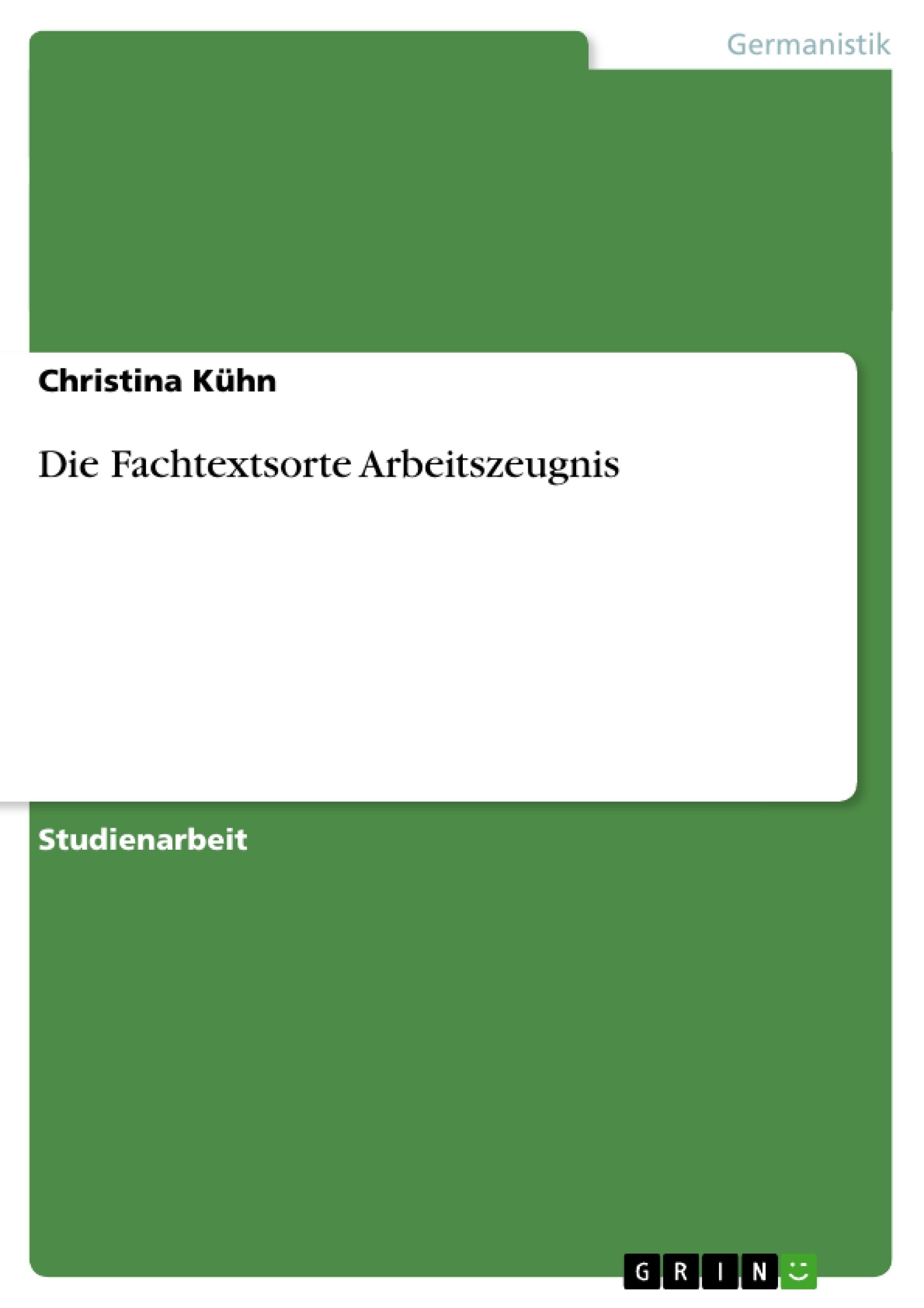Das Arbeitszeugnis ist seither ein wichtiges Element der Bewerbungsunterlagen eines Arbeitnehmers. Laut einem Urteil vom Bundesarbeitsgericht vom 08. Februar 1972 gilt es “...vor allem als Unterlage für eine Bewerbung um einen neuen Arbeitsplatz und stellt deshalb einen wichtigen Faktor im Arbeitsleben dar. [...] Für den Arbeitnehmer ist das Zeugnis gleichsam die Visitenkarte für weitere Bewerbungen.“.
Angesichts der momentan kritischen Arbeitsmarktsituation ist die Bedeutung des Arbeitszeugnisses nicht hoch genug anzurechnen. Die enorme Wichtigkeit wird durch die steigende Anzahl von Gerichtsverfahren zu diesem Thema widergespiegelt. Im Jahr 2003 kam es vor dem Arbeitsgericht zu über 30.000 Verfahren, die sich auf Erstellung bzw. Änderung des Arbeitszeugnisses bezogen.
Die Bedeutung des Arbeitszeugnisses wird von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich hoch eingestuft, dennoch nimmt das Zeugnis eine Sonderstellung innerhalb der Bewerbungsunterlagen ein, da es das einzige Dokument ist, welches nicht selbst vom Bewerber stammt. Bei der Besetzung von Stellen in einfacheren Berufen ist das Arbeitszeugnis kaum entscheidend, bei Arbeitsplätzen mit ansteigendem Rang gewinnt es jedoch mehr und mehr an Bedeutung. Erst im Bereich der Spitzenpositionen ist das Arbeitszeugnis wieder weniger ausschlaggebend für die Besetzung einer Stelle.
In der vorliegenden Arbeit soll es hauptsächlich um die Untersuchung von Aufbau und Sprache von Arbeitszeugnissen gehen. Zuerst erfolgt eine Darstellung wichtiger Grundlagen der Zeugnispraxis, unter anderem, wer Anspruch auf ein Arbeitszeugnis erheben kann und welche Zeugnisarten unterschieden werden. Dadurch soll ein Eindruck davon gemacht werden, auf wie viele Dinge der Zeugnisaussteller in der Praxis achten muss und wie viele Gesetze und Paragraphen tatsächlich herangezogen werden, um ein rein sprachliches Phänomen zu beschreiben, zu erklären und zu legitimieren. Anschließend soll das Zeugnis als Ganzes sowie in seinen einzelnen Bestandteilen abgehandelt werden. Aufbau und Inhalt des Zeugnisses und seiner Elemente werden beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf den sprachlichen Merkmalen und Interpretationsmöglichkeiten bestimmter Formulierungen liegt. Damit soll auf die Problematik in der Produktion und Rezeption von Arbeitszeugnissen hingewiesen werden, denn zur richtigen Formulierung und Auslegung ist ein spezielles Fachwissen erforderlich, welches praktisch noch längst nicht überall vorhanden ist, wo es von Nöten wäre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeugnisberechtigte und wichtige Rechtsgrundlagen
- Grundlegende Unterscheidung verschiedener Zeugnisarten
- Allgemeine Vorraussetzungen und Merkmale
- Inhalt, Aufbau und Form des Arbeitszeugnisses
- Die Einleitung
- Die Tätigkeitsbeschreibung
- Die Leistungsbeurteilung
- Das Führungsverhalten
- Die Schlussformulierung
- Der so genannte Geheimcode
- Neue Zeugnisform
- Probleme in der Arbeitszeugnispraxis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse von Aufbau und Sprache von Arbeitszeugnissen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Besonderheiten dieser Fachtextsorte zu gewinnen, insbesondere im Hinblick auf die sprachlichen Merkmale und Interpretationsmöglichkeiten bestimmter Formulierungen.
- Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Bezug auf Arbeitszeugnisse
- Unterscheidung und Analyse verschiedener Zeugnisarten
- Die sprachlichen Besonderheiten und Interpretationsmöglichkeiten von Formulierungen in Arbeitszeugnissen
- Die Rolle des Arbeitszeugnisses im Bewerbungsprozess
- Die Herausforderungen und Probleme in der Praxis der Arbeitszeugniserstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Arbeitszeugnisses im Kontext der Arbeitsmarktsituation dar und erläutert den Fokus der Arbeit auf Aufbau und Sprache von Arbeitszeugnissen. Im zweiten Kapitel werden die Rechtsgrundlagen und die Personenkreise behandelt, die Anspruch auf ein Arbeitszeugnis haben.
Das dritte Kapitel widmet sich der Unterscheidung verschiedener Zeugnisarten. In Kapitel 4 werden allgemeine Voraussetzungen und Merkmale von Arbeitszeugnissen beleuchtet. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die einzelnen Bestandteile des Arbeitszeugnisses, darunter Einleitung, Tätigkeitsbeschreibung, Leistungsbeurteilung, Führungsverhalten und Schlussformulierung. Dabei wird der Schwerpunkt auf sprachlichen Besonderheiten und Interpretationsmöglichkeiten gelegt.
Schlüsselwörter
Arbeitszeugnis, Fachtextsorte, Sprache, Aufbau, Formulierung, Interpretation, Rechtsgrundlagen, Zeugnisarten, Bewerbung, Arbeitsmarkt, Leistungsbeurteilung, Führungsverhalten, Geheimcode, Problematik, Praxis.
- Quote paper
- Christina Kühn (Author), 2005, Die Fachtextsorte Arbeitszeugnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63954