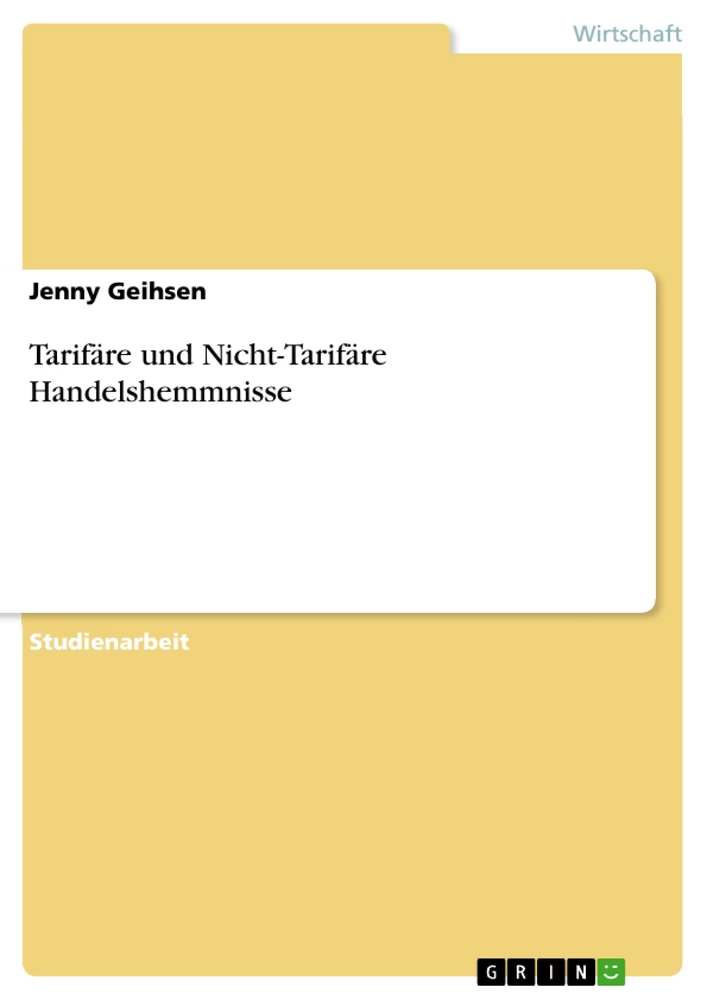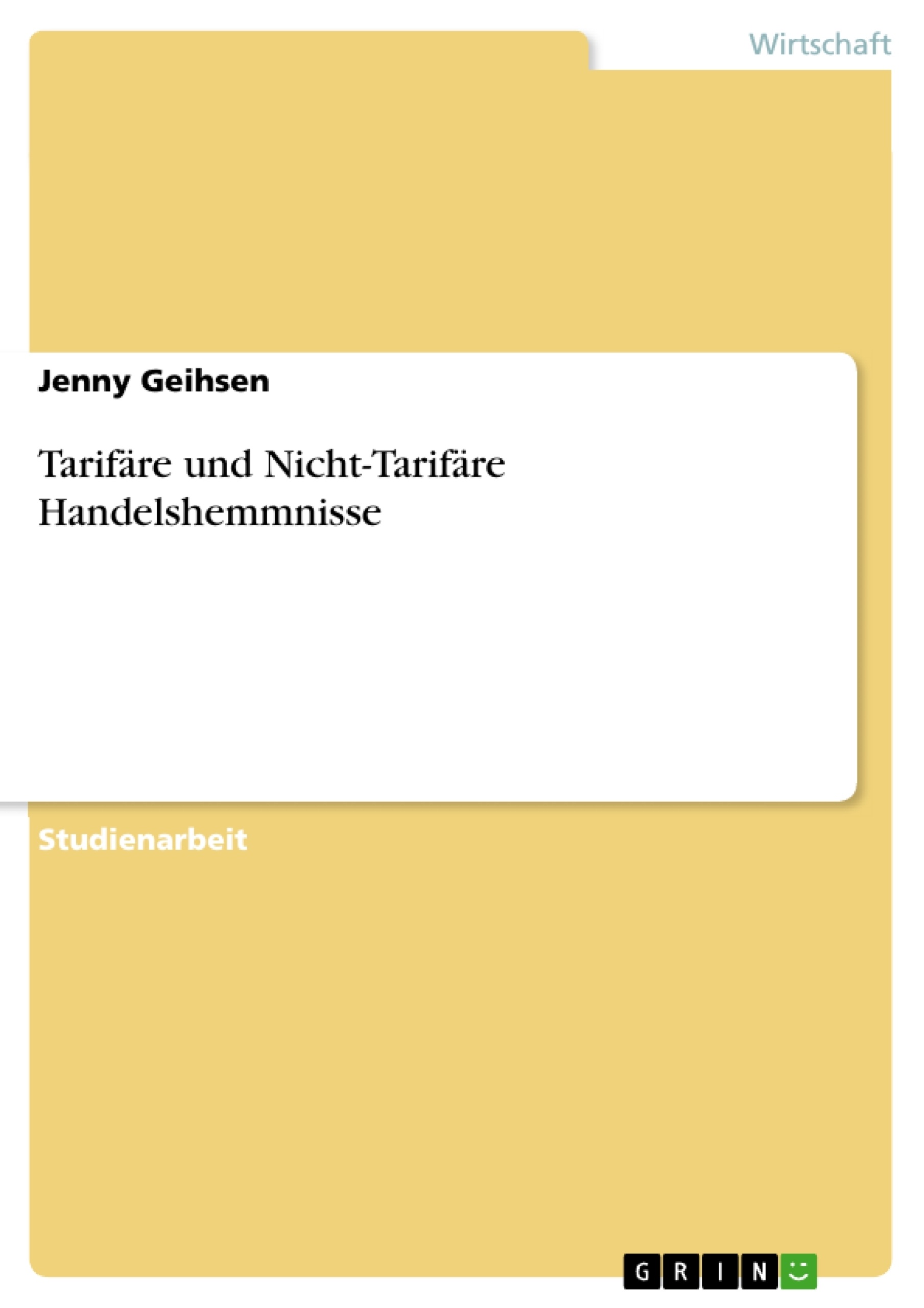Nach erfolgreichem Abschluss der Uruguay-Runde des GATT nahm die neue Welthandelsorganisation (WTO) zum 1. Januar 1995 ihre Arbeit auf. Unter dem Dach der WTO - eine internationale Organisation mit eigner Rechtsprechung - wurden sämtliche Abkommen der Uruguay-Runde sowie der bis zu diesen Zeitpunkt nur provisorisch angewendete GATT-Vertrag zusammengefasst. Dieser Abschluss wurde auch als „Meilenstein in der Handelspoltik“ bezeichnet.
Das Ziel des Vertragswerkes des GATT ist die Liberalisierung des internationalen Handelsverkehrs. Die Aufgaben bestehen darin, Handelshemmnisse zu beschränken und protektionistische Eingriffe in den Wettbewerb entgegen zuwirken, um somit die Erhöhung des Lebensstandards, Vollbeschäftigung, Steigerung bzw. Erhaltung des Realeinkommensniveaus, die optimale Erschließung der Weltressourcen sowie die Steigerung der Produktion und des Austauschs von Gütern zu erreichen. Die Begründung des Strebens nach internationalem Freihandel liegt in der Effizienzgewinnung aller am Tauschprozess beteiligten Parteien. Dieses globale Bestreben tritt oft mit den nationalen Interessen in Konflikt. Um die eigene Wohlfahrt überproportional zu steigern bzw. zu erhalten, werden staatliche Maßnahmen tarifäre und nichttarifärer Art implementiert, sodass die nationalen Interessen durchgesetzt werden können.
Jedoch wächst in Zeiten einer schwachen Konjunktur, hoher Arbeitslosigkeit und der stetig wachsenden Globalisierung der Wunsch in vielen Staaten, die eigene Volkswirtschaft durch Einsatz protektionistischer Maßnahmen zu schützen. Beim Einsatz protektionistischer Maßnahmen durch Staaten wird in der Regel von so genannten „nicht-tarifären Handelshemmnissen“ gesprochen. Allerdings ist es aus wirtschaftlicher und rechts-wissenschaftlicher Sicht schwierig zu bestimmen was nicht-tarifäre Handelshemmnisse sind und diese als solche zu erfassen.7
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Die Bedeutung von Handelshemmnissen für die Wirtschaft
- 2.1 Tarifäre Handelshemmnisse
- 2.2 Nicht-tarifäre Handelshemmnisse
- 3 Fallbeispiele der Zielkonflikte
- 3.1 Die Schuhbranche wehrt sich gegen Importzölle
- 3.2 Der Umgang mit der Gentechnik spaltet die Handelspartner
- 4 Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse und deren Bedeutung für die Wirtschaft. Sie beleuchtet den Konflikt zwischen dem Ziel der internationalen Handelsliberalisierung und den nationalen Interessen, die oft protektionistische Maßnahmen erfordern. Die Arbeit analysiert die Definition und Abgrenzung dieser beiden Arten von Handelshemmnissen anhand von Praxisbeispielen.
- Definition und Abgrenzung tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse
- Bedeutung von Handelshemmnissen für die Wirtschaft
- Zielkonflikte zwischen nationaler und internationaler Handelspolitik
- Analyse von Fallbeispielen aus der Schuhbranche und dem Bereich Gentechnik
- Auswirkungen protektionistischer Maßnahmen auf die globale Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Handelsliberalisierung im Kontext der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) ein. Sie beschreibt das Ziel des GATT-Vertrags, Handelshemmnisse zu reduzieren und den internationalen Handel zu liberalisieren. Gleichzeitig wird der Konflikt zwischen diesem globalen Ziel und den nationalen Interessen hervorgehoben, die oft protektionistische Maßnahmen rechtfertigen. Die Einleitung legt den Grundstein für die Untersuchung der tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft, wobei die Schwierigkeit, nicht-tarifäre Handelshemmnisse zu definieren und zu erfassen, betont wird. Der Gang der Untersuchung wird kurz skizziert.
2 Die Bedeutung von Handelshemmnissen für die Wirtschaft: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftliche Bedeutung von Handelshemmnissen. Es differenziert zwischen tarifären Handelshemmnissen (z.B. Zölle) und nicht-tarifären Handelshemmnissen (z.B. technische Handelshemmnisse, Subventionen). Es werden die Auswirkungen beider Formen auf den internationalen Handel und die beteiligten Volkswirtschaften erörtert, wobei die komplexen Wechselwirkungen und die oft schwer messbaren Folgen im Detail beleuchtet werden. Das Kapitel legt den Fokus auf die verschiedenen Arten von Handelshemmnissen und die Motive für deren Anwendung durch einzelne Staaten, um die eigenen Interessen zu schützen.
3 Fallbeispiele der Zielkonflikte: Dieses Kapitel präsentiert zwei Fallbeispiele, die den Zielkonflikt zwischen nationaler und internationaler Handelspolitik veranschaulichen. Das erste Beispiel befasst sich mit der Schuhbranche und der Verteidigung gegen Importzölle, während das zweite Beispiel den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und die daraus resultierenden Konflikte zwischen Handelspartnern beschreibt. Die Beispiele dienen der Veranschaulichung der komplexen Zusammenhänge und der unterschiedlichen Interessenlagen der beteiligten Akteure. Die Fallbeispiele zeigen konkrete Auswirkungen von Handelshemmnissen auf die betroffenen Industrien und die damit verbundenen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Tarifäre Handelshemmnisse, nicht-tarifäre Handelshemmnisse, WTO, GATT, Handelsliberalisierung, Protektionismus, nationale Interessen, internationale Handelspolitik, Zielkonflikt, Fallbeispiele, Schuhbranche, Gentechnik, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Seminararbeit: Tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse und deren Bedeutung für die Wirtschaft. Sie beleuchtet den Konflikt zwischen internationaler Handelsliberalisierung und nationalen Interessen, die oft protektionistische Maßnahmen erfordern. Die Arbeit analysiert die Definition und Abgrenzung dieser beiden Arten von Handelshemmnissen anhand von Praxisbeispielen aus der Schuhbranche und dem Bereich Gentechnik.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse, deren wirtschaftliche Bedeutung, Zielkonflikte zwischen nationaler und internationaler Handelspolitik, Auswirkungen protektionistischer Maßnahmen auf die globale Wirtschaft sowie die Analyse konkreter Fallbeispiele.
Welche Arten von Handelshemmnissen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen tarifären Handelshemmnissen (z.B. Zölle) und nicht-tarifären Handelshemmnissen (z.B. technische Handelshemmnisse, Subventionen). Es werden die Auswirkungen beider Formen auf den internationalen Handel und die beteiligten Volkswirtschaften erörtert.
Welche Fallbeispiele werden in der Seminararbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Fallbeispiele: den Konflikt der Schuhbranche mit Importzöllen und die Herausforderungen im Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und den daraus resultierenden Konflikten zwischen Handelspartnern. Diese Beispiele veranschaulichen den Zielkonflikt zwischen nationaler und internationaler Handelspolitik.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Bedeutung von Handelshemmnissen für die Wirtschaft, ein Kapitel mit Fallbeispielen und ein Fazit/Ausblick. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Gang der Untersuchung. Die Kapitel analysieren die verschiedenen Arten von Handelshemmnissen und deren Auswirkungen. Die Fallbeispiele veranschaulichen die komplexen Zusammenhänge und die unterschiedlichen Interessenlagen der beteiligten Akteure.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Tarifäre Handelshemmnisse, nicht-tarifäre Handelshemmnisse, WTO, GATT, Handelsliberalisierung, Protektionismus, nationale Interessen, internationale Handelspolitik, Zielkonflikt, Fallbeispiele, Schuhbranche, Gentechnik, Globalisierung.
Welche Organisationen werden in der Seminararbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt die Welthandelsorganisation (WTO) und den Allgemeinen Zoll- und Handelsvertrag (GATT) im Kontext der Handelsliberalisierung und der Bemühungen, Handelshemmnisse zu reduzieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Das Fazit/der Ausblick der Seminararbeit wird im Text nicht explizit dargestellt. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Schlussfolgerungen sich auf die komplexen Wechselwirkungen zwischen nationaler und internationaler Handelspolitik, die Herausforderungen der Handelsliberalisierung und die Bedeutung der Berücksichtigung nationaler Interessen bei der Gestaltung internationaler Handelsabkommen beziehen.
- Quote paper
- Jenny Geihsen (Author), 2006, Tarifäre und Nicht-Tarifäre Handelshemmnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63699