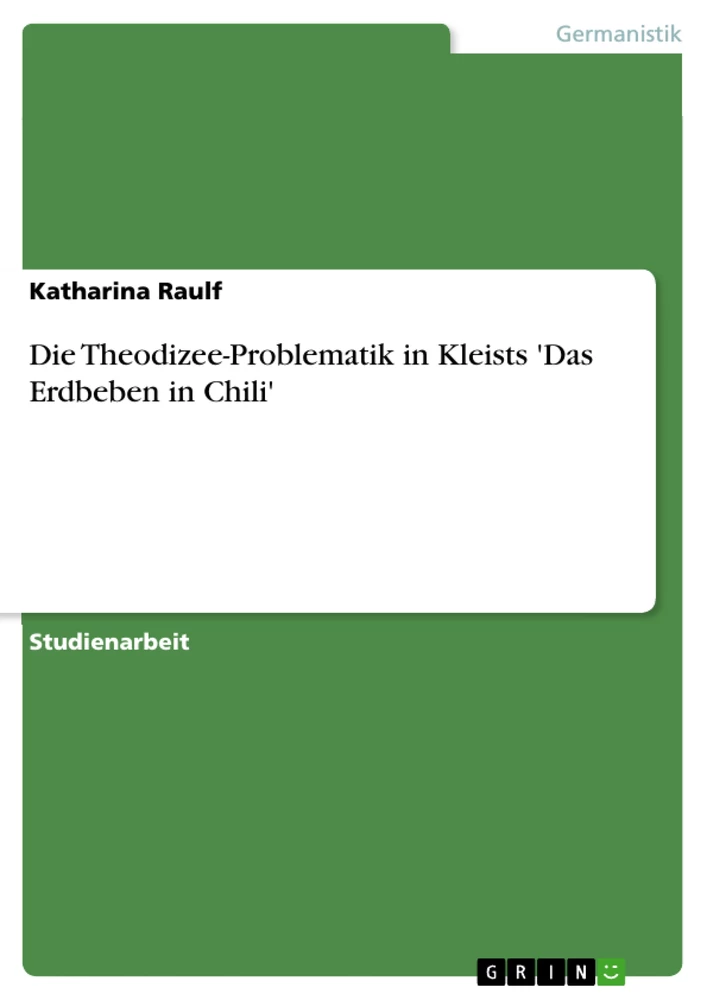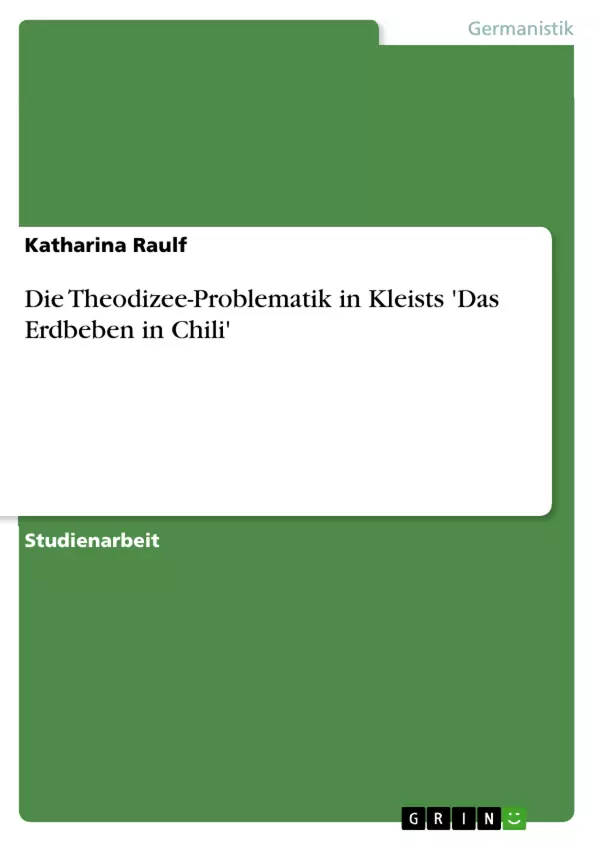Vordergründig ist ein Erbeben ein Phänomen der Natur, dass frei von jeder Wertung und in seinem Wesen völlig neutral ist. Zur Katastrophe wird es erst von den Menschen gemacht, die mit den Folgen und gesellschaftlichen Phänomenen umgehen müssen, die das Erdbeben mit sich bringt.
Heinrich von Kleist beschäftigt sich in seiner Novelle „Das Erdbeben in Chili“ genau mit diesen menschlichen Problemen nach einem Erdbeben. Hierbei gilt es zu beachten, dass der zeitgenössische Leser damit nicht das tatsächliche stattgefundene Erdbeben von Chile im Jahre 1647 assoziiert, sondern das wesentlich verheerendere Ereignis von Lissabon aus dem Jahre 1755. Dies löste eine Diskussion um die vorherrschende Gottesanschauung und die Herkunft des Bösen aus, an der sich unter anderem Leibniz, Rousseau, Voltaire und auch Kant beteiligten. Kleist konstruierte in seiner Novelle eine ganz eigene Lösung des Theodizeeproblems indem er verschiedene Argumente der Debatte verarbeitete.
In dieser Arbeit soll Kleists Variante zur Erklärung der Theodizee bearbeitet werden. Diese Thematik ist wohl die meist erforschte in der Sekundärliteratur zu Kleists Das Erdbeben in Chili. Die Sammlung der verschiedenen Analysemodelle von David E. Wellbery bietet eine gute Grundlage zur Erschließung des Textes, als auch zur detaillierten Interpretation. Besonders der Ansatz von Karlheinz Stierle lieferte fundierte Informationen zur eher textimmanenten Analyse, die sich hauptsächlich auch auf den Primärtext bezieht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung zum Thema
- Die Theodizee-Problematik in Kleists Das Erdbeben in Chili
- Zwischen Einheit und Polarität
- Kleists Weltsystem
- Der Glücksbegriff
- Der Schicksalsbegriff
- Das Menschenbild
- Schicksal oder Zufall
- Christliche und menschliche Werte
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Theodizee-Problematik in Heinrich von Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“. Es soll untersucht werden, wie Kleist in seinem Werk die Frage nach dem Ursprung des Bösen und der Rolle Gottes in der Welt behandelt.
- Die Darstellung der Welt als ein Ort der Polarität
- Die Rolle des Zufalls und des Schicksals
- Das Verhältnis von christlichen und menschlichen Werten
- Kleists Interpretation der Theodizee
- Die Bedeutung der Sprache und des Erzählstils
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung zum Thema
Die Einleitung führt in die Thematik des Erdbebens als Naturkatastrophe und den menschlichen Umgang mit dessen Folgen ein. Sie stellt Heinrich von Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“ vor und beleuchtet den zeitgenössischen Kontext des Lissabonner Erdbebens von 1755, das eine breite Debatte über die Theodizee auslöste. Die Arbeit fokussiert auf Kleists eigene Lösung des Theodizee-Problems.
Die Theodizee-Problematik in Kleists Das Erdbeben in Chili
Zwischen Einheit und Polarität
Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Gegensatzpaaren in Kleists Erzählweise und zeigt, wie er das irdische Dasein als ein Leben in Polarität darstellt. Die Handlung wird in drei Abschnitte geteilt: Weltuntergangstimmung nach dem Erdbeben, paradiesische Verhältnisse der Überlebenden und die finale Katastrophe der Hinrichtung der vermeintlichen Schuldigen. Auch der Erzählstil zeigt diese Polarität: Von einer kühlen und neutralen Betrachtungsweise zu Beginn wechselt er zu einem poetischen Stil, der die Situation bewertet.
Kleists Weltsystem
Dieses Kapitel befasst sich mit Kleists Sicht auf die Welt und ihren Werten. Es analysiert den Glücks- und Schicksalsbegriff in der Novelle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theodizee-Problematik?
Die Theodizee-Frage untersucht, wie ein gütiger und allmächtiger Gott das Leid und das Böse in der Welt zulassen kann.
Welchen historischen Hintergrund hat Kleists Novelle?
Obwohl sie in Chile 1647 spielt, assoziierten zeitgenössische Leser sie mit dem verheerenden Erdbeben von Lissabon 1755, das eine europaweite Debatte über Gottes Gerechtigkeit auslöste.
Wie stellt Kleist das Erdbeben dar?
Das Erdbeben selbst wird als neutrales Naturphänomen dargestellt. Erst das menschliche Verhalten danach – von paradiesischer Verbrüderung bis hin zu fanatischem Hass – macht es zur moralischen Katastrophe.
Welche Rolle spielt der Zufall in der Novelle?
Zufall und Schicksal sind zentrale Elemente. Das Erdbeben rettet die Protagonisten zufällig vor dem Tod, führt sie aber letztlich in eine Situation, in der sie der menschlichen Grausamkeit zum Opfer fallen.
Was bedeutet die "Polarität" in Kleists Erzählstil?
Kleist nutzt Kontraste: Die Weltuntergangsstimmung wechselt zu paradiesischen Zuständen im Grünen und endet in der grausamen Hinrichtung der Liebenden im Tempel.
- Quote paper
- Katharina Raulf (Author), 2005, Die Theodizee-Problematik in Kleists 'Das Erdbeben in Chili', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63653