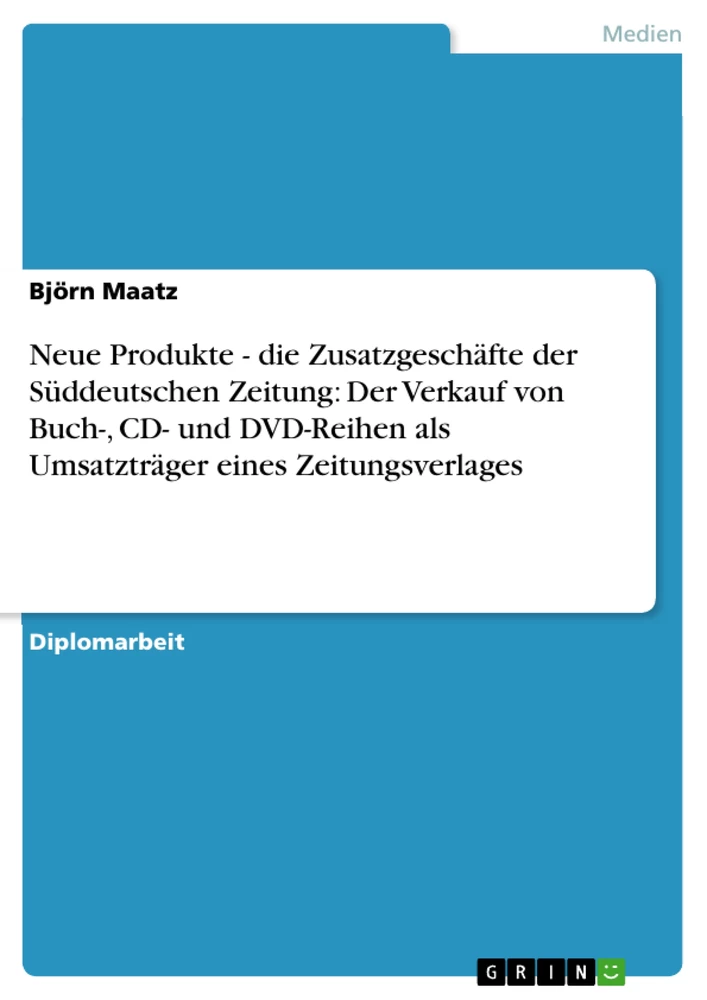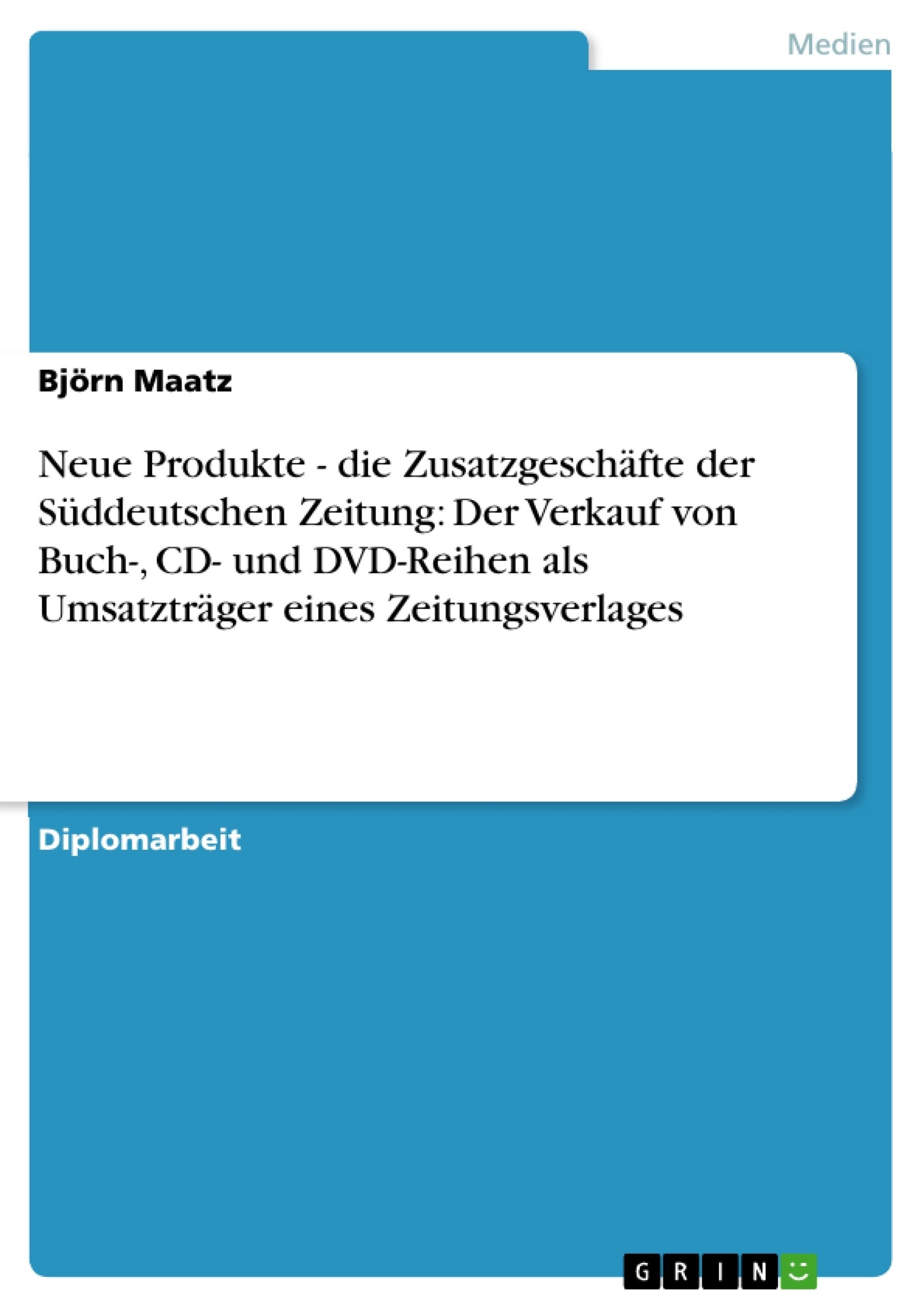Die deutschen Zeitungsverlage befinden sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts in der schwersten Krise der Nachkriegsgeschichte. Das zur Jahrtausendwende sich seinen Weg bahnende Medium Internet hat den Verlagen langfristig Rubrikenanzeigen und Werbeeinnahmen abgenommen. Die Verlage reagierten zunächst hilflos mit umfassenden Kostensenkungsmaßnahmen. Erst allmählich stellte sich die Erkenntnis ein, dass sie sich neue Geschäftsfelder erschließen müssen.
Ähnlich wie der Tankstellenpächter, der mittlerweile den überwiegenden Teil seines Einkommens mit dem Shopgeschäft und nicht mehr mit dem verkauften Benzin erlöst, müssen die Zeitungsverlage langfristig Zusatzeinnahmen neben ihrem Kerngeschäft erzielen. Die Süddeutsche Zeitung (SZ) hat einen Weg gefunden, um sich für die kommenden Jahre vom volatilen Anzeigengeschäft unabhängiger zu machen. Anfang 2004 brachte sie 50 Belletristik-Bände unter dem Namen „Süddeutsche Zeitung Bibliothek“ heraus, der Auftakt zu einem umsatzträchtigen Nebengeschäft mit der einfachen Bezeichnung „Neue Produkte“.
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht das Zusatzgeschäft der Süddeutschen Zeitung aus medienökonomischer Perspektive und belegt die zentrale These, dass es zum mittelfristigen finanziellen Überleben der SZ zwingend notwendig und sinnvoll ist, auf lange Sicht in dieser Form jedoch keine Zukunft hat. Das Thema der Arbeit ist ein Beitrag zur aktuellen Diskussion, wie sich Zeitungsverlage zukünftig ihr Kernprodukt Zeitung noch leisten können. Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte.
Im ersten Schritt zeigt sie Ursachen für die allgemeine Medienkrise nach den Boomjahren 1999 und 2000 auf und dokumentiert, dass sich die Medienbranche in den Anfangsjahren des neuen Jahrtausends nicht nur in einer konjunkturellen Tiefphase befand, sondern auch am Beginn einer strukturellen Krise stand, die sich in einem dramatischen Rückgang der Rubrikenanzeigen und Werbeeinnahmen äußerte. Die Diplomarbeit beleuchtet weiterhin die ausbleibenden Wachstumsperspektiven in einem gesättigten Zeitungsmarkt, der die Verleger zum ausdrücklichen Handeln zwang. Sie belegt, dass die anfängliche Defensivstrategie der Verleger im Internet den Tageszeitungen einen so schlechten Start ins Online-Geschäft bescherte, dass es ihnen bis heute kaum zusätzliche Erlöse einbrachte. Die Verleger wussten sich nur mit Kosteneinsparungen zu helfen, die im letzten Teil der allgemeinen Einführung beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medienwirtschaft im Wandel
- Boom zur Jahrtausendwende
- Beginn der Medienkrise: Internet vs. Print
- Ursachen der Medienkrise
- Lahmende Konjunktur
- Strukturelle Verschiebungen
- Einbruch der Rubrikenanzeigen
- Rückgang der Werbeeinnahmen
- Defensivstrategie im Internet
- Kostenreduktionsmaßnahmen als Reaktion auf die Medienkrise
- Zwischenfazit: Neues Selbstverständnis der Verlage
- Süddeutsche Zeitung: ein liberal-kritisches Medium
- SZ zur Jahrtausendwende: dem Boom folgt die Krise
- Sackgasse Kerngeschäft
- Paid Content als profitirrelevante Erlösquelle
- Bestandsaufnahme: Suche nach Innovationen
- Brand Extension: Transfer der Marke SZ
- Querfinanzierung durch Zusatzgeschäfte: Neue Produkte
- Informationsinteresse an Büchern
- Vorbilder im europäischen Ausland
- Spanien
- Italien
- Weitere Länder
- Entwicklung zielgruppenspezifischer Produkte
- Lizenznahme und Buchpreisbindung
- Werbestrategien für die Neuen Produkte der SZ
- Vertrieb der Neuen Produkte der SZ
- Die Neuen Produkte der SZ als mediales Gesamtkonzept
- SZ-Bibliothek
- SZ-Cinemathek
- SZ-Diskothek
- SZ-Junge Bibliothek
- SZ-WM-Bibliothek
- SZ-Kriminalbibliothek
- Weitere Projekte
- Auswirkungen der Zusatzgeschäfte nach innen
- Zusatzerlöse durch Cross-Selling
- Steigerung der Leser-Blatt-Bindung
- Stärkung und Profilierung des Images und der Marke
- Etablierung neuer Vertriebswege
- Erhöhung der Reichweite
- Gewinnung von Neuabonnenten
- Rekursive Stärkung der Online-Aktivität
- Gefahr der Markenüberdehnung
- Journalistische Ethik: Eigenwerbung im redaktionellen Teil
- Eigenanzeigen „Corriere della sera“
- Eigenanzeigen „La Repubblica“
- Auswirkungen der Zusatzgeschäfte nach außen
- Reaktionen der Mitbewerber
- Bild: leichte Unterhaltung und Comics
- Die Zeit: Lexika, Kulturgeschichte und Kinderbücher
- FAZ: Naturfilme, Fußball-Dokumentationen und Comicbücher
- Reaktionen der Buchverlage
- Die Gefahr der Billigbuchoffensive für Buchverlage
- Die Chance der Billigbuchoffensive für Buchverlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Zusatzgeschäft der Süddeutschen Zeitung aus medienökonomischer Perspektive. Ziel ist es, zu belegen, dass dieses Geschäft zum mittelfristigen finanziellen Überleben der SZ notwendig und sinnvoll ist, auf lange Sicht aber keine Zukunft hat. Die Arbeit trägt zur aktuellen Diskussion bei, wie sich Zeitungsverlage zukünftig ihr Kernprodukt Zeitung noch leisten können.
- Die Ursachen der Medienkrise im frühen 21. Jahrhundert
- Die Herausforderungen für Zeitungsverlage in einem gesättigten Markt und im Kontext des Internets
- Die Strategie der Süddeutschen Zeitung zur Diversifizierung und Querfinanzierung durch Zusatzgeschäfte
- Die Auswirkungen dieser Zusatzgeschäfte auf die SZ, den Medienmarkt und die Buchbranche
- Die Frage, ob Zusatzgeschäfte eine nachhaltige Lösung für die Zukunft von Zeitungsverlagen darstellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Medienkrise im frühen 21. Jahrhundert dar und zeigt, wie sich Zeitungsverlage neue Geschäftsfelder erschließen müssen. Die Süddeutsche Zeitung (SZ) wird als Beispiel für eine Zeitung vorgestellt, die durch Zusatzgeschäfte wie die „Süddeutsche Zeitung Bibliothek“ versucht, sich vom volatilen Anzeigengeschäft unabhängiger zu machen. Die Arbeit gliedert sich in vier Abschnitte.
- Medienwirtschaft im Wandel: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursachen der Medienkrise, darunter die lahme Konjunktur, strukturelle Verschiebungen (z. B. Rückgang der Rubrikenanzeigen und Werbeeinnahmen) und die Herausforderungen durch das Internet. Es zeigt die Defensivstrategie der Verlage im Internet und die Notwendigkeit von Kostensenkungsmaßnahmen auf.
- Süddeutsche Zeitung: ein liberal-kritisches Medium: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der SZ zur Jahrtausendwende und ihrem Weg vom Medienboom in die Krise. Es analysiert die gescheiterten intermedialen Strategien der SZ und die Möglichkeiten der Querfinanzierung durch Diversifikation sowie Chancen des Markentransfers, die zu den „Neuen Produkten“ führten.
- Auswirkungen der Zusatzgeschäfte nach innen: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Zusatzgeschäfte auf die SZ, beispielsweise hinsichtlich der Steigerung der Leser-Blatt-Bindung, der Stärkung des Images und der Marke sowie der Gewinnung von Neuabonnenten. Es beleuchtet aber auch die Risiken für die Marke und die journalistische Ethik.
- Auswirkungen der Zusatzgeschäfte nach außen: Dieses Kapitel analysiert die Reaktionen der Mitbewerber auf die Zusatzgeschäfte der SZ und diskutiert die ambivalente Haltung der Buchverlage und -händler. Es untersucht die Chancen und Gefahren der Billigbuchoffensive für die Buchbranche.
Schlüsselwörter
Medienkrise, Zeitungsverlage, Zusatzgeschäfte, Süddeutsche Zeitung, Querfinanzierung, Brand Extension, Leser-Blatt-Bindung, Image, Marke, Journalistische Ethik, Medienmarkt, Buchbranche, Billigbuchoffensive.
- Quote paper
- Björn Maatz (Author), 2006, Neue Produkte - die Zusatzgeschäfte der Süddeutschen Zeitung: Der Verkauf von Buch-, CD- und DVD-Reihen als Umsatzträger eines Zeitungsverlages, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63458