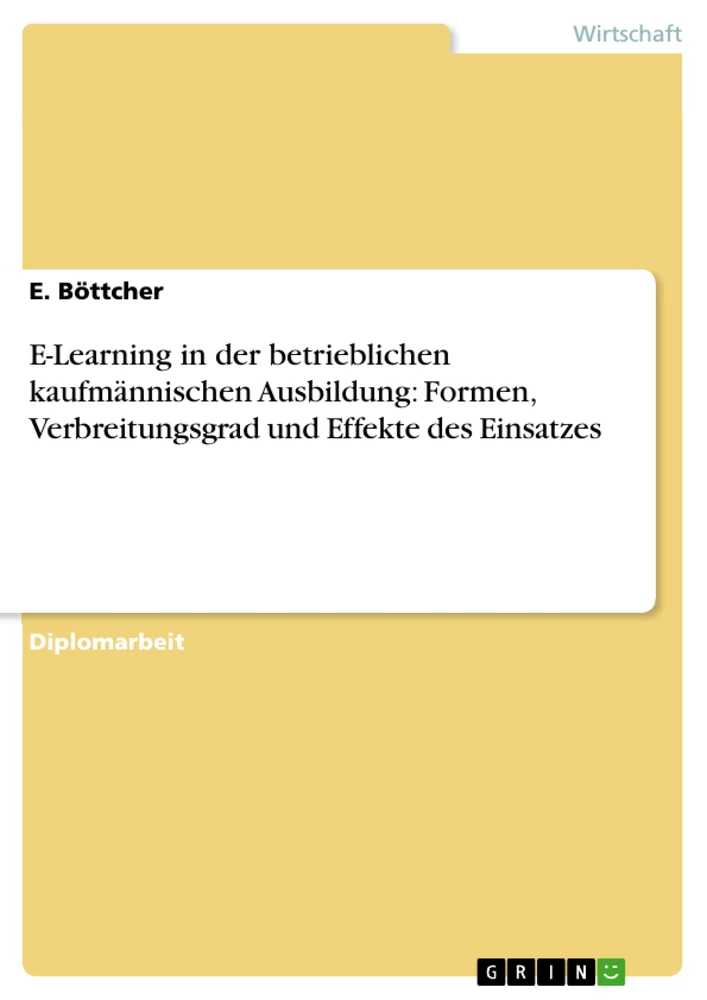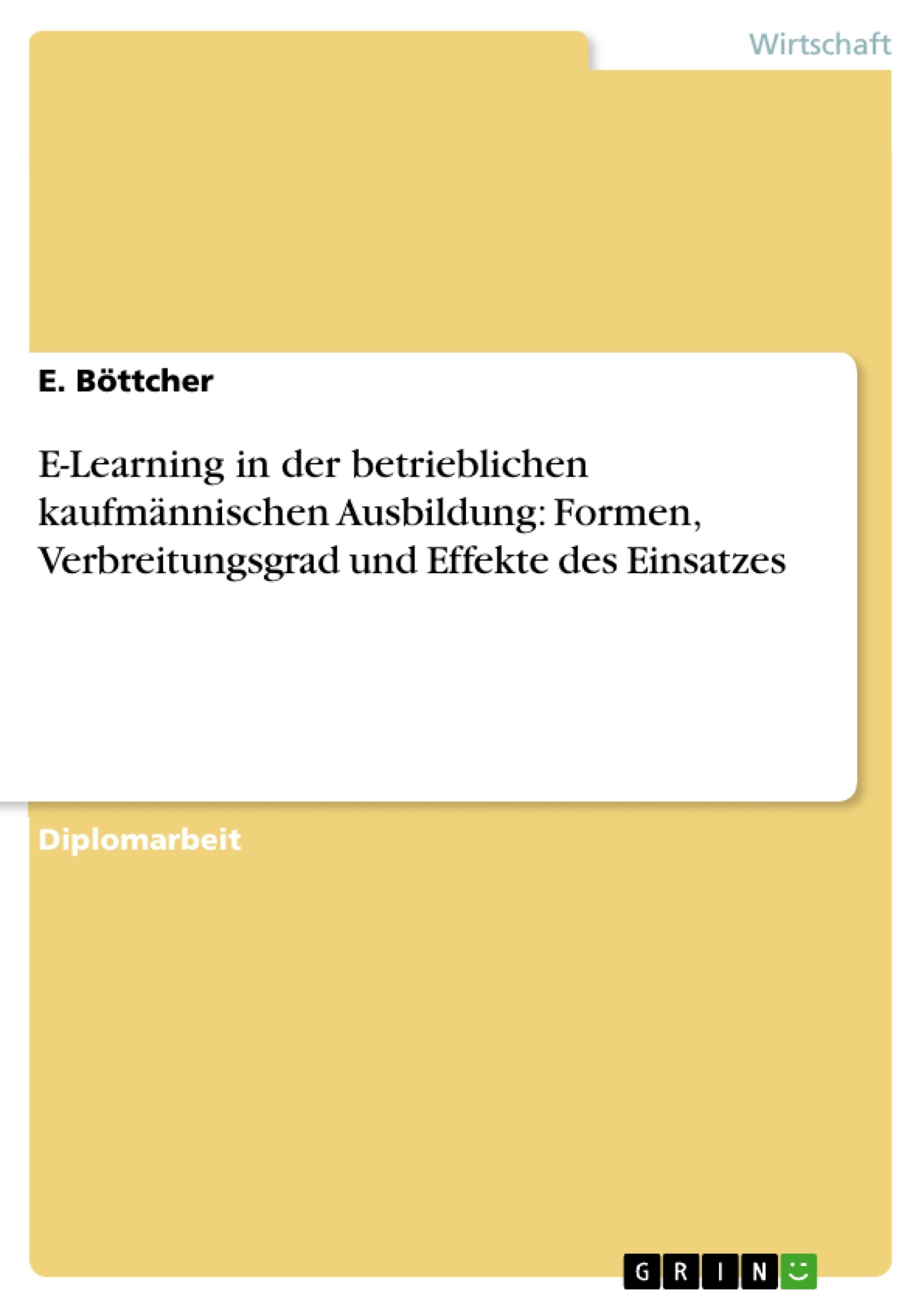Der durch die Globalisierung bedingte Druck auf der Produkt- oder Angebotsseite, möglichst innovativ zu sein, verändert die Anforderungen an die Mitarbeiter ernorm. Um Veränderungen nicht nur hinterherzulaufen, sondern diese aktiv mitgestalten zu können, ist eine extrem schnelle Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiter gefragt. So müssen sich Mitarbeiter auf neue Situationen einstellen, was vor allem bedeutet, dass sie in der Lage sein müssen, sich neue Themengebiete selbstständig zu erschließen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie in der Lage sind selbst gesteuert4 zu lernen. Dies wird im späteren Berufsleben erleichtert, wenn der Mitarbeiter bereits über entsprechende Kenntnisse des selbst gesteuerten Lernens verfügt. Das kann erreicht werden, indem bereits im Rahmen der betrieblichen kaufmännischen Erstausbildung Lernumgebungen geschaffen werden, die ein zunehmend aktives selbstgesteuertes Lernen evozieren. Eine Beschränkung der (Erst)ausbildung auf das alleinige Erlernen von Faktenwissen innerhalb eines bestimmten Fachbereiches reicht daher – insbesondere vor dem Hintergrund der stetigen Weiterentwicklung betrieblicher Abläufe – nicht aus. Betrachtet man die betriebliche Ausbildung, so ist jedoch – auch im kaufmännischen Bereich – weithin festzustellen, dass eher sehr traditionell verfahren wird. So findet die Vermittlung des Wissens weiterhin ausbilderzentriert, zum Beispiel im Rahmen eines Vortrages innerhalb des innerbetrieblichen Unterrichts oder im Rahmen der Drei-Stufen-Methode, statt. Selbst gesteuertes Lernen nimmt nach traditionellen Lehrmethoden keinen großen Stellenwert innerhalb der betrieblichen kaufmännischen Ausbildung ein. Es stellt sich daher die Frage, mit welchen Lehr-/Lern-Settings selbst gesteuertes Lernen evoziert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zum Aufbau der Arbeit
- 2. Zur Funktion des Lernorts,,Betrieb❝
- 3. Zur Definition des Begriffs E-Learning
- 4. Zu den Formen des E-Learning
- 4.1.Kriterien zur Charakterisierung der E-Learning-Formen
- 4.2.Computer-Based-Training
- 4.2.1. Drill & Practice-Programme
- 4.2.2. Tutorielle Programme
- 4.2.3. Intelligente tutorielle Systeme
- 4.2.4. Hypertext- und Hypermedia-Informationssysteme
- 4.2.5. Simulationen
- 4.2.6. Elektronische Lernspiele
- 4.3.Web-Based-Training
- 4.3.1. Aus dem Inter-/Intranet ausführbare Computer Based Trainings
- 4.3.2. Webquests
- 4.3.3. Wikis
- 4.3.4. Weblogs
- 4.3.5. Fernplanspiele
- 4.4.Lernplattformen (E-Training)
- 4.5.Die Mischform „,Blended Learning“
- 5. Zur Verbreitung von E-Learning in der betrieblichen kaufmännischen Ausbildung
- 6. Zu den Effekten des E-Learning-Einsatzes in der betrieblichen kaufmännischen Ausbildung
- 6.1. Zur Konsistenz und Aktualität der Lehrinhalte
- 6.2. Zur Speicherung des Wissens im kognitiven Apparat
- 6.3. Zur Effizienz des Lernens
- 6.4. Zur Motivation des Lernenden
- 6.5. Zur Förderung der beruflichen Handlungskompetenz
- 6.6. Zu den ökonomischen Potentialen
- 6.7. Zum selbstgesteuertem Lernen
- 7. Zusammenfassung und Forschungsdesiderate
- III. Literaturverzeichnis
- IV. Anlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Rolle des E-Learnings in der betrieblichen kaufmännischen Ausbildung. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Formen von E-Learning, dem Verbreitungsgrad in der Praxis sowie den möglichen Auswirkungen auf den Lernerfolg und die betriebliche Effizienz.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs E-Learning
- Analyse der verschiedenen Formen des E-Learnings, z.B. Computer-Based-Training, Web-Based-Training, Blended Learning
- Empirische Untersuchung des Verbreitungsgrades von E-Learning in der betrieblichen kaufmännischen Ausbildung
- Bewertung der Effekte des E-Learning-Einsatzes, z.B. Motivationssteigerung, Effizienzsteigerung, Förderung der Handlungskompetenz
- Diskussion des ökonomischen Potenzials und der Herausforderungen des E-Learning-Einsatzes
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Einleitung in die Problemstellung, die den Wandel des wirtschaftlichen Umfelds und die daraus resultierenden Anforderungen an die betriebliche Ausbildung beleuchtet.
- Kapitel 2: Zur Funktion des Lernorts „Betrieb“: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des Betriebs als Lernort und die Bedeutung der betrieblichen Ausbildung.
- Kapitel 3: Zur Definition des Begriffs E-Learning: Definition des Begriffs E-Learning und Abgrenzung zu anderen Formen des Lernens.
- Kapitel 4: Zu den Formen des E-Learning: Darstellung verschiedener Formen des E-Learnings, einschließlich Computer-Based-Training, Web-Based-Training und Blended Learning.
- Kapitel 5: Zur Verbreitung von E-Learning in der betrieblichen kaufmännischen Ausbildung: Analyse des aktuellen Standes des E-Learning-Einsatzes in der betrieblichen Ausbildung anhand von empirischen Studien und Daten.
- Kapitel 6: Zu den Effekten des E-Learning-Einsatzes in der betrieblichen kaufmännischen Ausbildung: Bewertung der Auswirkungen von E-Learning auf den Lernerfolg, die Motivation, die Effizienz und die Handlungskompetenz.
Schlüsselwörter
E-Learning, betriebliche kaufmännische Ausbildung, Formen des E-Learning, Verbreitungsgrad, Effekte des E-Learning, Motivation, Effizienz, Handlungskompetenz, ökonomisches Potential, Forschungsdesiderate.
- Quote paper
- E. Böttcher (Author), 2006, E-Learning in der betrieblichen kaufmännischen Ausbildung: Formen, Verbreitungsgrad und Effekte des Einsatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63399