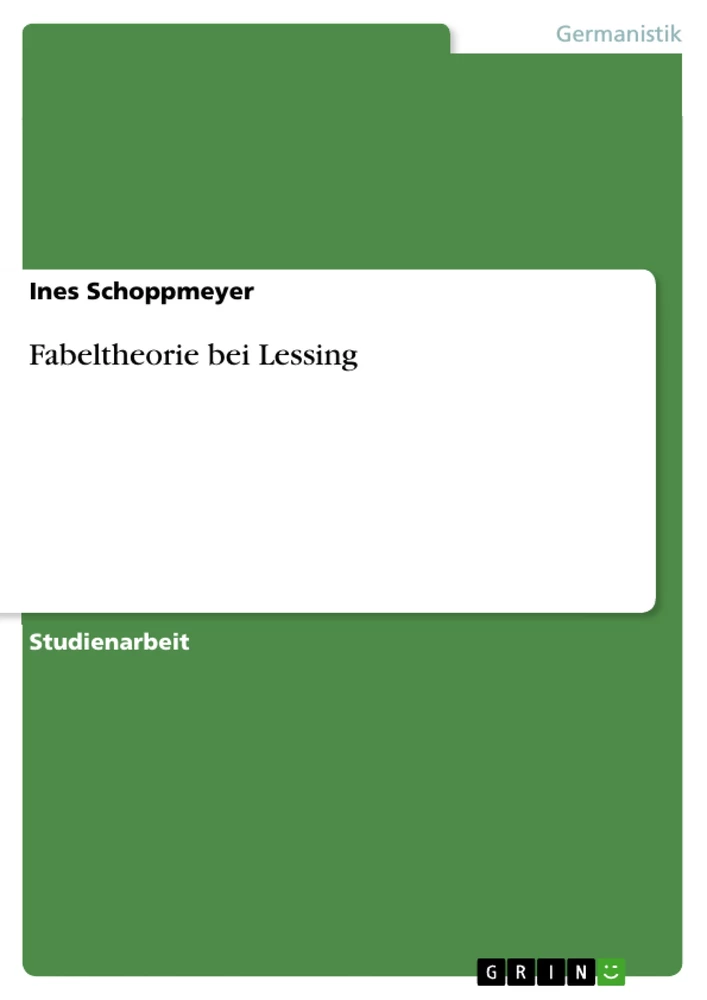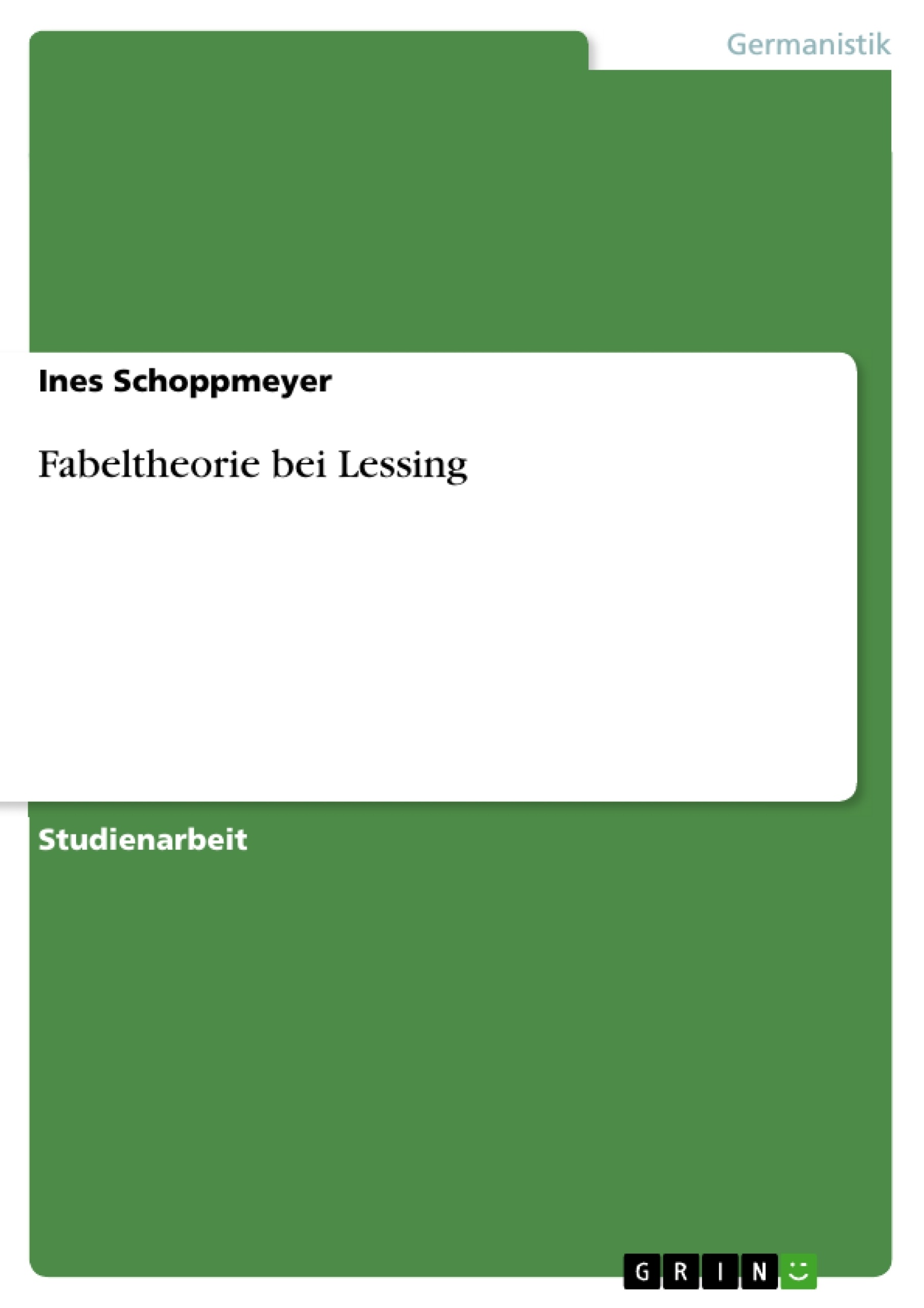Im 18. Jahrhundert war der Begriff Fabel doppeldeutig gebraucht worden. Zum einen bezeichnete man damit die Handlungsstruktur eines erzählenden oder dramatischen Textes. Zum anderen wurde er als Gattungsbegriff genutzt. Unter dem Gattungsbegriff Fabel fielen allgemein erzählende, meist eine pisodische Texte, in denen größtenteils nicht-menschliches Personal agierte, als stünden ihnen die Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins zu. Das Interesse an der Fabel begleitet Gotthold Ephraim Lessing seit seinem Studium 1746-1748 in Leipzig bis in seine letzten Lebensjahre. An der Universität von Leipzig kam es über seinen Dozenten Johann Friedrich Christ zu den ersten Berührungspunkten Lessings mit der Fabel. 1747 wurden Lessings früheste Fabelversuche in Zeitschriften veröffentlicht, bis sie schließlich 1753 im ersten Teil der Schriften gesammelt herausgegeben wurden. Nach seinem Studium des Aesops und Phaedrus übersetzte Lessing Samuel Richardsons Aesop`s fables with reflections intsructive morals unter dem Titel Herrn Samuel Richardsons Sittenlehre für die Jugend in den auserlesensten äsopischen Fabeln ins Deutsche. Schließlich veröffentlichte er 1759 die Kernschrift seiner Fabeltheorie mit dem Werk:Fabeln. Drey Bücher. Nebst Abhandlungen mit dieser Dichtungsart verwandten Inhalts.In den Folgejahren erschienen unter anderem die Publikationen Über die sogenannten Fabeln aus den Zeiten der Minnesängersowie die Untersuchungen des Romulus und Rimicus. Erst nach Lessings Tod im Jahre 1781 wurde die nicht beendete Arbeit Zur Geschichte der Aesopischen Fabel herausgegeben. Aus der knapp skizzierten Geschichte der Beschäftigung Lessings mit der Fabel wird deutlich, in welch vielfältiger Hinsicht er sich mit dieser Gattung beschäftigte. Sein Interesse bezog sich dabei auf poetologische, philosophische, philologische und theoretische Aspekte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Hintergrund
- 2.1 Lessing und die französisch-deutsche Verwaltung des aesopischen Nachlasses
- 2.2 Die Entwicklung der eigenen Fabeltheorie
- 3. Fabeltheorie
- 3.1 Das Grundkonzept der Fabeltheorie
- 4. Exkurs
- 5. Fazit
- 6. Verzeichnis der benutzten Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Lessings Fabeltheorie im Kontext des 18. Jahrhunderts, ihre Entwicklung und ihren Bezug zu zeitgenössischen Strömungen. Sie analysiert Lessings Abkehr vom französischen Vorbild und seine Rückbesinnung auf die antiken Wurzeln der Fabel. Ein weiterer Fokus liegt auf der formtheoretischen Konzeption Lessings und deren Umsetzung in seinen Fabeln.
- Entwicklung von Lessings Fabeltheorie
- Lessings Kritik am französischen Fabelverständnis
- Formtheoretische Überlegungen Lessings zur Fabel
- Vergleich zwischen Lessings Fabel- und Dramentheorie
- Der philosophische Hintergrund der Fabeltheorie Lessings
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die doppeldeutige Verwendung des Begriffs „Fabel“ im 18. Jahrhundert – sowohl als Handlungsstruktur als auch als Gattungsbegriff. Sie skizziert Lessings langjähriges Interesse an der Fabel, beginnend mit seinen Studienjahren bis hin zu seinen späten Werken. Die Einleitung deutet auf die vielfältigen Aspekte von Lessings Beschäftigung mit der Fabel hin – poetologisch, philosophisch, philologisch und theoretisch – und kündigt die zentrale These der Arbeit an: Lessings Fabeltheorie geht über die bloße Wiederbelebung des aesopischen Vorbilds hinaus.
2. Der historische Hintergrund: Dieses Kapitel erörtert den unsicheren Ursprung der Fabel und die Schwierigkeiten, den Typus der aesopischen Fabel historisch nachzuvollziehen. Es beleuchtet die Bedeutung der aesopischen Fabeln im 18. Jahrhundert als Vorbild für die aufklärerische Fabelproduktion und den Zusammenhang mit dem horazischen Ideal „prodesse et delectare“. Die Verbreitung der Fabel als didaktisch funktionalisierte Literatur im Kontext der Moralisierung und Funktionalisierung der Literatur wird ausführlich behandelt.
2.1 Lessing und die französisch-deutsche Verwaltung des aesopischen Nachlasses: Dieses Unterkapitel analysiert den Einfluss Frankreichs auf die deutsche Fabelproduktion, insbesondere durch La Fontaine und La Motte. Es beschreibt Lessings Kritik an der französischen und deutschen Behandlung des aesopischen Erbes, die er als Abkehr von den antiken Vorbildern und Qualitätsminderung wertet. Lessings Sicht auf den Weg der Fabel von der Philosophie über die Rhetorik in die Poetik wird dargestellt, wobei seine Einschätzung der Fabel seiner Zeit als „Kinderspiel“ hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Fabeltheorie, Lessing, Aesop, Frankreich, Aufklärung, Formtheorie, Drama, Philosophie, Gattungstheorie, Antike, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu Lessings Fabeltheorie
Was ist der Inhalt dieser Arbeit über Lessings Fabeltheorie?
Diese Arbeit analysiert Lessings Fabeltheorie im Kontext des 18. Jahrhunderts, ihre Entwicklung und ihren Bezug zu zeitgenössischen Strömungen. Sie untersucht Lessings Abkehr vom französischen Vorbild und seine Rückbesinnung auf die antiken Wurzeln der Fabel. Ein weiterer Fokus liegt auf der formtheoretischen Konzeption Lessings und deren Umsetzung in seinen Fabeln. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zum historischen Hintergrund (inkl. Lessings Auseinandersetzung mit dem französischen und deutschen Umgang mit dem aesopischen Erbe), Lessings Fabeltheorie, einen Exkurs, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: die Entwicklung von Lessings Fabeltheorie, Lessings Kritik am französischen Fabelverständnis, seine formtheoretischen Überlegungen zur Fabel, einen Vergleich zwischen Lessings Fabel- und Dramentheorie sowie den philosophischen Hintergrund seiner Fabeltheorie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, die den Begriff „Fabel“ im 18. Jahrhundert beleuchtet und Lessings langjähriges Interesse an der Fabel skizziert. Ein Kapitel zum historischen Hintergrund, das den Ursprung der Fabel und die Bedeutung der aesopischen Fabeln im 18. Jahrhundert erörtert. Ein Unterkapitel analysiert Lessings Kritik an der französischen und deutschen Behandlung des aesopischen Erbes. Weitere Kapitel befassen sich mit Lessings Fabeltheorie selbst, einem Exkurs, einem Fazit und einem Literaturverzeichnis.
Welche Rolle spielt der Vergleich mit der französischen Fabeltradition?
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit ist Lessings Kritik an der französischen Fabeltradition, insbesondere an Autoren wie La Fontaine und La Motte. Lessing sieht in der französischen Behandlung des aesopischen Erbes eine Abkehr von den antiken Vorbildern und eine Qualitätsminderung. Seine Abkehr vom französischen Vorbild und seine Rückbesinnung auf die antiken Wurzeln der Fabel sind zentrale Themen der Analyse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Fabeltheorie, Lessing, Aesop, Frankreich, Aufklärung, Formtheorie, Drama, Philosophie, Gattungstheorie, Antike, Literaturgeschichte.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass Lessings Fabeltheorie über die bloße Wiederbelebung des aesopischen Vorbilds hinausgeht.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beleuchtet die doppeldeutige Verwendung des Begriffs „Fabel“ im 18. Jahrhundert und skizziert Lessings langjähriges Interesse an der Fabel. Sie deutet auf die vielfältigen Aspekte von Lessings Beschäftigung mit der Fabel hin – poetologisch, philosophisch, philologisch und theoretisch.
Was wird im Kapitel zum historischen Hintergrund behandelt?
Dieses Kapitel erörtert den unsicheren Ursprung der Fabel und die Schwierigkeiten, den Typus der aesopischen Fabel historisch nachzuvollziehen. Es beleuchtet die Bedeutung der aesopischen Fabeln im 18. Jahrhundert als Vorbild für die aufklärerische Fabelproduktion und den Zusammenhang mit dem horazischen Ideal „prodesse et delectare“. Die Verbreitung der Fabel als didaktisch funktionalisierte Literatur wird ausführlich behandelt.
- Citar trabajo
- Ines Schoppmeyer (Autor), 2006, Fabeltheorie bei Lessing, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63346