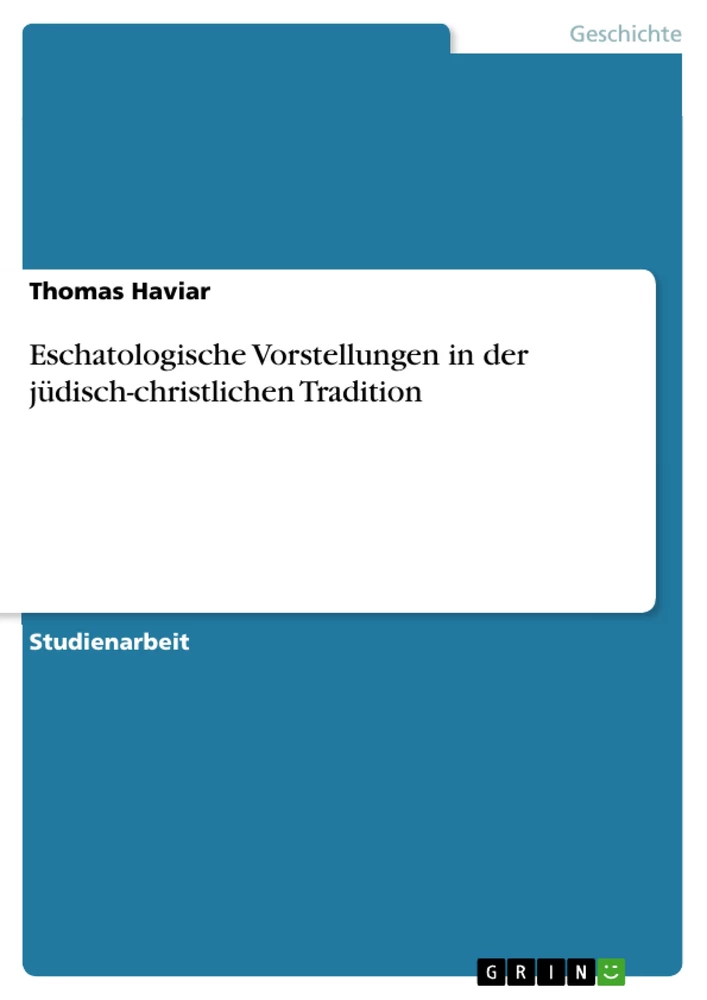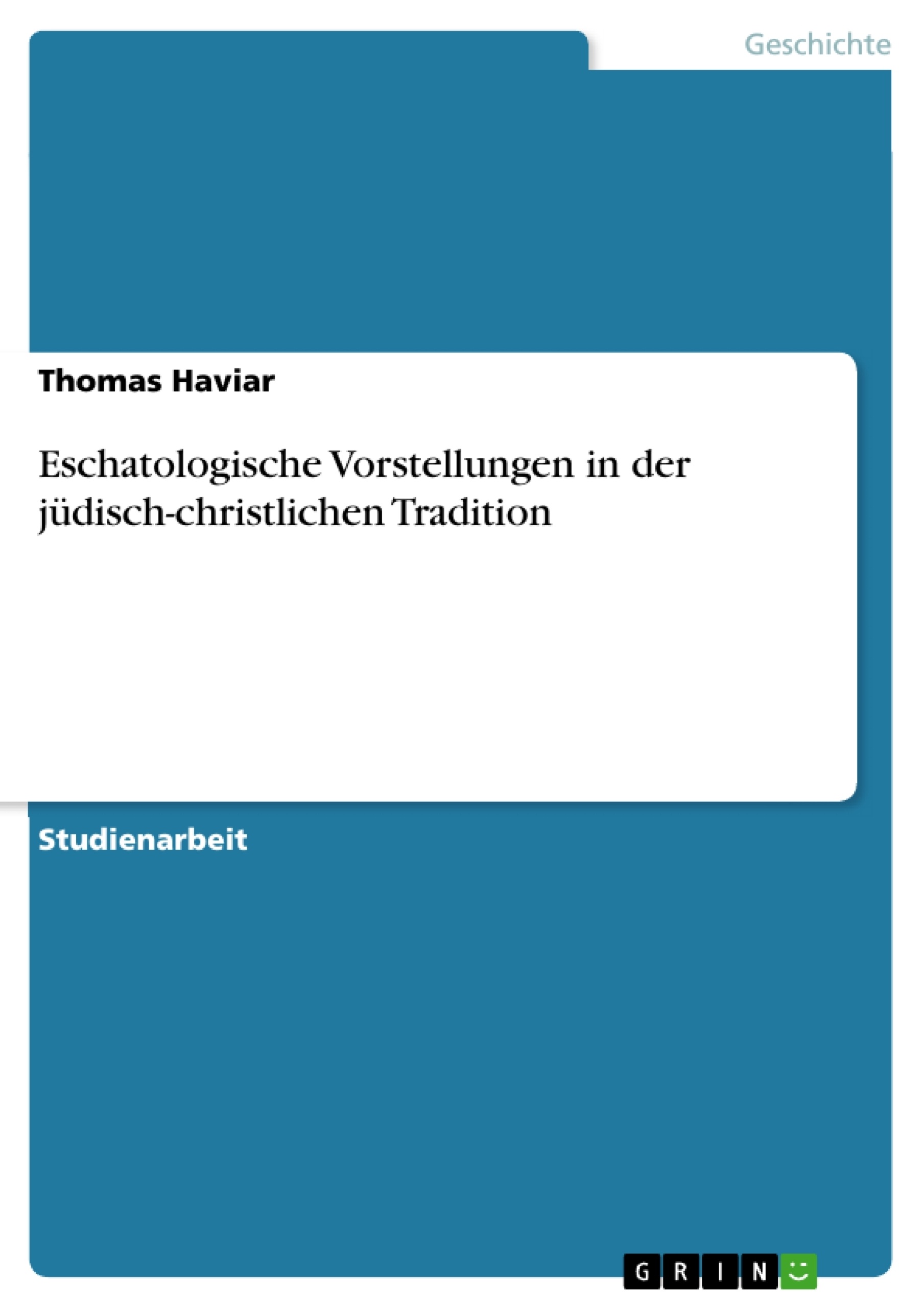Anlaß für die nachfolgende Betrachtung gab im erwähnten Werk besonders das II. Kapitel und hier im Speziellen die Nummern 6 bis 15. Demandt geht hier kursorisch und sehr oberflächlich auf jüdische Messiashoffnung, Weltreichsidee bei Daniel, Romidee, Christliche Eschatologie, etc.,etc. ein. Kaum eine der wichtigen Endzeitvorstellungen im jüdisch-christlichen Raum zwischen 1000 v. Chr. und 1500 n. Chr. bleibt unerwähnt. Das er einige natürlich unerwähnt läßt, sei ihm nachgesehen. Einige von den erwähnten Endzeiterwartungen möchte ich hier anführen und ihre Ausfaltungen näher betrachten. Vorab ist es aber notwendig, den Begriff „Eschatologie“ zu klären. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in den Begriff Eschatologie
- 1.1 Heutige Problematik der Eschatologie
- 1.2 Eschatologie im dogmatischen Selbstverständnis
- 1.3 Fragestellung der Eschatologie
- 2. Vollendung der Welt - Universale Eschatologie
- 2.1 Begrifflichkeiten
- 2.2 Biblische Grundlagen
- 2.2.1 Alte Verheißungen
- 2.2.2 Apokalyptik
- 2.2.3 Die Verkündigung der Herrschaft Gottes
- 2.2.4 Erwartung der Parusie
- 2.2.5 Parusie und Gericht
- 2.3 Dogmengeschichtliche Entwicklung
- 2.3.1 Vorstellungen in der frühen Kirche
- 2.3.2 Chiliasmus
- 2.3.3 Civitas Dei und Civitas terrena
- 2.3.4 Eschatologie und neuzeitliches Fortschrittsdenken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht eschatologische Vorstellungen in der jüdisch-christlichen Tradition, ausgehend von Alexander Demandts Werk „Endzeit?“. Ziel ist es, ausgewählte Endzeitvorstellungen näher zu betrachten und den Begriff der Eschatologie zu klären. Die Arbeit analysiert die Problematik der Eschatologie in der Moderne und beleuchtet deren Bedeutung im dogmatischen Selbstverständnis.
- Problematik der Eschatologie im modernen Kontext
- Eschatologie im dogmatischen Selbstverständnis
- Universale Eschatologie und ihre biblischen Grundlagen
- Dogmengeschichtliche Entwicklung eschatologischer Vorstellungen
- Der Bezug zu Alexander Demandts Werk "Endzeit?"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in den Begriff Eschatologie: Dieses einführende Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, denen die christliche Eschatologie in der Moderne begegnet. Die Religionskritik des 19. und 20. Jahrhunderts kritisierte die Fokussierung auf eine jenseitige Zukunft als Ablenkung von dringenden diesseitigen Problemen. Gleichzeitig wird die Gefahr eines moralisierenden Missbrauchs der Eschatologie angesprochen. Schließlich wird die Kritik an überlieferten, naturwissenschaftlich unglaubwürdigen Vorstellungen thematisiert, wobei der Einfluss der neuscholastischen Theologie auf dieses Problem hervorgehoben wird. Karl Rahner wird als Gegenposition zitiert, der die absolute Vollendung als unergründliches Geheimnis betrachtet.
1.2 Eschatologie im dogmatischen Selbstverständnis: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Eschatologie innerhalb der neuscholastischen und nachscholastischen Theologie. Während die neuscholastische Tradition die Eschatologie als Lehre von den "letzten Dingen" verstand und sie als den letzten Traktat der Dogmatik platzierte, betont die nachscholastische Theologie die Selbstoffenbarung Gottes als Horizont, Inhalt und Vollendung des Menschen. Sie hebt die präsentische Dimension der Eschatologie hervor, die den Glauben auf ein Endziel hin ausrichtet, ohne eine exakte Beschreibung des Jenseits zu liefern. Der zentrale Punkt ist die definitive Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus und die Ausgießung des Heiligen Geistes.
1.3 Fragestellung der Eschatologie: Das Kapitel skizziert die drei zentralen Fragekreise der Eschatologie: die universale, die individuelle und den Zusammenhang von Kirche und Eschatologie. Es betont die Verschränkung dieser Bereiche und folgt neueren Handbüchern, indem es die universale Eschatologie vor die individuelle stellt, um der biblischen Heilsgeschichte und der inneren Logik zu folgen. Die universale Eschatologie betrachtet die Betroffenheit des Menschen im Horizont der Wiederkunft Christi, des Endgerichts, der Auferstehung und der Neuschöpfung. Die individuelle Eschatologie hingegen fokussiert das Betroffensein des einzelnen Menschen durch Gottes Selbstmitteilung im Kontext der Freiheit und Selbstverfügung, einschließlich Tod, persönlichem Gericht und dem endgültigen Schicksal.
Schlüsselwörter
Eschatologie, jüdisch-christliche Tradition, Endzeitvorstellungen, Universale Eschatologie, Individuelle Eschatologie, Dogmengeschichte, Moderne, Religionskritik, Karl Rahner, Biblische Grundlagen, Neuscholastik, Nachscholastik, Demandt, Heilsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu: Eschatologie in der jüdisch-christlichen Tradition
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht eschatologische Vorstellungen in der jüdisch-christlichen Tradition, ausgehend von Alexander Demandts Werk „Endzeit?“. Der Fokus liegt auf der Klärung des Begriffs der Eschatologie und der Analyse ausgewählter Endzeitvorstellungen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Problematik der Eschatologie in der Moderne und ihrer Bedeutung im dogmatischen Selbstverständnis gewidmet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Problematik der Eschatologie im modernen Kontext, die Rolle der Eschatologie im dogmatischen Selbstverständnis, die universale Eschatologie und ihre biblischen Grundlagen, die dogmengeschichtliche Entwicklung eschatologischer Vorstellungen und den Bezug zu Alexander Demandts Werk "Endzeit?". Sie umfasst Einführung in den Begriff Eschatologie, Vollendung der Welt – Universale Eschatologie, sowie die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1: Einführung in den Begriff Eschatologie beleuchtet die Herausforderungen der christlichen Eschatologie in der Moderne, die Religionskritik des 19. und 20. Jahrhunderts, die Gefahr des moralischen Missbrauchs und die Kritik an naturwissenschaftlich unglaubwürdigen Vorstellungen. Kapitel 1.2: Eschatologie im dogmatischen Selbstverständnis untersucht die Rolle der Eschatologie in der neuscholastischen und nachscholastischen Theologie. Kapitel 1.3: Fragestellung der Eschatologie skizziert die drei zentralen Fragekreise der Eschatologie: die universale, die individuelle und den Zusammenhang von Kirche und Eschatologie.
Was sind die zentralen Fragestellungen der Eschatologie laut der Arbeit?
Die Arbeit identifiziert drei zentrale Fragekreise der Eschatologie: die universale Eschatologie (Betroffenheit des Menschen im Horizont der Wiederkunft Christi, Endgericht, Auferstehung, Neuschöpfung), die individuelle Eschatologie (Betroffensein des einzelnen Menschen durch Gottes Selbstmitteilung im Kontext von Freiheit und Selbstverfügung, Tod, persönlichem Gericht und endgültigem Schicksal) und den Zusammenhang von Kirche und Eschatologie.
Welche Bedeutung hat die Arbeit von Alexander Demandt ("Endzeit?") für diese Arbeit?
Die Arbeit von Alexander Demandt ("Endzeit?") dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung eschatologischer Vorstellungen in der jüdisch-christlichen Tradition. Der genaue Bezug wird im Text erläutert, aber die Arbeit analysiert und diskutiert die in Demandts Werk präsentierten Konzepte im Kontext der christlichen Eschatologie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Eschatologie, jüdisch-christliche Tradition, Endzeitvorstellungen, Universale Eschatologie, Individuelle Eschatologie, Dogmengeschichte, Moderne, Religionskritik, Karl Rahner, Biblische Grundlagen, Neuscholastik, Nachscholastik, Demandt, Heilsgeschichte.
Wie wird die Problematik der Eschatologie in der Moderne dargestellt?
Die Arbeit zeigt die Herausforderungen der christlichen Eschatologie in der Moderne auf, einschließlich der Religionskritik, die die Fokussierung auf eine jenseitige Zukunft als Ablenkung von diesseitigen Problemen kritisiert. Sie thematisiert die Gefahr eines moralisierenden Missbrauchs und die Kritik an überlieferten, naturwissenschaftlich unglaubwürdigen Vorstellungen.
Welche Rolle spielt die neuscholastische und nachscholastische Theologie?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Eschatologie in der neuscholastischen und nachscholastischen Theologie. Während die neuscholastische Tradition die Eschatologie als Lehre von den "letzten Dingen" verstand, betont die nachscholastische Theologie die Selbstoffenbarung Gottes als Horizont, Inhalt und Vollendung des Menschen und die präsentische Dimension der Eschatologie.
- Quote paper
- Mag. phil. Thomas Haviar (Author), 1997, Eschatologische Vorstellungen in der jüdisch-christlichen Tradition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63287