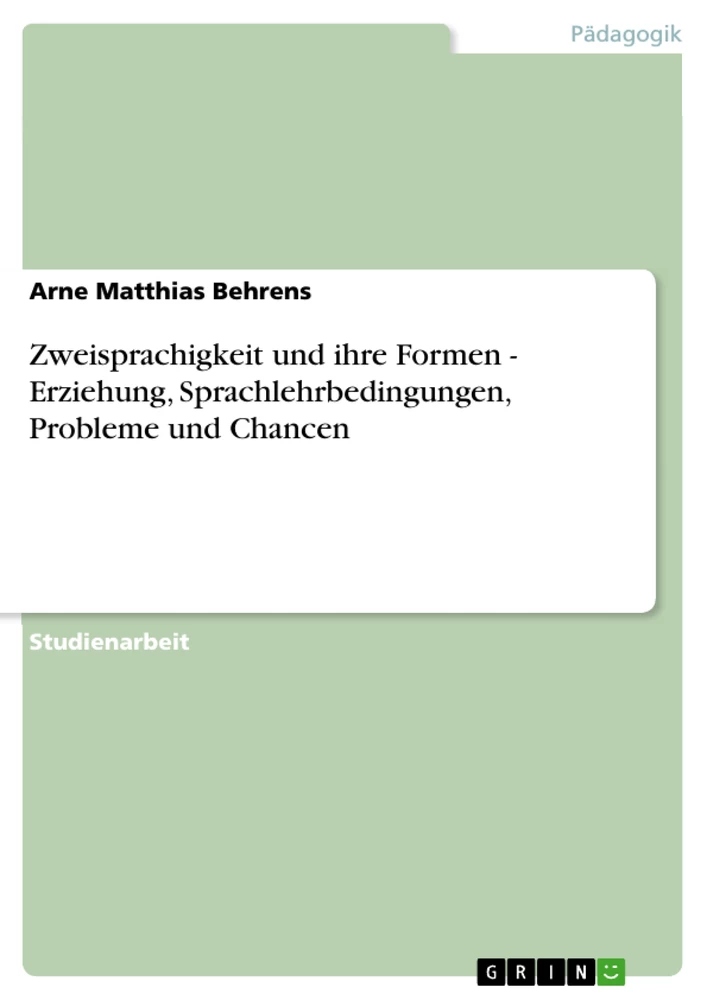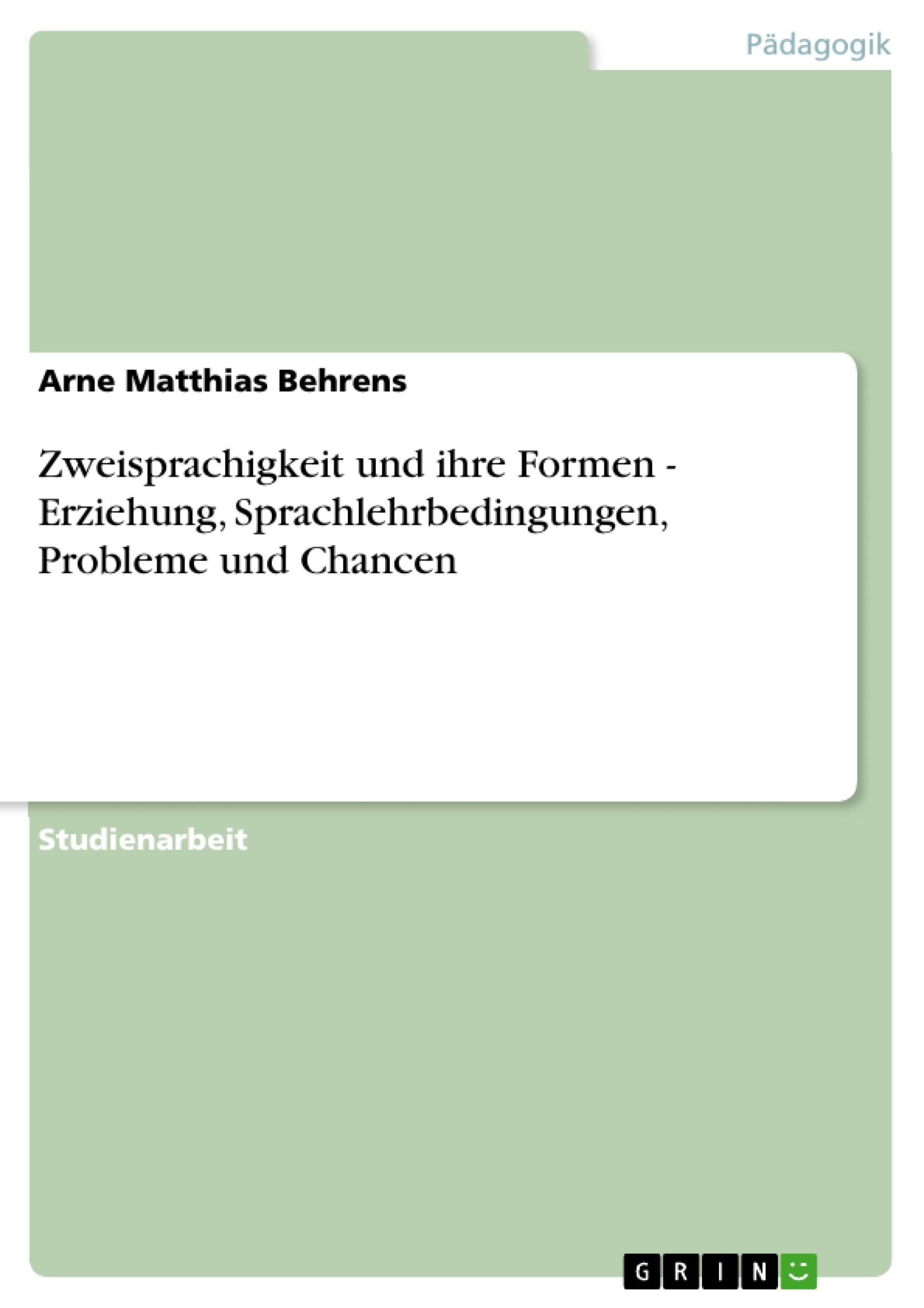In der Arbeit geht es darum Zweisprachigkeit als ein neues Dazwischen zu denken. Denken generiert Verknüpfungen durch Sprache - Denken ist ohne Sprache kaum vorstellbar. Was ist Intuition? Wie funktioniert und entwickelt sie sich bei Menschen, die durch mind. eine weitere Sprache stets ein Referenssystem "zur Hand" haben? Was passiert im Dazwischen wenn zwei Sprachen zum Denken verwendet werden und kombinierbar als neues verbleiben und weiterdenken?
Wie läuft eigene Kommunikation und positives Wundern und Zweifeln ab?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprache
- 3. Zweisprachigkeit
- 3.1 Zweisprachigkeit, der Begriff
- 3.2 Zweisprachigkeit und ihre Formen
- 3.3 Deutsch als Zweitsprache
- 3.4 Unterrichtsformen und pädagogische Ansatzpunkte
- 3.5 Zweisprachige Erziehung - Chance oder Risiko?
- 3.6 Die Entwicklung des Kindes in zweisprachiger Umgebung
- 3.7 Wie Eltern Zweisprachigkeit fördern können
- 3.8 Kindergarten- und Vorschulzeit
- 3.9 Die Europäischen Grundschulen
- 4. Spracherwerb
- 4.1 Das Sprechen
- 4.2 Der produktive Spracherwerb
- 4.3 Sprachverarbeitung
- 4.4 Sprachverständnis
- 4.5 Sprachlehrbedingungen
- 4.6 Probleme und Chancen
- 5. Empirische Studie
- 5.1 Eine empirische Studie
- 5.2 Was wurde wie beobachtet?
- 5.3 Fallbeispiele
- 5.3.1 Marlene
- 5.3.2 Bild mit Küchenszene (Sprechprobe 1)
- 5.3.3 Bildergeschichte mit Vogel und Katze (Sprechprobe 1)
- 5.3.4 Einführung in die Sprechprobe 2
- 5.3.5 Bildergeschichte mit Vogel und Katze (Sprechprobe 2)
- 5.3.6 Bild mit Küchenszene (Sprechprobe 2)
- 5.4 Auswertung
- 5.4.1 Auswertung
- 5.4.2 Bild mit Küchenszene (Auswertung der Sprechprobe 1)
- 5.4.3 Bildergeschichte mit Vogel und Katze (Auswertung der Sprechprobe 1)
- 5.4.4 Bildergeschichte mit Vogel und Katze (Auswertung der Sprechprobe 2)
- 5.4.5 Bild mit Küchenszene (Auswertung der Sprechprobe 2)
- 6. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Zweisprachigkeitserziehung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und des wachsenden Bedarfs an Fremdsprachenkenntnissen. Ziel ist es, die Bedeutung und Vorteile von Zweisprachigkeit aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass erfolgreicher zweisprachiger Spracherwerb mit entsprechendem Aufwand realistisch ist.
- Definition und Formen der Zweisprachigkeit
- Der Prozess des zweisprachigen Spracherwerbs
- Förderung der Zweisprachigkeit durch Eltern und Pädagogen
- Chancen und Herausforderungen der Zweisprachigkeit
- Empirische Untersuchung zum zweisprachigen Spracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung von Zweisprachigkeitserziehung in einer globalisierten Welt und im Kontext der Einwanderung. Sie führt in die Thematik ein und begründet die Relevanz der Arbeit mit dem steigenden gesellschaftlichen Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich und durch die europäische Zusammenarbeit. Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeit Definitionsansätze, Vorurteile sowie Vor- und Nachteile der Zweisprachigkeit beleuchten wird, um zu zeigen, dass erfolgreicher zweisprachiger Spracherwerb mit entsprechendem Engagement erreichbar ist.
2. Sprache: Dieses Kapitel definiert Sprache als eine einzigartige menschliche Ausdrucksform, die sich durch Kreativität und begriffliche Abstraktion auszeichnet. Es unterstreicht die Bedeutung der Sprache als Kommunikationsmittel und Werkzeug des Denkens, wobei der Fokus auf die Komplexität des Spracherwerbs gelegt wird, der nicht nur das Erlernen einzelner Wörter und Sätze, sondern ganzer Strukturen beinhaltet. Die historische Entwicklung der Spracherforschungs wird kurz angerissen.
3. Zweisprachigkeit: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Aspekten der Zweisprachigkeit. Es thematisiert die Schwierigkeiten einer präzisen Definition und die verschiedenen Formen der Zweisprachigkeit. Es werden pädagogische Ansätze und die Rolle der Eltern bei der Förderung der Zweisprachigkeit erörtert, ebenso wie die Chancen und Risiken einer zweisprachigen Erziehung und die Entwicklung des Kindes in einer zweisprachigen Umgebung. Der Einfluss von Kindergarten und Vorschule sowie europäischer Grundschulen auf den zweisprachigen Spracherwerb werden ebenfalls beleuchtet.
4. Spracherwerb: Dieses Kapitel analysiert den Spracherwerb im Detail. Es behandelt den produktiven Spracherwerb, die Sprachverarbeitung und das Sprachverständnis sowie die Bedingungen des Sprachunterrichts. Schließlich werden Probleme und Chancen des Spracherwerbs diskutiert, wobei auf die Komplexität des Prozesses und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes hingewiesen wird.
5. Empirische Studie: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Studie zum zweisprachigen Spracherwerb. Es wird detailliert auf die Methodik der Studie eingegangen, einschließlich der Beobachtungen und der Auswertung der Daten. Konkrete Fallbeispiele (z.B. Marlene) veranschaulichen die Ergebnisse und geben Einblicke in den Prozess des Spracherwerbs bei Kindern in zweisprachigen Umgebungen. Die Auswertungen von Sprechproben anhand von verschiedenen Bildmaterialien (Küchenszene, Vogel-Katze-Geschichte) werden detailliert beschrieben und analysiert.
Schlüsselwörter
Zweisprachigkeit, Spracherwerb, Mehrsprachigkeit, Zweisprachige Erziehung, pädagogische Ansätze, empirische Studie, Sprachentwicklung, Deutsch als Zweitsprache, Fremdsprachenunterricht, Kinder, Eltern, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Zweisprachigkeitserziehung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über das Thema Zweisprachigkeitserziehung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Hauptfokus liegt auf der Erörterung von Zweisprachigkeit, dem zweisprachigen Spracherwerb, der Rolle von Eltern und Pädagogen sowie einer empirischen Studie zum Thema.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einleitung, 2. Sprache, 3. Zweisprachigkeit (mit Unterkapiteln zu Definition, Formen, Deutsch als Zweitsprache, pädagogischen Ansätzen, Chancen und Risiken, Entwicklung des Kindes, Förderung durch Eltern, Kindergarten und Vorschule sowie europäischen Grundschulen), 4. Spracherwerb (mit Unterkapiteln zu Sprechen, produktivem Spracherwerb, Sprachverarbeitung, Sprachverständnis, Sprachlehrbedingungen und Problemen/Chancen), 5. Empirische Studie (mit detaillierten Beschreibungen der Methodik, Fallbeispielen und Auswertungen) und 6. Schlussteil.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte?
Die Arbeit untersucht die Zweisprachigkeitserziehung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und des wachsenden Bedarfs an Fremdsprachenkenntnissen. Ziel ist es, die Bedeutung und Vorteile von Zweisprachigkeit aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass erfolgreicher zweisprachiger Spracherwerb mit entsprechendem Aufwand realistisch ist. Die Themenschwerpunkte umfassen Definitionen und Formen der Zweisprachigkeit, den Prozess des zweisprachigen Spracherwerbs, die Förderung durch Eltern und Pädagogen, Chancen und Herausforderungen sowie eine empirische Untersuchung.
Was wird in der empirischen Studie untersucht?
Die empirische Studie untersucht den zweisprachigen Spracherwerb bei Kindern. Die Methodik, Beobachtungen und Auswertungen werden detailliert beschrieben. Konkrete Fallbeispiele, darunter die Analyse von Sprechproben anhand von Bildmaterialien (Küchenszene, Vogel-Katze-Geschichte), veranschaulichen die Ergebnisse und geben Einblicke in den Prozess des Spracherwerbs in zweisprachigen Umgebungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Dokument?
Die Schlüsselwörter umfassen Zweisprachigkeit, Spracherwerb, Mehrsprachigkeit, Zweisprachige Erziehung, pädagogische Ansätze, empirische Studie, Sprachentwicklung, Deutsch als Zweitsprache, Fremdsprachenunterricht, Kinder, Eltern und Gesellschaft.
Welche Aspekte der Zweisprachigkeit werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Aspekte der Zweisprachigkeit, darunter Definitionen, verschiedene Formen, Deutsch als Zweitsprache, pädagogische Ansätze zur Förderung, Chancen und Risiken einer zweisprachigen Erziehung, die Entwicklung des Kindes in einer zweisprachigen Umgebung, die Rolle der Eltern und die Einflüsse von Kindergarten, Vorschule und europäischen Grundschulen.
Wie wird der Spracherwerb im Dokument behandelt?
Das Kapitel zum Spracherwerb analysiert den Prozess detailliert, indem es den produktiven Spracherwerb, die Sprachverarbeitung, das Sprachverständnis, die Bedingungen des Sprachunterrichts und die damit verbundenen Probleme und Chancen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Komplexität des Prozesses und der Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Pädagogen, Eltern, Studierende der Sprachwissenschaft und alle, die sich für die Zweisprachigkeitserziehung und den zweisprachigen Spracherwerb interessieren. Es bietet einen umfassenden Überblick über das Thema und liefert wertvolle Einblicke in die Praxis.
- Quote paper
- Arne Matthias Behrens (Author), 2004, Zweisprachigkeit und ihre Formen - Erziehung, Sprachlehrbedingungen, Probleme und Chancen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63231