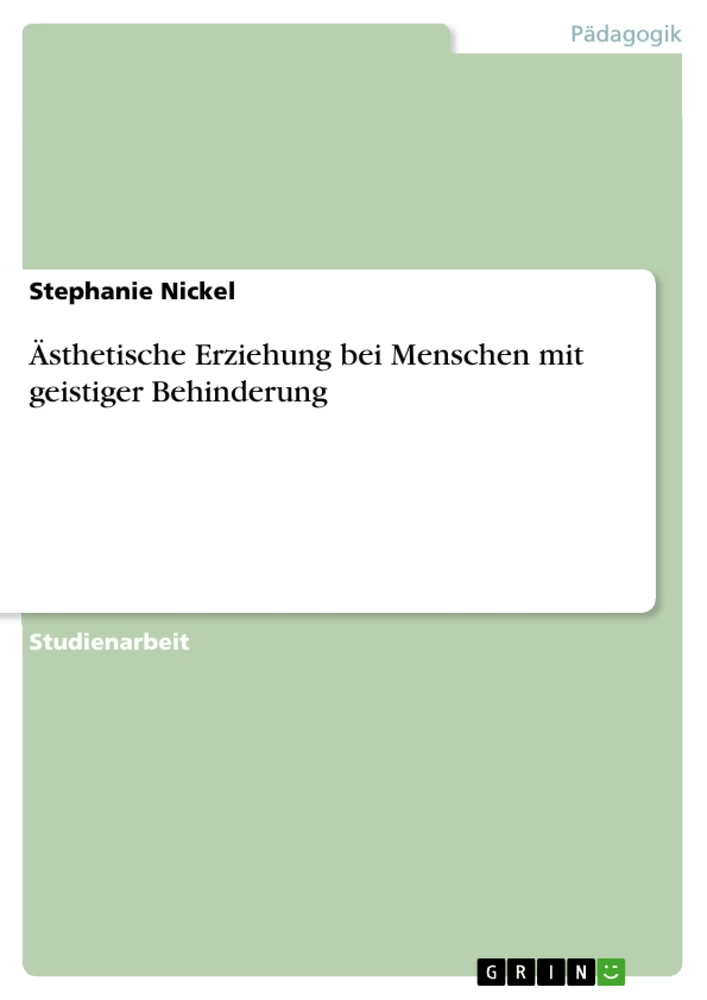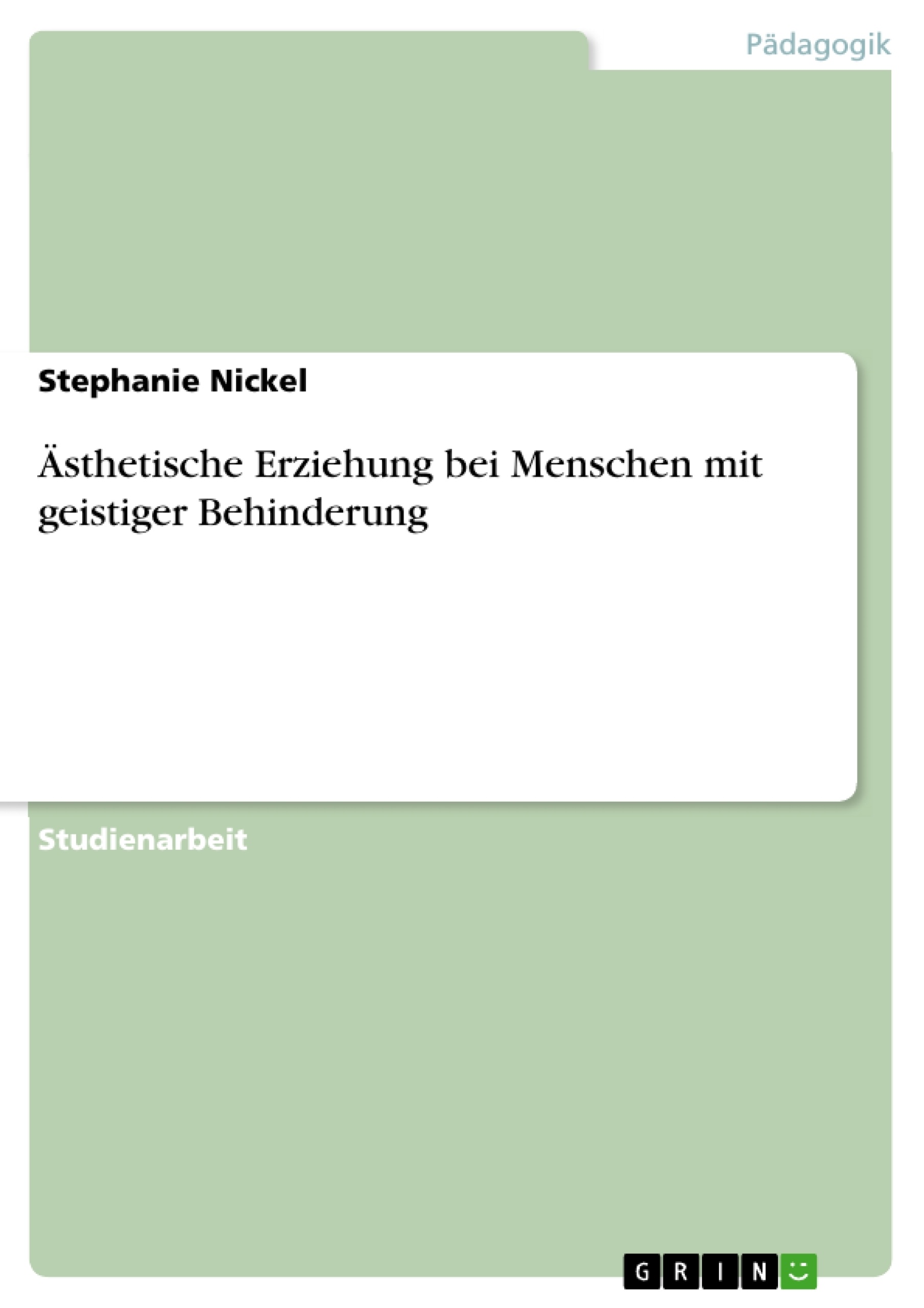Kunst ist eine elementare, natürliche Aktivität aller Kinder. Dies ist bei behinderten Kindern nicht anders. Jedes Kind – auch das behinderte Kind – ist mit einem kreativen potential ausgestattet, dessen Entwicklung früh in der Kindheit beginnt. Die kreativen Erfahrungen eines behinderten Kindes unterscheiden sich von den anderen (nicht-behinderten) Kindern – entsprechend der Art und dem Grad der Behinderung – lediglich in dem Ausmaß mentaler und / oder physischer Fähigkeiten zum Problemlösen.
Ich sehe Kunst in diesem Zusammenhang als „ästhetische Erziehung“ an. Ästhetische Erziehung entwickelt sich aus der Wahrnehmung von Objekten, Beziehungen, Kontrasten, Prozessen usw. Ästhetische Erziehung ermöglicht einen Ausdruck, der lebensnotwendig ist. Ästhetische Erziehung ist Kommunikation. Für behinderte Menschen, die oft gravierende Schwierigkeiten in der verbalen und schriftlichen Kommunikation haben, bietet ästhetische Erziehung eine wichtige Möglichkeit, ihre Gedanken und Gefühle, durch die verschiedensten Methoden, mitzuteilen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der ästhetischen Erziehung in der Praxis der Heilpädagogik. Hierzu ist es zunächst notwendig, die Personengruppe der geistig behinderten Menschen näher zu umschreiben. Im Anschluss an diese Umschreibung werde ich den Begriff der ästhetischen Erziehung und den der Wahrnehmung, innerhalb der ästhetischen Erziehung, näher beschreiben, um im nächsten Schritt auf eine der historischen Wurzeln der ästhetischen Erziehung einzugehen. Im letzten Teil meiner Arbeit möchte ich drei verschiedene Schwerpunkte der ästhetischen Erziehung darstellen, um ihre jeweiligen Intentionen in der Praxis der Heilpädagogik darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Geistige Behinderung
- Ästhetische Erziehung
- Die Bedeutung der Wahrnehmung in der Ästhetischen Erziehung
- Einblick in die Geschichte der ästhetischen Erziehung
- Die Idee einer ästhetischen Praxis in der Heilpädagogik nach Georgens und Deinhardt
- Zur Praxis der heilpädagogischen-ästhetischen Erziehung nach Georgens und Deinhardt
- Die Übertragung des Konzeptes von Georgens und Deinhardts in die heutige Zeit
- Schwerpunkte ästhetischer Erziehung
- Ästhetische Erziehung als Basale Pädagogik
- Ästhetische Erziehung als pädagogische Kunsttherapie
- Ästhetische Erziehung als Kunstpädagogik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ästhetische Erziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ziel ist es, die Bedeutung und verschiedenen Ansätze ästhetischer Erziehung in der Heilpädagogik zu beleuchten und deren praktische Anwendung zu beschreiben. Die Arbeit greift auf historische Konzepte zurück und präsentiert aktuelle Schwerpunkte.
- Definition und Verständnis von geistiger Behinderung
- Definition und historische Entwicklung des Begriffs „Ästhetische Erziehung“
- Rolle der Wahrnehmung in der ästhetischen Erziehung
- Verschiedene Ansätze und Schwerpunkte ästhetischer Erziehung in der Heilpädagogik
- Praktische Anwendung und Intentionen ästhetischer Erziehung für Menschen mit geistiger Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der ästhetischen Erziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung ein. Sie betont die kreativen Potentiale aller Kinder, auch derer mit Behinderungen, und sieht in der Kunst einen wichtigen Ausdruck dieser Potentiale. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die zu behandelnden Aspekte: die Definition geistiger Behinderung, die Beschreibung ästhetischer Erziehung und deren Wahrnehmung, einen historischen Rückblick und die Darstellung verschiedener Schwerpunkte ästhetischer Erziehung in der Heilpädagogik.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von „geistiger Behinderung“ und „ästhetischer Erziehung“. Es wird die Komplexität der Definition von geistiger Behinderung hervorgehoben, da sie im Vergleich zur Normalität definiert werden muss. Eine ganzheitliche Sichtweise wird vertreten, die geistige Behinderung als komplexes soziales Phänomen mit wechselseitig bedingenden Faktoren beschreibt. Die Definition der ästhetischen Erziehung wird ebenfalls beleuchtet, wobei auf die lange Entwicklungsgeschichte und den Ursprung in der Kunstphilosophie verwiesen wird. Schillers Konzept der ästhetischen Erziehung und deren Entwicklung bis hin zu heutigen, sinnlichen Ansätzen wird erläutert. Eine allgemeingültige Definition für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen wird vermisst und durch eine Aussage von G. Theunissen ersetzt.
Schlüsselwörter
Ästhetische Erziehung, Geistige Behinderung, Heilpädagogik, Kunsttherapie, Wahrnehmung, Basale Pädagogik, Kunstpädagogik, Selbstverwirklichung, Kommunikation, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ästhetische Erziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema „Ästhetische Erziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung“. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Text beleuchtet die Bedeutung und verschiedene Ansätze ästhetischer Erziehung in der Heilpädagogik, berücksichtigt historische Konzepte und präsentiert aktuelle Schwerpunkte. Er definiert die Begriffe „geistige Behinderung“ und „ästhetische Erziehung“ und untersucht die Rolle der Wahrnehmung in diesem Kontext.
Welche Kapitel sind enthalten?
Das Dokument umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffsbestimmung (geistige Behinderung und ästhetische Erziehung), der Bedeutung der Wahrnehmung in der ästhetischen Erziehung, einem geschichtlichen Einblick in die ästhetische Erziehung (insbesondere nach Georgens und Deinhardt), Schwerpunkten ästhetischer Erziehung (Basale Pädagogik, Kunsttherapie, Kunstpädagogik) und einem Fazit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ästhetische Erziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ziel ist es, die Bedeutung und verschiedenen Ansätze ästhetischer Erziehung in der Heilpädagogik zu beleuchten und deren praktische Anwendung zu beschreiben. Die Arbeit greift auf historische Konzepte zurück und präsentiert aktuelle Schwerpunkte, unter anderem die Rolle der Wahrnehmung und verschiedene pädagogische Ansätze.
Wie werden „geistige Behinderung“ und „ästhetische Erziehung“ definiert?
Das Dokument betont die Komplexität der Definition von „geistiger Behinderung“, da sie im Vergleich zur Normalität definiert werden muss. Es wird eine ganzheitliche Sichtweise vertreten. Die Definition der „ästhetischen Erziehung“ wird ebenfalls beleuchtet, wobei auf die lange Entwicklungsgeschichte und den Ursprung in der Kunstphilosophie verwiesen wird. Schillers Konzept und die Entwicklung bis hin zu heutigen, sinnlichen Ansätzen werden erläutert. Eine allgemeingültige Definition für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen wird vermisst und durch eine Aussage von G. Theunissen ersetzt.
Welche Schwerpunkte der ästhetischen Erziehung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Schwerpunkte ästhetischer Erziehung in der Heilpädagogik, darunter die ästhetische Erziehung als Basale Pädagogik, als pädagogische Kunsttherapie und als Kunstpädagogik. Diese Ansätze werden im Kontext der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Ästhetische Erziehung, Geistige Behinderung, Heilpädagogik, Kunsttherapie, Wahrnehmung, Basale Pädagogik, Kunstpädagogik, Selbstverwirklichung, Kommunikation, Inklusion.
Welche historischen Konzepte werden berücksichtigt?
Die Arbeit greift auf historische Konzepte der ästhetischen Erziehung zurück, insbesondere auf die Ideen von Georgens und Deinhardt und deren Übertragung in die heutige Zeit. Schillers Konzept der ästhetischen Erziehung wird ebenfalls erwähnt.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit den Themen Ästhetische Erziehung, Geistige Behinderung und Heilpädagogik auseinandersetzt. Es dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- Dipl. Soz.Päd/Soz.Arb. Stephanie Nickel (Author), 2005, Ästhetische Erziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63132