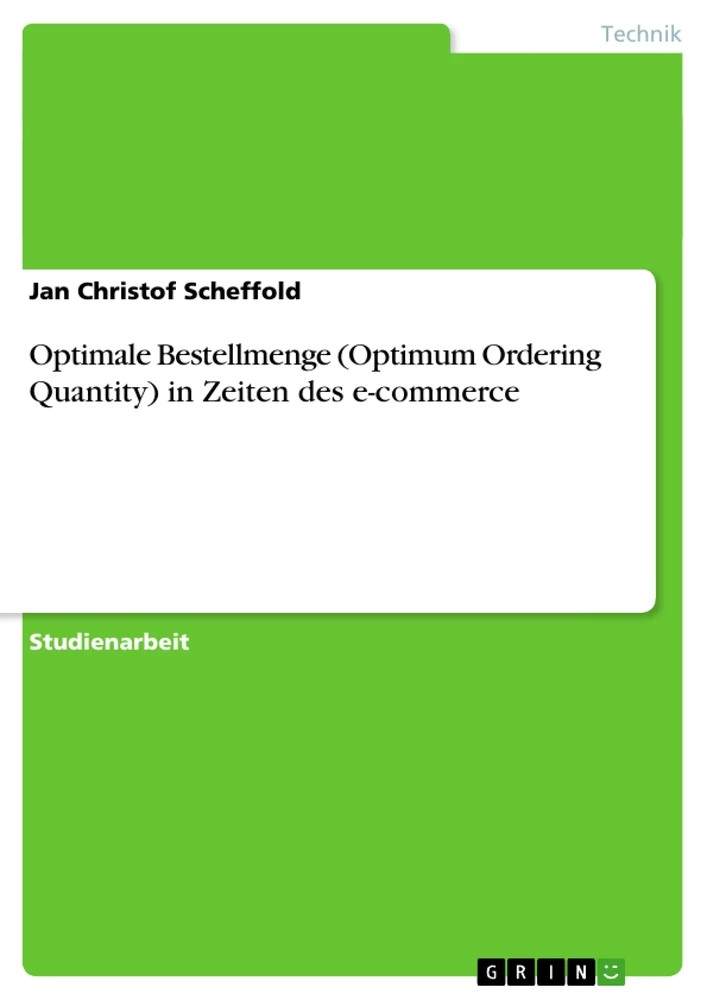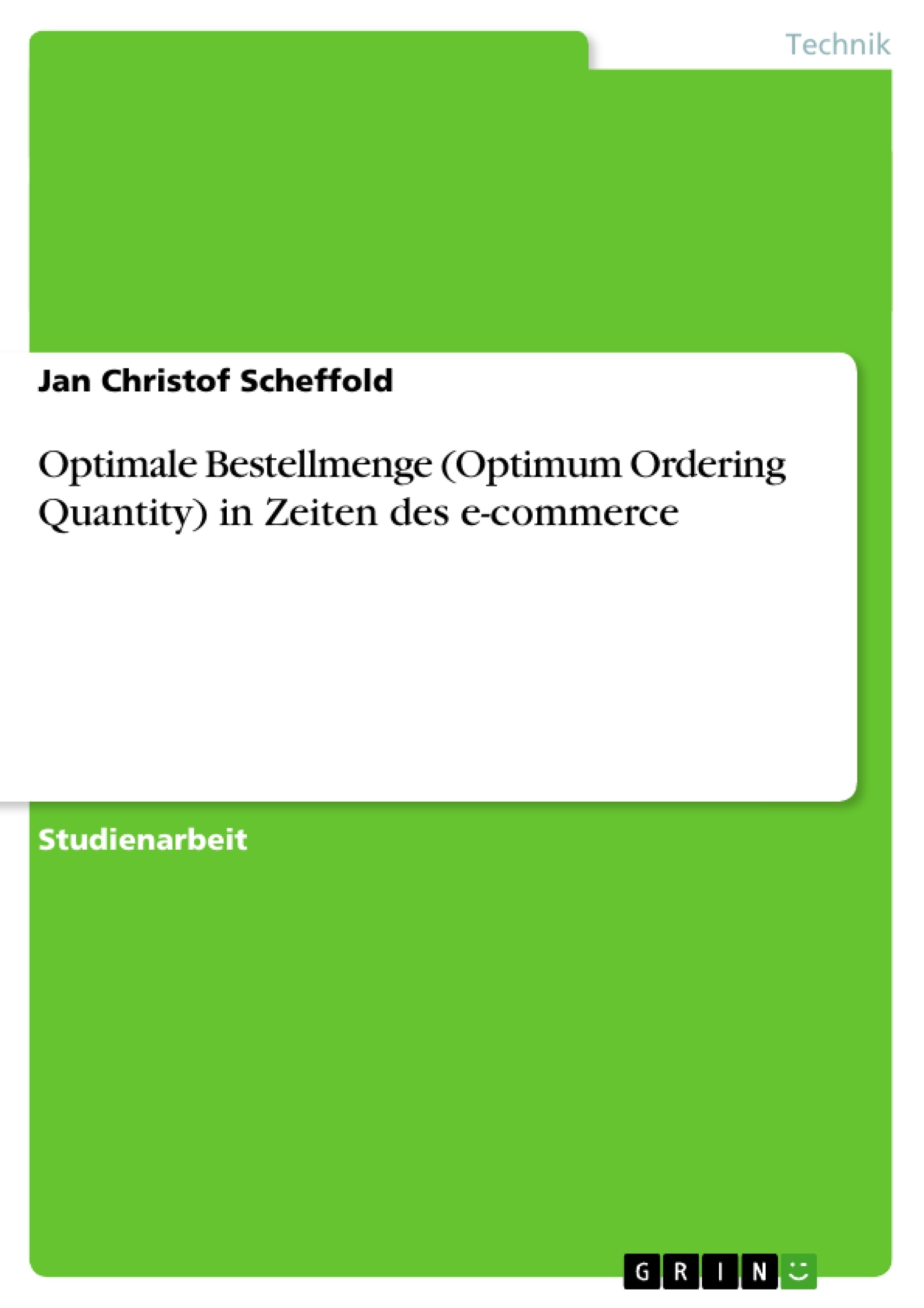Vorliegende Arbeit thematisiert die praktische Verwendung der optimalen Bestellmenge in Zeiten des e-commerce.
Die bereits sehr früh erkannten Gesetzmässigkeiten über Economies of scale, Effekte von Massenproduktionen und das Gesetz der Fixkostendegression besagen, dass mit steigende Ausbringungsmenge auch die Stückkosten sinken, sofern fixe Kosten zu Grunde liegen.
Diese Gesetzmässigkeit spiegelt sich in verschiedenen Bereichen des Unternehmens wieder. So spricht man in der Beschaffung von „optimaler Bestellmenge“, in der Produktion von „optimaler Losgrösse“ und der Vertrieb spricht von „optimaler Liefermenge“. Schon dadurch wird die Abhängigkeit verdeutlicht.
Das natürliche Streben zum Optimum hat jedoch seine Grenzen. Denn selbst –oder gerade - wenn jeder variable Parameter mit einbezogen würde, scheiterte der Wunsch nach einer voraussagbaren optimalen Bestellmenge an den Faktoren Komplexität und Zufall, oder Chaos.
Um dieses zu veranschaulichen möchte ich gerne ein Zitat anbringen:
„Es ist alles interdependent, ungewiß und im Prinzip kaum zurechenbar. (...) Dies führt (...) zum wissentlichen Einbezug von Halbwahrheiten und evtl. sogar Fehlern. (...) Oberstes und damit vorrangiges Ziel des ganzen Prozesses ist dabei das der Problemlösung.“
Im folgenden Text möchte ich zunächst auf die theoretischen Grundlagen der optimalen Bestellmenge eingehen und deren Berechnung mittels vereinfachter Formel erläutern.
Dann wird die Systemtheorie in genauerer Analyse als für die Praxis nicht isoliert anwendbar dargestellt.
Anhand beeinflussender Faktoren, welche auf die optimale Bestellmenge einwirken, wird schliesslich der Eindruck über die vorherrschende Komplexität deutlich. Diese versucht man heutzutage durch Einsatz neuester EDV-gestützter Technologien „beherrschbar“ zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Inhaltsverzeichnis
- 2 Abbildungsverzeichnis
- 3 Einführung
- 4 Definitionen
- 5 Theoretischer Ansatz
- 5.1 Grundlagen der Beschaffung in Unternehmen
- 5.2 Bedarfsermittlung
- 5.3 Dispositionsverfahren
- 6 Hilfsmittel zur Dispositions Steuerung
- 7 Theoretischer Grundrahmen Optimale Bestellmenge
- 7.1 Zusammensetzung der Kosten im Beschaffungsprozess
- 7.2 Die Andler-Formel
- 7.3 Annahmen zum Grundmodell
- 7.4 Vorteile aus der Anwendung der Formel
- 8 Theoretische Kritik
- 8.1 Kritik der Allgemeinen BWL
- 8.2 Kritik an Annahmen des Grundmodells
- 9 Praktische Kritik
- 9.1 Organisatorische Einflüsse
- 9.2 Prozessbedingte Einflüsse
- 9.3 Technologische Einflüsse
- 10 Letzte Anwendung der Formel in der Praxis
- 11 Fazit
- 12 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die praktische Anwendbarkeit der optimalen Bestellmenge im Kontext des E-Commerce. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, analysiert kritische Aspekte des Modells und betrachtet den Einfluss verschiedener Faktoren auf die optimale Bestellmenge in der Praxis.
- Theoretische Grundlagen der optimalen Bestellmenge und die Andler-Formel
- Kritische Betrachtung der Annahmen des Grundmodells
- Einfluss organisatorischer, prozessbedingter und technologischer Faktoren
- Praktische Anwendbarkeit im Kontext des E-Commerce
- Grenzen des Modells und Herausforderungen in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
3 Einführung: Die Einführung erläutert den Fokus der Arbeit: die praktische Anwendung der optimalen Bestellmenge im E-Commerce. Sie verweist auf die Gesetzmäßigkeiten von Economies of Scale und die Herausforderungen durch Komplexität und Zufall bei der Bestimmung einer optimalen Bestellmenge. Zitate unterstreichen die Interdependenz und Unsicherheit im Beschaffungsprozess.
4 Definitionen: Dieses Kapitel liefert knappe Definitionen zentraler Begriffe wie „Optimum“ und „Optimale Bestellmenge“, wobei der Fokus auf der Kostenminimierung liegt.
5 Theoretischer Ansatz: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Theorien zur optimalen Bestellmenge, beginnend mit Harris (1915) und Stefanic-Allmeyer (1927), und präsentiert die Andler-Formel (1929) als klassisches Modell. Es betont die Notwendigkeit einer Berechnung optimaler Parameter im Beschaffungsprozess und führt in die Grundlagen der Materialwirtschaft ein.
7 Theoretischer Grundrahmen Optimale Bestellmenge: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert das Modell der optimalen Bestellmenge, indem er die Zusammensetzung der Kosten im Beschaffungsprozess (Bestellkosten, Lagerkosten, Zinskosten) erklärt. Die Andler-Formel wird vorgestellt und die zugrundeliegenden Annahmen werden diskutiert. Der Abschnitt hebt die Vorteile der Anwendung der Formel hervor.
8 Theoretische Kritik: Dieses Kapitel analysiert die Kritikpunkte am Modell der optimalen Bestellmenge aus der Sicht der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (ABWL) und hinterfragt die Annahmen des Grundmodells. Es untersucht die Grenzen des Modells im Hinblick auf die Komplexität realer Beschaffungsprozesse.
9 Praktische Kritik: Dieser Abschnitt beleuchtet die praktischen Herausforderungen bei der Anwendung des Modells. Er untersucht den Einfluss organisatorischer, prozessbedingter und technologischer Faktoren auf die Bestimmung und Umsetzung der optimalen Bestellmenge. Der zunehmende Einsatz von EDV-gestützten Technologien zur Bewältigung der Komplexität wird erwähnt.
Schlüsselwörter
Optimale Bestellmenge, E-Commerce, Andler-Formel, Beschaffungskosten, Lagerkosten, Bestellkosten, Materialwirtschaft, Systemtheorie, Komplexität, EDV-gestützte Technologien, Wirtschaftlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Optimale Bestellmenge im E-Commerce
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die praktische Anwendbarkeit der optimalen Bestellmenge, speziell im Kontext des E-Commerce. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen, kritische Aspekte des Modells und den Einfluss verschiedener Faktoren auf die optimale Bestellmenge in der Praxis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: theoretische Grundlagen der optimalen Bestellmenge und die Andler-Formel; kritische Betrachtung der Annahmen des Grundmodells; Einfluss organisatorischer, prozessbedingter und technologischer Faktoren; praktische Anwendbarkeit im E-Commerce; Grenzen des Modells und Herausforderungen in der Praxis.
Welche Formel steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Andler-Formel (1929) bildet das klassische Modell zur Berechnung der optimalen Bestellmenge und steht im Zentrum der Analyse. Die Arbeit beschreibt detailliert die Formel, ihre Annahmen und ihre Vorteile, aber auch ihre Grenzen.
Welche Kosten werden bei der Berechnung der optimalen Bestellmenge berücksichtigt?
Die Zusammensetzung der Kosten im Beschaffungsprozess umfasst Bestellkosten, Lagerkosten und Zinskosten. Diese Kostenkomponenten sind entscheidend für die Anwendung der Andler-Formel.
Welche Kritikpunkte werden an der Andler-Formel geäußert?
Die Arbeit analysiert sowohl theoretische Kritikpunkte aus der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (ABWL) als auch praktische Kritikpunkte. Die theoretische Kritik hinterfragt die Annahmen des Grundmodells, während die praktische Kritik den Einfluss organisatorischer, prozessbedingter und technologischer Faktoren beleuchtet.
Welche Faktoren beeinflussen die optimale Bestellmenge in der Praxis?
Organisatorische, prozessbedingte und technologische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. Die Arbeit untersucht, wie diese Faktoren die Bestimmung und Umsetzung der optimalen Bestellmenge beeinflussen. Der zunehmende Einsatz von EDV-gestützten Technologien zur Komplexitätsbewältigung wird ebenfalls thematisiert.
Wie wird der E-Commerce-Kontext berücksichtigt?
Die Arbeit fokussiert die praktische Anwendbarkeit der optimalen Bestellmenge im E-Commerce. Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus dem E-Commerce-Umfeld ergeben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Optimale Bestellmenge, E-Commerce, Andler-Formel, Beschaffungskosten, Lagerkosten, Bestellkosten, Materialwirtschaft, Systemtheorie, Komplexität, EDV-gestützte Technologien, Wirtschaftlichkeit.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Einführung, Definitionen, Theoretischem Ansatz, Hilfsmitteln zur Dispositionssteuerung, Theoretischem Grundrahmen Optimale Bestellmenge, Theoretischer Kritik, Praktischer Kritik, Letzter Anwendung der Formel in der Praxis, Fazit und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
- Arbeit zitieren
- Jan Christof Scheffold (Autor:in), 2002, Optimale Bestellmenge (Optimum Ordering Quantity) in Zeiten des e-commerce, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6287