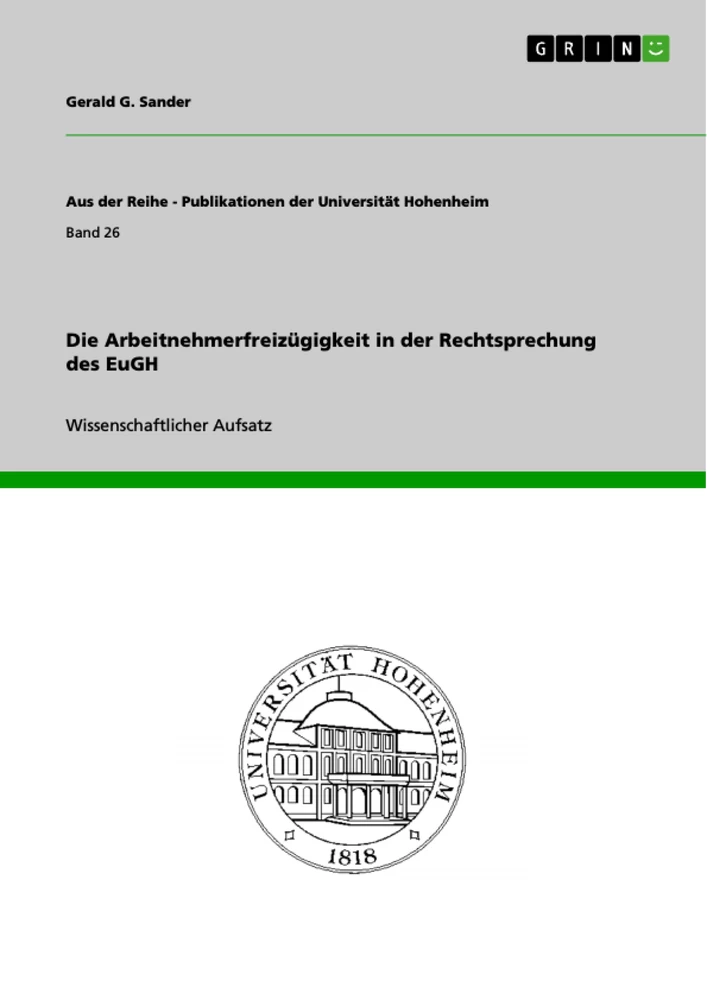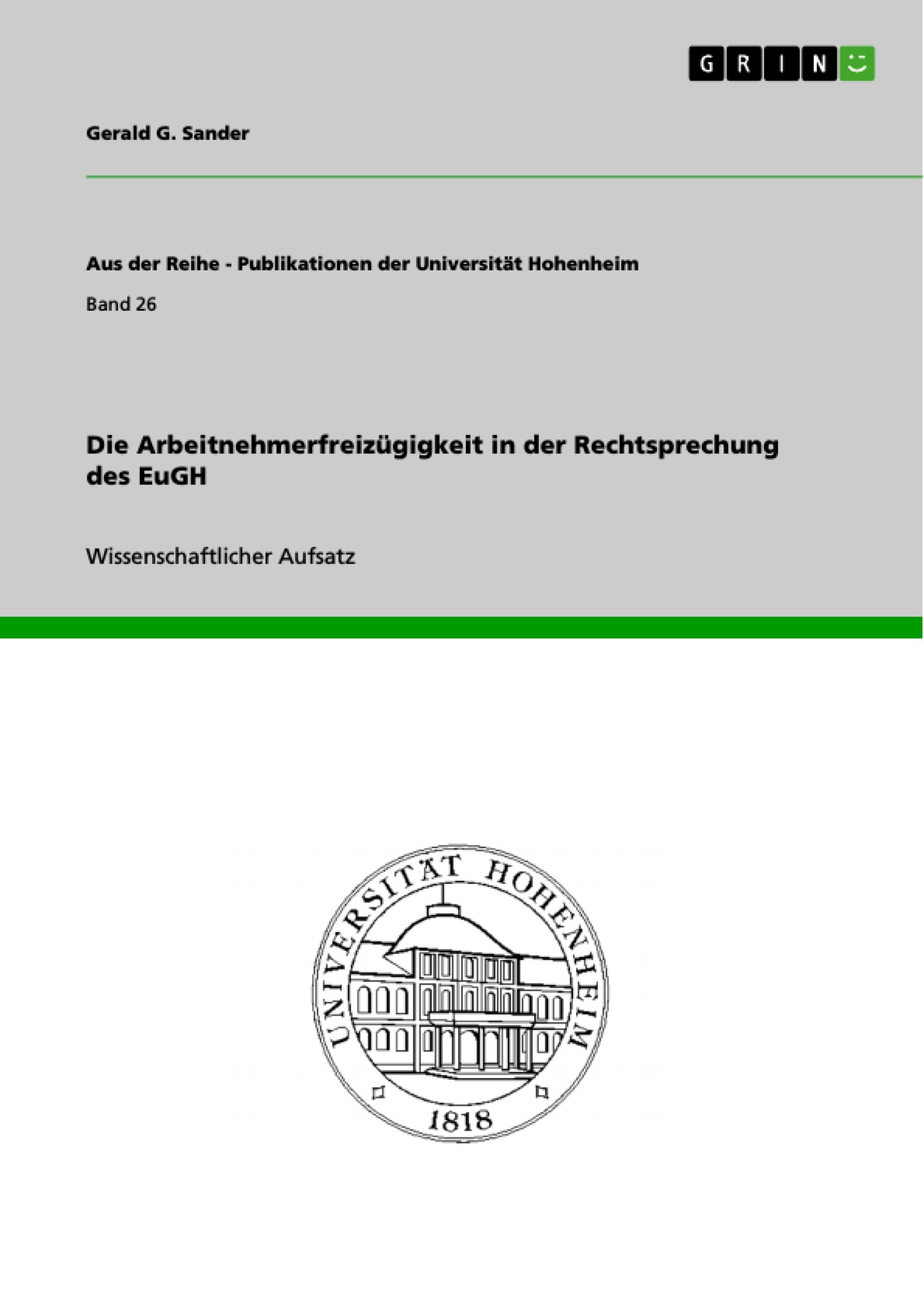Das Jahr 2006 ist zum Europäischen Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer erklärt worden. Ziel dieser Aktion ist die Sensibilisierung der Unionsbürger für die Rechte und Möglichkeiten zur Ausübung einer Berufstätigkeit in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Der Europäische Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit,Vladimir Špidla,wies in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass gegenwärtig nur ca. 2 % der Unionsbürger in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsland leben. Damit handelt es sich in etwa um den gleichen Anteil wie vor 30 Jahren.
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Art. 39 ff. EGV stellt eine der zentralen Grundfreiheiten des EG-Binnenmarktes dar. Das Ziel der Europäischen Gemeinschaft, einen Gemeinsamen Markt zu schaffen (vgl. Art. 14 Abs. 1 EGV), kann ohne eine weitgehende Mobilität auch des Produktionsfaktors Arbeit nicht verwirklicht werden. Allerdings werfen Wanderungsbewegungen von Arbeitnehmern innerhalb der EU erhebliche soziale und arbeitsmarktpolitische Fragen mit teilweise hohem Konfliktpotenzial auf, die zu einer progressiven Anpassung der nationalen Rechtsordnungen geführt haben. Insbesondere die langfristige soziale und gesellschaftliche Eingliederung der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen gewann an Bedeutung, weil viele Wanderarbeitnehmer nicht mehr in ihre Heimat zurückkehrten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit
- 1. Sachlicher Anwendungsbereich
- a) Grenzüberschreitende wirtschaftliche Betätigung
- b) Öffentliche Verwaltung als Bereichsausnahme
- 2. Persönlicher Anwendungsbereich
- a) Der Arbeitnehmerbegriff
- b) Ausweitung auf weitere Personengruppen
- c) Fazit
- 3. Räumlicher Anwendungsbereich
- a) Übergangsfristen für Angehörige neu beigetretener Staaten
- b) Aktuelle Entwicklungen in Bezug auf Angehörige von Drittstaaten
- 1. Sachlicher Anwendungsbereich
- II. Inhalt des Freizügigkeitsrechts für Arbeitnehmer
- 1. Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot in Art. 39 Abs. 2 EGV
- a) Verbot von offenen und versteckten Diskriminierungen
- b) Erweiterung zum allgemeinen Beschränkungsverbot
- c) Drittwirkung des Diskriminierungsverbots
- d) Rechtfertigung diskriminierender oder beschränkender Maßnahmen
- 2. Freizügigkeitsrechte gem. Art. 39 Abs. 3 EGV
- a) Die einzelnen Begleitrechte
- b) Rechtfertigungsgründe für nationale Beschränkungen
- 1. Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot in Art. 39 Abs. 2 EGV
- III. Regelungen im sekundären Gemeinschaftsrecht
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Arbeitnehmerfreizügigkeit im Kontext der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Ziel ist es, den Anwendungsbereich, die Inhalte und die Grenzen der Arbeitnehmerfreizügigkeit im europäischen Recht zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Rechtsprechung des EuGH zu diesem Thema und diskutiert die Herausforderungen, die sich aus der Mobilität von Arbeitnehmern innerhalb der EU ergeben.
- Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit (sachlich, persönlich, räumlich)
- Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot nach Art. 39 Abs. 2 EGV
- Freizügigkeitsrechte nach Art. 39 Abs. 3 EGV
- Der Arbeitnehmerbegriff in der Rechtsprechung des EuGH
- Die Rolle des sekundären Gemeinschaftsrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein und betont deren Bedeutung für den europäischen Binnenmarkt. Sie verweist auf die geringe Mobilität von Arbeitnehmern innerhalb der EU und hebt die sozialen und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen hervor, die mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit verbunden sind. Die Einleitung legt den Fokus auf die Bedeutung der langfristigen sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung der Arbeitnehmer und ihrer Familien.
I. Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit: Dieses Kapitel untersucht den sachlichen, persönlichen und räumlichen Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Im sachlichen Bereich wird die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Tätigkeit betont und die Ausnahme der öffentlichen Verwaltung erläutert. Der persönliche Anwendungsbereich wird durch die Definition des „Arbeitnehmers“ im EU-Recht bestimmt, wobei der EuGH eine einheitliche Auslegung betont. Der räumliche Anwendungsbereich umfasst die EU-Mitgliedstaaten, wobei Übergangsfristen und die Situation von Drittstaatsangehörigen berücksichtigt werden. Die Bedeutung der Rechtsprechung des EuGH zur Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbständigen wird hervorgehoben. Beispiele aus der Rechtsprechung veranschaulichen die unterschiedlichen Auslegungen und die damit verbundenen Herausforderungen.
II. Inhalt des Freizügigkeitsrechts für Arbeitnehmer: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Inhalt des Freizügigkeitsrechts, insbesondere mit dem Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot nach Art. 39 Abs. 2 EGV und den Freizügigkeitsrechten nach Art. 39 Abs. 3 EGV. Es analysiert die Rechtsprechung des EuGH zum Verbot offener und versteckter Diskriminierungen, zur Erweiterung des Verbots zu einem allgemeinen Beschränkungsverbot und zur Drittwirkung des Diskriminierungsverbots. Die Rechtfertigung diskriminierender oder beschränkender Maßnahmen wird ebenso erörtert wie die einzelnen Begleitrechte und die Rechtfertigungsgründe für nationale Beschränkungen. Die Bedeutung der Verhältnismäßigkeitsprüfung wird verdeutlicht und anhand von Beispielsfällen illustriert.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerfreizügigkeit, EuGH-Rechtsprechung, Binnenmarkt, Diskriminierungsverbot, Beschränkungsverbot, Art. 39 EGV, Arbeitnehmerbegriff, öffentliche Verwaltung, grenzüberschreitende Tätigkeit, Begleitrechte, sekundäres Gemeinschaftsrecht, soziale Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeitnehmerfreizügigkeit
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Arbeitnehmerfreizügigkeit im europäischen Recht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Thema.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt den Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit (sachlich, persönlich, räumlich), das Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot nach Art. 39 Abs. 2 EGV, die Freizügigkeitsrechte nach Art. 39 Abs. 3 EGV, den Arbeitnehmerbegriff in der Rechtsprechung des EuGH und die Rolle des sekundären Gemeinschaftsrechts. Es werden auch Übergangsfristen für Angehörige neu beigetretener Staaten und die aktuelle Entwicklung in Bezug auf Angehörige von Drittstaaten beleuchtet.
Wie wird der Anwendungsbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit definiert?
Der Anwendungsbereich wird dreigeteilt betrachtet: sachlich (grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeit, Ausnahme öffentliche Verwaltung), persönlich (Arbeitnehmerbegriff, Ausweitung auf weitere Personengruppen) und räumlich (EU-Mitgliedstaaten, Übergangsfristen, Drittstaatsangehörige). Die Rechtsprechung des EuGH zur Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbstständigen spielt dabei eine wichtige Rolle.
Was besagen das Diskriminierungs- und Beschränkungsverbot nach Art. 39 Abs. 2 EGV?
Art. 39 Abs. 2 EGV verbietet offene und versteckte Diskriminierungen von Arbeitnehmern aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Dieses Verbot wird vom EuGH weit ausgelegt und umfasst auch allgemeine Beschränkungen. Das Dokument analysiert die Drittwirkung dieses Verbots und die Möglichkeiten, diskriminierende oder beschränkende Maßnahmen zu rechtfertigen.
Welche Freizügigkeitsrechte sind nach Art. 39 Abs. 3 EGV gewährleistet?
Art. 39 Abs. 3 EGV gewährleistet verschiedene Begleitrechte für Arbeitnehmer. Das Dokument analysiert diese Rechte und die Rechtfertigungsgründe für nationale Beschränkungen. Die Bedeutung der Verhältnismäßigkeitsprüfung wird hierbei hervorgehoben.
Welche Rolle spielt das sekundäre Gemeinschaftsrecht?
Das Dokument erwähnt die Bedeutung des sekundären Gemeinschaftsrechts, geht aber nicht detailliert darauf ein. Es deutet an, dass dieses Recht weitere Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit enthält.
Wie wird der Arbeitnehmerbegriff in der Rechtsprechung des EuGH definiert?
Das Dokument betont die einheitliche Auslegung des Arbeitnehmerbegriffs durch den EuGH, geht aber nicht auf die konkrete Definition im Detail ein. Es verweist jedoch auf die Bedeutung der Rechtsprechung für die Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbstständigen.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis des Dokuments relevant?
Schlüsselwörter sind: Arbeitnehmerfreizügigkeit, EuGH-Rechtsprechung, Binnenmarkt, Diskriminierungsverbot, Beschränkungsverbot, Art. 39 EGV, Arbeitnehmerbegriff, öffentliche Verwaltung, grenzüberschreitende Tätigkeit, Begleitrechte, sekundäres Gemeinschaftsrecht, soziale Sicherheit.
- Quote paper
- Dr. Gerald G. Sander (Author), 2006, Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Rechtsprechung des EuGH, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62839